Die Küste, Heft 78 (2011) 1-294
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Ausflugsfahrten 2021
RegelnCOVID-19 im Innenteil Fahrkarten Online unter wattenmeerfahrten.de oder im Vorverkauf: Föhr-Amrumer Reisebüro (Wyk), Tourist-Informationen (Wyk, Nieblum, Utersum) List Sie können Ihre Fahrkarte auch am Schiff vor der Abfahrt erwerben, solange Plätze frei sind. Ausflugsfahrten Hallig Hooge Große Halligmeer-Kreuzfahrt Seetierfang MS Hauke Haien stellt sich vor Alle Schiffsabfahrts- und Ankunftszeiten gelten nur bei normalen Wind-, Wasser- und Sichtverhältnissen sowie genügender Beteiligung. Irrtum und Änderungen vorbehal- ten. Ankunftszeiten können auf Grund der Tide variieren. Es gelten die Beförderungs- Erwachsene Kinder (4-14 J) Familien* Erwachsene Kinder (4-14 J) Familien* Erwachsene Kinder (4-14 J) Familien* bedingungen der Halligreederei MS Hauke Haien. Wir, die Familie Diedrichsen, betreiben das Schiff seit 1988 2021 35 € 15 € 95 € 35 € 15 € 95 € 30 € 15 € 80 € und unser Heimathafen ist Hallig Hooge. Den Namen „Hau- ke Haien“ erhielt das Schiff nach der Hauptfigur aus Theodor Inkl. Seetierfang & Seehundsbänke (tideabhängig) Auf Hallig Gröde (1 Std. Landgang) · Seehundsbänke (tideabh.) Auf diesen Touren zeigen wir Ihnen die Unterwasserwelt. In der Für besondere Anlässe können Sie unser Schiff Wir wollen Sie auf Seereise zur Hallig Hooge mitnehmen. Am An- Unser Kurs geht ins östliche Wattenmeer vorbei an den Halligen Nähe der Wyker Küste wird ein Schleppnetz ausgeworfen und Storms Novelle „Der Schimmelreiter“. Unser Schiff wurde 1960 ab Wyk auf Föhr (alte Mole) leger können Fahrräder oder Kutschen gebucht werden, oder Sie Langeneß , Hooge, Oland, Gröde, Habel, Hamburger Hallig, Nord- der Seetierfang an Bord vom Kapitän oder der gebürtigen Nord- als erste Halligfähre von „Kapitän August Jakobs“ mit dem Na- auch chartern. Sprechen Sie uns gerneNiebüll an. -

Herzlich Willkommen!
HERZLICH WILLKOMMEN! Schön, dass Sie da sind. Lassen Sie sich jetzt von uns verwöhnen und genießen Sie die einmalige Atmosphäre im Café Steigleder. Wir wünschen Ihnen eine genussreiche Zeit. Ob beim Frühstück, zur kleinen Mittagspause, zur Kaff eestunde oder zum Abendbrot. Seit 1919 verschreibt sich unser Familienbetrieb, mit viel Leidenschaft und einer ordentlichen Portion Hingabe, dem Echten Genuss. Unsere hauseigene Konditorei stellt eine verführerische Auswahl an Torten und Gebäck-Kreationen für Sie her. Bestellen Sie gleich am Kuchentresen – natürlich gibt es alles auch zum Mitnehmen. Sollten Sie von Allergien und/oder Unverträglichkeiten betroff en sein, können Sie sämtliche Information zu den in unseren Speisen und Getränken verwendeten Allergenen erhalten. Sprechen Sie uns einfach an! Da wir ein Handwerksbetrieb sind und alles bis auf wenige Ausnahmen selber herstellen ,weisen wir vorsichtshalber darauf hin, dass unsere Backwaren Spuren von Weizen oder Schalenfrüchte enthalten können. UNSERE ÖFFNUNGSZEITEN Täglich von 9.00 bis 19.00 Uhr nur von November bis April ist Mittwoch unser Ruhetag. Please ask our Service Kontakt venligst vores for the english menu. service til en dansk menu. FRÜHSTÜCK – AB 9:00 UHR – Gourmet Frühstück (für zwei) 24,90 4 Brötchen, Brot, Toast, Butter, Auswahl an Wurst- 5 und Käsespezialitäten , Rührei, geräucheter Lachs, Fleischsalat, hausgemachte Marmelade und Heiß- getränke einer Sorte satt. mit 2 Gläsern O-Saft (0,2l) 28,90 oder mit 2 Gläsern Sekt (0,1l) 31,40 Großes Kapitäns-Frühstück 14,60 2 Brötchen, Brot, Butter, Auswahl an Wurst- und 5 Käsespezialitäten ,geräucheter Lachs, 1 gekochtes Ei, hausgemachte Marmelade, 1 Glas O-Saft (0,1l) und 1 Heißgetränk (Kännchen) Wyker Frühstück 9,50 2 Brötchen, Brot, Butter, Auswahl an Wurst- 5 und Käsespezialitäten , hausgemachte Marmelade und 1 Heißgetränk (Kännchen) Alle Frühstücke werden liebevoll garniert. -

Bachelorarbeit Im Studiengang Naturschutz Und Landnutzungsplanung
Bachelorarbeit im Studiengang Naturschutz und Landnutzungsplanung. Zur Erlangung des akademischen Grades Bachelor of Science (B. Sc.) Im Fachbereich Landschaftswissenschaften und Geomatik An der Hochschule Neubrandenburg HALLIG NORDEROOG – KINDERSTUBE DER BRANDSEESCHWALBE- EINE BESTANDSAUFNAHME ZU DEN VEGETATIONSVERÄNDERUNGEN UND DEN DAMIT VERBUNDENEN AUSWIRKUNGEN AUF DAS BRUTVERHALTEN DER BRANDSEESCHWALBE Von: Stefanie Hansen betreut durch: Prof. Dr. Helmut Lührs Dipl.–Ing.(FH) Christel Grave Abgabetermin: 06.10.2016 urn:nbn:de:gbv:519-thesis2016-0232-0 Danksagung Ich möchte allen Menschen danken, die meinen Weg zu diesem Abschluss durch ihre Begleitung bereichert haben. Mein besonderer Dank gilt Herrn Prof. Dr. Helmut Lührs, der im dritten Semester meine Begeisterung für Vegetationskunde und Pflan- zensoziologie geweckt und seither gefördert hat. Für die intensive und sehr persönli- che Betreuung zu dieser Arbeit, danke ich Herrn Lührs sehr. Ganz besonders danke ich auch Frau Christel Grave für die kompetente und engagierte Betreuung und die freundschaftliche Zusammenarbeit. Ich möchte mich bei den Mittarbeitern des Verein Jordsand im Haus der Natur für die nette Hilfe bei der Archivrecherche bedanken. Den Herren Bernd Sauerwein und Eberhard Klauck danke ich für die sehr nette und schnelle Hilfe bei der Nachbestimmung der rätselhaften Norderooger Quecken. Mein Dank geht auch an alle Vogelwarte/innen der vergangenen Jahrzehnte, ohne deren Einsatz der Seevogelschutz auf Norderoog und ohne deren Dokumentations- arbeit diese Bachelorarbeit nicht möglich gewesen wäre. Gleiches gilt für Hunderte von freiwilligen Workcampteilnehmer/innen, die mit ihrem selbst- und grenzenlosen Einsatz den Erhalt der Hallig sichern. Ich danke Christian dafür, dass er mir im Schreibprozess zu jeder Zeit mit Rat und Tat zur Seite stand. Allen Korrekturlesern gilt mein Dank ebenso. -

Atlas Der Säugetiere Schleswig-Holsteins
Atlas der Säugetiere Schleswig-Holsteins von Peter Borkenhagen Kiel 1993 Herausgeber: Landesamt für rledrhhalitzspu fndl eg e Schleswig-Holstein Hansaring 1 24145 Kiel Verfasser: Dr. Peter Borkenhagen Titelfotos, thrkee/ ar'rhzag ,Herstellung:If Druckerei Fotosatz Nord Mtland 8a 24109 Kiel November 1993 ISBN 3-923339-30-5 e‘l-Y 3 Der Umschlag dieser Broschüre wurde auf chlorfrei gebleichtem, der Innenteil auf Recycling- papier gedruckt. Diese Druckschrift wird im Rahmen der Öffent- lichkeitsarbeit der schleswig-holsteinischen Landesregierung heraus- gegeben. Sie darf weder von Parteien noch von Personen, die Wahlwer- bung oder Wahlhilfe betreiben, im Wahlkampf zum Zweckeerwder V2fil- Werr2? "nd Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorste- henden Wahl darf die Druckschrift nicht in einer Weise verwendet werden, die als Parteinahme der Landesregierung zugun- sten einzelner Gruppen verstanden werden könnte. Den Parteien ist es gestattet, die Druckschrift zur Unterrichtung ihrer eigenen Mitglieder zu ver- wenden. Vorwort Mit dem "Atlas der Säugetiere Schleswig-Holsteins" gibt das Landesamt für Naturschutz und Landschafts- pflege nach dem "Atlas der Land- und Süßwassermollusken" einen weiteren ökologischen Atlas heraus, der Grundlage für ein modernes Biomonitoring wichtiger Tiergruppen sein kann. In diesem Biomonitoring werden vor allem biologische, ökologische und verbreitungsbezogene Daten über Organismen-Arten ein- gebracht. Ein solcher moderner Typ regionaler ökologischer Atlanten für möglichst alle Arten einer Orga- nismengruppe stellt eine wichtige und unverzichtbare Grundlage für den Artenschutz und die Methodik des Biotopschutzes dar. Hinzu kommt die Schaffung von Bewertungsmöglichkeiten bei der Effektivitätskontrol- le von umfassenden Naturschutzmaßnahmen und von Naturschutzprojekten. Das Kartenmaterial für jede Art zeigt auf, wo bestimmte Ansiedlungsräume aufgegeben oder wieder in Be- sitz genommen wurden. -
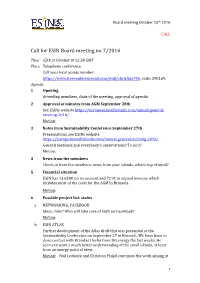
Call for Board Meeting Oct 25
Board meeting October 25th 2016 CALL Call for ESIN Board meeting no 7/2016 Time 25th of October at 12:30 GMT Place Telephone conference Call your local access number: https://www.freeconferencecall.com/wall/christian706, code: 590169. Agenda 1 Opening Attending members, chair of the meeting, approval of agenda. 2 Approval of minutes from AGM September 28th See ESINs website https://europeansmallislands.com/annual-general- meeting-2016/ Motion: 3 Notes from Sustainability Conference September 27th Presentations, see ESINs website https://europeansmallislands.com/annual-general-meeting-2016/ General feedback and everybody’s observations? To do’s? Motion: 4 News from the members Check-in from the members: news from your islands, what’s top of mind? 5 Financial situation ESIN has 13.658€ on its account and 721€ in unpaid invoices which includes most of the costs for the AGM in Brussels. Motion: 6 Possible project list: status a NETWORKING, FACEBOOK Ideas, links? Who will take care of ESIN on FaceBook? Motion: b ESIN ATLAS Further development of the Atlas draft that was presented at the Sustainability Conference on September 27 in Brussels. We have been in close contact with Brendan Devlin from DG energy the last weeks. He seems to want a much better understanding of the small islands, at least from an energy point of view. Motion: Neil Lodwick and Christian Pleijel continues the work aiming at 1 Board meeting October 25th 2016 CALL defining a set of sustainability indicators through a study involving us as a partner and, hopefully, financed by DG Energy. c ENTREPRENEURSHIP A project addressing that small islands lack economies of scale and their businesses are under pressure of high costs regarding transports, distribution and production (see CPMR paper “Off the Coast of Europe”, 2002). -

6 the North Frisians and the Wadden Sea
6 The North Frisians and the Wadden Sea Thomas Steensen Abstract The Wadden Sea is not the edge of North Frisia, it is not a marginal part, but an integral and central element. The district of North Frisia (Kreis Nordfriesland), founded in 1970, covers an area of 2,083 square kilometres. To that must be added the Wadden region between the Eider River and the Lister Tief, covering an area of about 1,750 square kilometres. North Frisia consists of 55 percent land and no less than 45 percent mudflats. The Wadden Sea, especially the North Frisian part of it, has been shaped by an interplay over centuries between man and his natural surroundings, a phenomenon that it difficult to find elsewhere in the world. Large parts of the Wadden Sea form a ‘cemetery of the marshlands’. Kulturspuren (traces of culture) such as remains of terps and dikesdike, bricks, pottery shards, tidal gates, ditch systems, furrows, entire farming fields, and places of early salt peat extraction are a testament to the interdependence between man and nature. Archaeologist Hans Joachim Kühn considers this ‘an inexhaustible archive of remembrance and research, sometimes even of shudder’. Throughout the centuries, there has been a special relationship between the North Frisians and the Wadden Sea. This is reflected by the intense discussions on the establishment of a national park. It really would have been appropriate if in 2009 the Wadden Sea had been recognised not only as a World Natural Heritage Site but also as a World Cultural Heritage Site. So far, this cultural landscape has not been sufficiently put into focus. -

Biosphäre Halligen Einzigartig Die Halligwelt Entdecken
Biosphäre Halligen Einzigartig Die Halligwelt entdecken Ganz oben im hohen Norden sind sie zu „Schwim men de Träu me” hat der Dich ter Hause. Fast unberührt und ursprünglich lie- Theo dor Storm die Hal li gen einst ge nannt gen sie da. Umspült von der rauen Nordsee, und wer sie ein mal er lebt hat, schwärmt von nahezu ungeschützt den Gewalten der Natur ih rem be son de ren Licht und der Ein ma lig keit ausgesetzt. Wunderschön, faszinierend, be- ih rer Na tur in mit en der Nord see. Mitlerwei- sondere Schätze, die jeder einmal gesehen le zum Weltnaturerbe ernannt, empfängt Sie haben sollte: die nordfriesischen Halligen. das Watenmeer mit einer Weite, die ihres- Kleine Marschinseln mit Häusern, die auf gleichen sucht. Warften thronen und die insgesamt 260 Hal- liglüüd mit Stolz ihr Zuhause nennen. Wir la den Sie herz lich ein. Nirgend- wo sind Sie diesem unvergleichlichen Gehen Sie mit uns auf eine ganz besondere Lebensraum näher. Erleben Sie einen Inhaltsverzeichnis Seite Reise und entdecken Sie diese einzigartige Ort voller Weite, Entspannung und Welt für sich. Natur pur. Die Biosphäre Halligen 4-5 Halligzauber 6-9 Hallig Gröde 10-11 Hallig Hooge 12-13 Hallig Langeneß 14-15 Hallig Nordstrandischmoor 16-17 Hallig Oland 18-19 Gastgeberverzeichnis 20-21 Naturzauber 22-23 Anreise und Übersichtskarte 24-25 S. 2 S. 3 Naturerbe vielfältig Das ganze Jahr erlebenswert – immer wieder anders und immer wieder Neues zu entdecken! Hartlich willkomen Meeresgrund trifft Horizont Herzlich willkommen in der Biosphäre und im Einklang mit der Natur leben. Bio- Das Watenmeer ist eine der letzten groß- Außerdem leben hier Schweinswale, Seehun- Halligen. -

INHALT 6 Die Hailigen 1 Fahrt Durch Das Halligmeer Io 2 Eine
INHALT 6 Die Hailigen • Jäger und Sammler • Selbstversorger 8 1 Fahrt durch das Halligmeer • Halligkirchen • Wege und Stege io 2 Eine Landschaft entsteht • Lorenbahn • Die Entstehung der alten Marsch • Was ist eine Hallig? 62 6 Das Halligjahr in alter Zeit • Es leben Menschen auf Hügeln • Die Friesen und der frühe Deichbau 66 7 Kultur und Brauch • Im Mittelalter • Friesisch • Die erste Große Mandränke • Halligtracht • Die Sage von Rungholt • Biikebrennen • Karten und Halligen • Rummelpottlaufen 22 3 Reichtum und Armut: 72 8 Auf dem Weg in Die Seefahrerzeit. die Moderne • Die zweite Große Mandränke - • Die Sturmflut von 1962 Die Burchardiflut von 1634 • Die neuen Häuser • Die Walfangzeit auf den Halligen • Verkehr • Totenreisen • Post • Die Weihnachtsflut 1717 • Tourismus • Handel mit fernen Ländern • Kapitänsgeschichten 82 9 Das moderne Halligleben • Das tägliche Leben- 34 4 Landverlust und • Gesundheit und Krankheit Halligschutz • Schule • Verschwundene Halligen • Arbeitswelten • Die Legende der Hayenshallig • Landunter • Die Halligflut 1825 • Zukunft der Halligen • Landverlust und Halligschutz 92 10 Biosphäre, Nationalpark 46 5 Das alte Halligleben und Weltnaturerbe • Die Warft • Biosphäre Halligen • Das Hallighaus • Nationalpark Schleswig • Fething und Sodbrunnen Holsteinisches Wattemeer • Ditten - Wärme aus Dung • Das UNESCO Weltnaturerbe • Allmende • Menschen, die sich darum kümmern 4 INHALT http://d-nb.info/1027348823 96 11 Landschaft und Natur 174 17 Hallig Habel im Wattenmeer • Ebbe und Flut 178 18 Nordstrandischmoor • Vogelwelten -

Hintergrund Erleben & Gewiessen Touren
HINTERGRUND ERLEBEN & 12 Inseln im Wind GEWIESSEN 14 Fakten 15 Natur und Umwelt 64 Essen und Trinken 20 D Infografik: Sonne, Sand 65 Gastronomische Vielfalt und Meer 68 OD Typisch nordfriesische 26 D Die Nordfriesischen Gerichte Inseln auf einen Blick 70 El Special: Küstenschützer 30 Bevölkerung -Wirtschaft und Sonntagsbraten 32 fl Willkommen im Alltag! 72 Feiertage • Feste • 34 Geschichte Events 35 Vom Meer bestimmt 73 Buntes Programm 38 H Infografik: Sisyphus- 76 IQ Special: Friesische Arbeit vor Sylt Traditionen 42 D Special: Ins Nordmeer zum Walfang 78 Mit Kindern unterwegs 46 Kunst und Kultur 79 Piraten & Naturforscher 47 Eigenständige Entwicklung 52 H 3D: Nordfriesisches 82 Shopping Ständerhaus 83 (Fast) jeden Tag bummeln 56 Berühmte 86 Übernachten Persönlichkeiten 87 Große Auswahl und Nachfrage 90 Urlaub aktiv 91 An Land, auf und im Wasser 92 OS Special: Vom Badekleid zum Lichtkleid TOUREN 102 Unterwegs auf den Inseln 105 Tour 1: Von Wenningstedt nach List 107 Tour 2: Mit dem Rad rund um Amrum 109 Tour 3: Föhrer Inselrunde Trendsportart vor der Insel Sylt: Kite-Surfen http://d-nb.info/1041266502 REISEZIELE 174 Föhr VON A BIS Z 177 Alkersum 178 Borgsum 179 Dunsum 114 Sylt 179 Midlum 117 Archsum 180 Nieblum 119 Braderup 183 Oevenum 120 Hörnum 123 Kampen 124 D Special: Prominente PREISKATEGORIEN untersteh Restaurants 131 Keitum (Preis für ein Hauptgericht) 137 List @839 = über 30 € 141 Morsum @®@= 20-30 € 143 Munkmarsch 80= 10-20 € 144 Rantum © = bis 10 € 147 Tinnum Hotels (Preis für ein DZ, Sylt vor, 148 Wenningstedt andere Inseln in der Klammer) 151 Westerland @@@8 = ab 300 (250) € 888 = 200-300 (150-250) € 156 Amrum SO = 100-200 (60-150) € 159 Nebel 8 = bis 100 (60) € 162 Norddorf 165 Steenodde Hinweis 167 Süddorf Gebührenpflichtige Service 168 n Infografik: Leuchtzeichen nummern sind mit einem Stern am Horizont gekennzeichnet: *0180.. -

Waddenland Outstanding History, Landscapehistory, and Cultural of Heritage the Sea Wadden Region Edited by Linde Egberts and Meindert Schroor
LANDSCAPE AND HERITAGE STUDIES Egberts & Schroor (eds) Waddenland Outstanding Edited by Linde Egberts and Meindert Schroor Waddenland Outstanding History, Landscape and Cultural Heritage of the Wadden Sea Region Waddenland Outstanding Landscape and Heritage Studies Landscape and Heritage Studies (LHS) is an English-language series about the history, heritage and transformation of the natural and cultural landscape and the built environment. The series aims at the promotion of new directions as well as the rediscovery and exploration of lost tracks in landscape and heritage research. Both theoretically oriented approaches and detailed empirical studies play an important part in the realization of this objective. The series explicitly focuses on: – the interactions between physical and material aspects of landscapes and landscape experiences, meanings and representations; – perspectives on the temporality and dynamic of landscape that go beyond traditional concepts of time, dating and chronology; – the urban-rural nexus in the context of historical and present-day transformations of the landscape and the built environment; – multidisciplinary, integrative and comparative approaches from geography, spatial, social and natural sciences, history, archaeology and cultural sciences in order to understand the development of human-nature interactions through time and to study the natural, cultural and social values of places and landscapes; – the conceptualization and musealization of landscape as heritage and the role of ‘heritagescapes’ in the construction and reproduction of memories and identities; – the role of heritage practices in the transmission, design and transformation of (hidden) landscapes and the built environment, both past and present; – the appropriation of and engagement with sites, places, destinations, landscapes, monuments and buildings, and their representation and meaning in distinct cultural contexts. -

Die Küste, 10 Heft 1 (1962), 86-134
Die Küste, 10 Heft 1 (1962), 86-134 Die Trinkwasserversorgung der Halligen nach der Sturmflut im Februar 1962 (Ein Untersuchungs-, Erfahrungs- und Erlebnisbericht) Von'ErichWohlenberg A. Vorblemer-kong und Aufgabe 86 B. Die F:Ialligals Lebensraum im Wartenmeer I. Die Lebensweise der Bewohner . 90 II. Dcr Schichtenaufbau der Hallig . 91 III. Der Schutz der Halligen in der Neuzek 92 IV. Das Trink- und Trinkwasser auf den Halligen a. Das Grundwasser in Tiefe unter den gratierer Halligen . 92 b. Das Grundwasser Grade der Hallig . 94 c. Das Grundwasser der Hamburger Hallig 95 d. Das Grundwasser der Hallig Nordstrandischmoor 96 V. Die Warf mit Sood und Fething als Lebensgrundlage a. Sood und Fething als Wassersammler 98 b. Die H6henlage der Wohnhorizonte 101 C. Die Sturmf lut vom 16./17. Februar 1962 I. Der Zusammenbruch der ¥6llige Wasserversorgung . 105 II. Die des Norstandes Behebung „Wasser" . 107 III. Die von als AbschluE der Anlage Wasserdepors Wasserversorgung . 113 IV. Die demische Untersuchung des Trink- und Treinkwassers nach der Sturmflur 115 a. Der im Trinkwasser der de Salzgehalt . 115 b. Der Salzgehalt im Trinkwasser der Ferhinge 1. Die auf der Fethinge Hallig Nordmarsch-Langeness . 119 2. Der Triinkwassersood unter dem Maifeld bei Suderharn 121 3. Der Ferhing auf Hallig Gr6de 123 4. Die 1 Fethinge auf Hallig Hooge . 124 c. Die Salzgehaltsverteilung in den Depot-Fethingen 1. Die Depot-Fethinge auf Hallig Hooge 125 2. Die Depot-Fethinge auf Hallig Nordmarsch-Langeness 126 d. Der im Eis des Warrenmeeres Salzgehalt . 127 D. Das Sanierungsprogramm fiir die Halligen und I. Hausbau Wasserleitung 129 II. Sood und trotz Fething Wasserleitimg7 . -

Westküste, Heft 1
Article, Published Version Pfeiffer, Hans Die Arbeiten an der schleswig-holsteinischen Westküste seit 1933 Westküste Zur Verfügung gestellt in Kooperation mit/Provided in Cooperation with: Kuratorium für Forschung im Küsteningenieurwesen (KFKI) Verfügbar unter/Available at: https://hdl.handle.net/20.500.11970/100519 Vorgeschlagene Zitierweise/Suggested citation: Pfeiffer, Hans (1938): Die Arbeiten an der schleswig-holsteinischen Westküste seit 1933. In: Westküste 1, 1. Heide, Holstein: Boyens. S. 24-51. Standardnutzungsbedingungen/Terms of Use: Die Dokumente in HENRY stehen unter der Creative Commons Lizenz CC BY 4.0, sofern keine abweichenden Nutzungsbedingungen getroffen wurden. Damit ist sowohl die kommerzielle Nutzung als auch das Teilen, die Weiterbearbeitung und Speicherung erlaubt. Das Verwenden und das Bearbeiten stehen unter der Bedingung der Namensnennung. Im Einzelfall kann eine restriktivere Lizenz gelten; dann gelten abweichend von den obigen Nutzungsbedingungen die in der dort genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte. Documents in HENRY are made available under the Creative Commons License CC BY 4.0, if no other license is applicable. Under CC BY 4.0 commercial use and sharing, remixing, transforming, and building upon the material of the work is permitted. In some cases a different, more restrictive license may apply; if applicable the terms of the restrictive license will be binding. 24 Die Arbeiten an der schleswig-holsteinischen Westküste seit 1933. Von H ans P f e i ff e r. In den Jahren 1933 bis 1937 sind an der schleswig-holsteinischen West küste eine große Anzahl umfangreicher Bauvorhaben zur Durchführung ge kommen. Als Grundlage für diese Arbeiten hat der vom Herrn Oberpräsi• denten in Kiel im Jahre 1933 aufgestellte 10-Jahresplan gedient.