Volkhard Knigge
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Zeitgeschichte
Zeitgeschichte 40 Jahre »Deutschland Archiv« Eine Zeitschrift im Dienst von DDR-Forschung und Wiedervereinigung1 Karl Wilhelm Fricke, Köln Die Chronik einer Zeitschrift aus Anlass eines Er- torisch absehbarer Zeit erreichbar schien, war für nie- scheinungsjubiläums aufzuzeichnen, Rückschau zu manden absehbar. Manche Politiker und Publizisten halten auf das in vier Jahrzehnten Geleistete, das hatten das Ziel schon abgeschrieben und wähnten den Abwägen von Kontinuität und Wandel eines Perio- Status quo als Dauerzustand. Umso nachdrücklicher dikums mit zeithistorischer Perspektive – das alles war daher die Herausgabe einer Zeitschrift speziell kann zur geschichtspolitischen Erinnerungskultur für Fragen der DDR und der Deutschlandpolitik an- beitragen, wenn es sich wie im gegebenen Fall um gesagt, die sich fortan auch der sich herausbildenden das Deutschland Archiv handelt. Oder scheint dieses wissenschaftlichen DDR-Forschung widmen wollte. Unterfangen anmaßend? Nein, es ist nicht anmaßend – Nicht zufällig kam es zur Gründung des Deutschland es ist Chronistenpflicht. Archiv im Kontext der ersten, ihrer Kontroversen we- gen legendären DDR-Forschertagung, die vom 19. – 23. Im Grunde genommen spiegelt sich die Geschichte September 1967 an der Akademie für Politische Bil- des Deutschland Archiv in seinem Untertitel wider, dung in Tutzing zum Generalthema »Situation, Aufga- der in seiner 40-jährigen Existenz dreimal neu for- ben und Probleme der DDR-Forschung« stattgefunden muliert wurde. Als das DA, wie die Zeitschrift häufig hatte. Grundlegend war ein kluges Referat, das Dieter zitiert wird, im April 1968 erstmals erschien, lautete Haack, damals Oberregierungsrat im Bundesminis- der Untertitel »Zeitschrift für Fragen der DDR und terium für Gesamtdeutsche Fragen, in Tutzing hielt. der Deutschlandpolitik«. Der Untertitel hatte Bestand Sein Postulat war eindeutig: »Gesamtdeutsche Politik bis Juni 1990. -

Gesamtheft 153
Monatliche Publikation, . herausgegeben von der 153/154 Juli/August 2003 Rosa-Luxemburg-Stiftung VorSatz 581 Essay ULRICH BUSCH Agenda 2010 – das deutsche Programm für einen Gesellschaftsumbau 583 PDS – Wege aus der Krise THOMAS FALKNER Politik als Chance 592 MICHAEL CHRAPA Parteireform als Aufbruch? 603 STEFFEN KACHEL Zum Spannungsfeld von PDS und Parlamentarismus 609 JÖRN SCHÜTRUMPF Krisenhafte Kommunikation. Thesen 614 HEIKO HILKER Politische Kommunikation und PDS 617 ERHARD CROME PDS. Ansichten einer Krise 628 Nachhaltigkeit & Soziale Gerechtigkeit REINART BELLMANN, HUBERT LAITKO, KLAUS MEIER Generationengerechtigkeit: Die Verknüpfung ökologischer und sozialer Zielstellungen im Nachhaltigkeitskonzept 635 JOACHIM H. SPANGENBERG Soziale Nachhaltigkeit. Eine integrierte Perspektive für Deutschland 649 GÜNTHER BACHMANN Warum Nachhaltigkeit ? 662 KLAUS WARDENBACH Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit im 21. Jahrhundert. Der World Summit in Johannesburg 666 CHRISTA WICHTERICH Nachhaltigkeit und neoliberale Globalisierung aus feministischer Sicht 670 RONALD HÖHNER Der Stempel von Rio 675 GERHARD BANSE Integrative nachhaltige Entwicklung und Technikfolgenabschätzung 680 EDGAR GÖLL Nachhaltigkeitspolitik –Beispiele aus Europa 692 ELISABETH VOSS Wie nachhaltig ist die aktuelle Arbeitsmarktpolitik? 696 Ernst Bloch: Hoffnung muß gelernt werden VOLKER CAYSA Bloch – (k)ein toter Hund 698 ROGER BEHRENS Aktualisierung des Ungleichzeitigen. Anmerkungen zur Prozeßlogik einer mehrschichtigen Dialektik 707 MICHAEL BRIE Zwischen Wärmestrom und Kälteschock -

1 Karl Wilhelm Fricke: Widerstand Und Opposition Von 1945 Bis Ende Der Fünfziger Jahre Quelle: Deutscher Bundestag (Hrsg.): Ma
Karl Wilhelm Fricke: Widerstand und Opposition von 1945 bis Ende der fünfziger Jahre Quelle: Deutscher Bundestag (Hrsg.): Materialien der Enquete-Kommission. „Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der SED-Diktatur in Deutschland“ (12. Wahlperiode des Deutschen Bundestages), Bd. VII, Teil 1, S. 15-26. Auf eigene Definitionsversuche von Opposion und Dissidenz, Resistenz und Widerstand möchte ich hier verzichten. Sie blieben nach meiner Auffassung ohnehin fragwürdig, weil sich Geschichte, auch die Geschichte von Opposition und Widerstand in der DDR, als dialektischer Prozeß vollzieht und daher letztlich kaum definieren oder gar in das Prokrustesbett einer Theorie zwingen läßt. Der Berliner Historiker Peter Steinbach hat im Blick auf den Widerstand unter dem Hakenkreuz-Regime einmal geschrieben, daß „nicht primär eine historisch gesättigte Theorie des Widerstands anzustreben“ sei, „sondern eine möglichst farbige, inhaltlich und historisch differenzierte Gesamtgeschichte des Widerstands.“ Eine solche Gesamtgeschichte wäre ein wichtiger Beitrag der Historiker zu einer Theoriebildung oder, zumindest, zu einer Begriffsbestimmung von Opposition und Widerstand auch unter dem Regime der SED. Welche historischen Sachverhalte und Verhaltensweisen aus der Nachkriegszeit in der Sowjetischen Besatzungszone und aus den fünfziger Jahren in der DDR in eine solche Gesamtgeschichte einzubeziehen wären – eben dies will ich in der nächsten halben Stunde kurz aufzuzeigen versuchen als Einleitung zu einer hoffentlich lebhaften Diskussion mit den Zeitzeugen. Der -
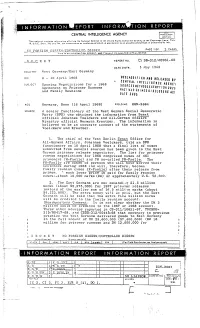
Information Eport Inform T1on Report -1Nformatio, N
•.4 INFORMATION EPORT INFORM T1ON REPORT CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY the EspIon•ce Lasse, Tilly This moirruisl enolnInt InformsIon •fferl i ng the 5•lsoot11 Defros, of the Untied 51•1rs the meaning of •rt unsulhotterd prison in ptohthiled hy 18, U.S.C. Secs, 7 ,1.1 sod 7 , 14, the ifsnsoni•ston or revels1ton of sehleh In •ny tn•nner, to PAGE 1 OF 3 PAGES ____FD_ZORT,I0N—P1.3.UM/C0.!:;_TROLLT0_,DI58U TtliS IS Jot It4e0nor•TION REPORT, tica rist•LL y (VALUATED INTELLIOENCE SELRET REPORT NO. CS DB-312/00961-68 DATEDMTR. 3 May 1968 COUNTRY West Germany/East Germany DM 6 - 10 April 1968 DECLASSIFIED LALNIDGERNEL EASE D NBUY C SUBJECT Opening Negotiations for a 1968 CE AGE f SOURCESMET Agreement on Prisoner Ransoms HODSEXEMPT ION 3D2E NAZI and Family Reunions WAR CR IMES DI S CLOSURE ACI GATE 2005 ACO Germany, Bonn (16 April 1968) FIELD NO. EGN-3684 SOURCE A senior functionary of the West German Social Democratic Party (SPD) who obtained the information from Senat official Johannes Voelckers and All-German Affairs Ministry official Hermann,Kreutzer. The information is believed to be an accurate account of the statements of Voelckers . and Kreutzer. I. The chief of the West Berlin Senat Office for All-German Affairs, Johannes Voelckers, tDld an SPD functionary on 10 April 1968 that a final list of names submitted from several sources has been given to the East German prisoner release negotiator. The list for prisoner ransom negotiations for 1968 comprised names of 461 prisoners (H-Fnelle) and 78 so-called FH-Faelle. -

Catholic and Protestant Faith Communities in Thuringia After the Second World War, 1945-1948
Catholic and Protestant faith communities in Thuringia after the Second World War, 1945-1948 A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Master of Arts in History in the University of Canterbury By Luke Fenwick University of Canterbury 2007 Table of contents Abstract 1 Acknowledgements 2 List of abbreviations 4 List of figures and maps 5 Introduction 6 Chapter 1: The end of the war, the occupiers and the churches 28 Chapter 2: The churches and the secular authorities, 1945-1948 51 Chapter 3: Church efforts in pastoral and material care, 1945-1948 77 Chapter 4: Church popularity and stagnation, 1945-1948 100 Chapter 5: The social influence of the churches: native Thuringians and refugees 127 Chapter 6: The churches, the Nazi past and denazification 144 Chapter 7: Church conceptions of guilt and community attitudes to the Nazi past 166 Conclusion: The position and influence of the churches 183 Maps 191 Bibliography 197 II Abstract In 1945, many parts of Germany lay in rubble and there was a Zeitgeist of exhaustion, apathy, frustration and, in places, shame. German society was disorientated and the Catholic and Protestant churches were the only surviving mass institutions that remained relatively independent from the former Nazi State. Allowed a general religious freedom by the occupying forces, the churches provided the German population with important spiritual and material support that established their vital post-war role in society. The churches enjoyed widespread popular support and, in October 1946, over 90 percent of the population in the Soviet zone (SBZ) claimed membership in either confession. -

„...Die SPD Aber Aufgehört Hat Zu Existieren" Sozialdemokraten Unter Sowjetischer Besatzung
Beatrix W. Bouvier Horst Peter Schulz (Herausgeber) „...die SPD aber aufgehört hat zu existieren" Sozialdemokraten unter sowjetischer Besatzung Verlag J.H.W. Dietz Nachf. ISBN 3-8012-0162-7 „...die SPD aber hat aufgehört zu existieren." Copyright C 1991 by Verlag J. H. W. Dietz Nachf. GmbH, Bonn In der Raste 2, D-5300 Bonn 1 Aus einer Analyse Erich W. Gniffkes zur Lage der SPD in der SBZ Umschlag: Manfred Waller, Reinbek (unter Verwendung eines Fotos vom 70. Februar 7946, in der es heißt. ,,Wie in den Gewerkschaften vom Archiv der sozialen Demokratie in der Friedrich-Ebert-Stiftung) besetzt auch in der zukünftigen Einheitspartei die KPD alle Schlüssel- Satz: Fotosatzstudio typo bonn, Bonn Druck und Verarbeitung: Fuldaer Verlagsanstalt GmbH stellungen und nichts anderes kommt bei der Vereinigung heraus, als Alle Rechte vorbehalten daß die KPD ihren Namen abgelegt und einen neuen Apparat hat, Printed in Germany 1991 die SPD aber aufgehört hat zu existieren." Inhalt Einleitung: Sozialdemokraten unter sowjetischer Besatzung ...... 9 Dokumente: Interviews mit Sozialdemokraten über die Nachkriegszeit in der Sowjetischen Besatzungszone 1. Interview mit S. F., Vorstandssekretär des ZA der SPD in Berlin .............. 51 2. Interview mit S. G., Bezirksvorsitzender der SPD in Magdeburg ............... 89 3. Interview mit D. R., SPD-Bezirkssekretär in Magdeburg .................... 107 4. Interview mit M. H., SPD-Redakteur in Magdeburg ......................... 123 5. Interview mit D. F., Vizepräsident der Bezirksverwaltung Merseburg . 147 6. Interview mit W. A., FDGB-Sekretär in Sachsen-Anhalt ...................... 171 7. Interview mit P. H., SPD-Jugendsekretär in Halle-Merseburg ................. 183 B. Interview mit T. S., Kreisvorsitzender der SPD in Leipzig .................... 203 9. -

Executive Intelligence Review, Volume 23, Number 10, March 1, 1996
(7.hope to convince you tha� in order to solve the political problem in experience) one must take the path F IDELIO Joum(lj(If Poctry,Sdem::c, �nd St1lccralt through the aesthetical) because it is through Beauty that one proceeds to Freedom.)) - Friedrich Schiller FIDELIC) FIDELIO Journal of Poetry, Science, and Statecraft Publisher of LaRouche's major theoretical writings. Sign me up for Fidelio: $20 for 4 issues NAME ________________________________________ ADDRESS ______________________________________ CITY ____--""- _________ STATE ____ ZIP _____ TEL (day),_________________ (eve) ___________ __ Make checks or money orders payable to: Schiller Institute, Inc. Dept E. P.O. Box 20244 Washington, D.C. 20041-0244 Founder and Contributing Editor: Lyndon H. LaRouche, Jr. Editorial Board: Melvin Klenetsky, Antony From theAssociate Editor Papert, Gerald Rose, Dennis Small, Edward Spannaus, Nancy Spannaus, Jeffrey Steinberg, Webster Tarpley, Carol White, Christopher White Senior Editor: Nora Hamerman T here are two images that have lingered in the minds of just about Associate Editor: Susan Welsh Managing Editors: John Sigerson, everyone who attended the inspiring Presidents' Day conference of Ronald Kokinda the Schiller Institute and the International Caucus of Labor Commit Science and Technology: Carol White tees. First is the one on our cover, Shakespeare's Hamlet: As Lyndon Special Projects: Mark Burdman Book Editor: Katherine Notley LaRouche describes in his keynote speech (see Feature), Hamlet was Advertising Director: Marsha Freeman a miserable coward, preferring to die, rather than to give up the false Circulation Manager: Stanley Ezrol beliefs that were leading him-and the State of Denmark-to certain INTELLIGENCE DIRECTORS: Agriculture: Marcia Merry destruction. -

Sjednocení Německa
Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra občanské výchovy Znovusjednocení Německa The reunification of Germany Diplomová práce Bc. et Bc. Jan Březa Brno 2013 Vedoucí bakalářské práce: Vypracoval: doc. PhDr. Marta Goňcová, CSc. Bc. et Bc. Jan Březa Čestné prohlášení „Prohlašuji, že jsem závěrečnou diplomovou práci vypracoval samostatně, s využitím pouze citovaných literárních pramenů, dalších informací a zdrojů v souladu s Disciplinárním řádem pro studenty Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.“ vlastnoruční podpis V Brně dne Poděkování: Rád bych touto cestou vyjádřil poděkování doc. PhDr. Martě Goňcové, CSc. za její cenné rady a trpělivost při vedení mé diplomové práce. Obsah Úvod ______________________________________________________________ - 1 - 1. Německo a jeho vývoj po 2. světové válce ______________________________ - 3 - 1.1. Obnova politických stran v poválečném Německu _______________________ - 6 - 1.1.1. Vznik politických stran v sovětském sektoru __________________________ - 6 - 1.1.2. Politické strany v ostatních zónách __________________________________ - 8 - 1.2. Rozdělení Německa na dva státy _____________________________________ - 9 - 2. NDR a SRN – jejich charakteristika _______________________________ - 14 - 2.1. Charakter Německé demokratické republiky za Waltra Ulbrichta __________ - 14 - 2.2. Spolková republika Německo do uznání NDR _________________________ - 21 - 2.3. Začátek sbližování – Ostpolitik _____________________________________ - 24 - 2.4. Charakter Německé demokratické republiky za Ericha Honeckera__________ - 27 - 2.5. Charakter Spolkové republiky Německo v 70. a 80. letech ________________ - 30 - 2.6. Kontrasty obou německých společností před znovusjednocením Německa ___ - 34 - 3. Sjednocení Německa ____________________________________________ - 38 - 3.1. Náhlá smrt ve 40 letech ___________________________________________ - 38 - 3.2. -

The Many Faces of Gewalt in Twentieth-Century Germany
Niels Beckenbach. Wege zur Bürgergesellschaft: Gewalt und Zivilisation in Deutschland Mitte des 20. Jahrhunderts. Berlin: Duncker & Humblot, 2005. 310 S. EUR 34.00, paper, ISBN 978-3-428-11977-6. Reviewed by Michael L. Hughes Published on H-German (June, 2007) Niels Beckenbach's volume offers eight eye‐ century Germany) seek to illuminate Gewalt in witness accounts of Germany's brutal twentieth twentieth-century Gemany. Following Hans-Ulrich century from, among others, a public intellectual, Wehler, he sees the period 1914-45 as a second a senior police officer, and a terrorist's daughter. Thirty Years' War, an extended period of violence, His criteria for choosing these particular witness‐ both international and domestic, that plagued es remain unclear, but Gewalt, with all its multi‐ Germany. He sees the foundations of that violence ple meanings and ambiguity, is the nominal con‐ partly in reactions against modernity and its rep‐ necting thread among the contributions. The orig‐ resentatives, such as Jews, intellectuals, and capi‐ inal meaning of Gewalt was power in the sense of talists. He also roots it not in an alliance of big in‐ the legitimate authority of the monarch and later dustry and the fascist Right but in "disturbances of the state. That meaning is cited, in passing to identity, a collective deficit in self-worth, as ("Alle (Staats)Gewalt geht vom Volke aus!"), in well as in latent perceptions of the Enemy" (p. 30). both Beckenbach's introduction and in the mem‐ The Nazi Ungeist resulted primarily from "'fester‐ oir by Hermann Kreutzer (SPD), whom both the ing' resentments" (p. -

Author's Response
H-Diplo Article Review: Author’s Response by Gary Bruce, JCWS 9.2 (Summer 2007) Author’s Response Ruud van Dijk and Peter E. Grieder. “Perspectives on Resistance with the People” (Forum on Gary Bruce, Resistance with the People: Repression and Resistance in Eastern Germany, 1945-1955 (2003)). Journal of Cold War Studies 9.3 (Summer 2007): 144-154. doi: 10.1162/jcws.2007.9.3.144. http://dx.doi.org/10.1162/jcws.2007.9.3.144 . Author’s Response by Gary Bruce, University of Waterloo, Canada Published by H-Diplo on 20 November 2007 t the outset, I would like to thank Peter Grieder and Ruud van Dijk for their insightful comments on my book. The fact that one’s work is worthy of review is Ain itself a compliment. Ruud van Dijk provides a comprehensive summary of my book and the central thesis. Indeed, his criticisms are less concerned with my interpretation of the uprising of June 1953 (which I deem a revolution) or my understanding of “resistance” (as opposed to other forms of oppositional behaviour such as dissent, non-participation, etc) but focus rather on further areas that might have been explored. Van Dijk suggests that the broader context of a divided Germany could have played a greater role in the book (a criticism echoed by Peter Grieder) and that greater attention to the fact of a divided Germany would have strengthened my argument. Van Dijk writes: “Bruce’s argument would have been strengthened if he had emphasized that East Germany’s rulers and their Soviet sponsors increasingly saw themselves in competition with the emerging West German state; that more and more East Germans preferred the Western alternative; and that the availability of a Western alternative profoundly influenced how East Germans viewed their emerging state.” There is no doubt that the existence of a democracy on German soil influenced the resisters in East Germany, but there are a number of factors which have to be addressed in leavening this statement. -

An Die DDR-Bürgerinnen Gehen Werde
Seite 3 — Neues Deutschland POLITIK Montag, 30. April 1990 BRD-Politiker zur Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion Bauern in Not — Demos ! ITiMSCHAU Finanzierung ist Spitzenthema Abriß der Mauer am kel 23 des BRD-Grundgeset- zes. Bonn (ADiN/ND). Die Finanzie- äußerte sich auch Bundeswirt- Subventionsabbau gewahrt wer- Brandenburger Tor rung der deutschen Einheit war schaftsminister Helmut Hauss- den sollen. Er begründete den Berlin (ADN). Mit dem Ab- Wieder VP-Kommissar am Wochenende vor der Fortset- mann (FDP). Vorschlag damit, daß seinen Be- riß der Berliner Mauer hinter Berlin (ADN). Neue Dienst- zung der offiziellen Verhandlun- Baden-Württembergs Minister- rechnungen zufolge auf der dem Brandenburger Tor wurde gradbezeichnungen gelten ab gen zwischen beiden deutschen präsident Lothar Späth (CDU) Grundlage des Entwurfs der Bun- am Wochenende begonnen. 1. Mai für die Angehörigen Staaten über einen Staatsvertrag schließt Steuerenhöhungen in der desregierung die Realeinkommen Soldaten trugen mit schwerer der Deutschen Volkspolizei, für die Währung»-, Wirtschafts- BRD zur Anschübfinanzierung in in der DDR um ein Viertel sin- Technik, unterstützt von einer der Feuerwehr und des Straf- und Sozialunion am Montag in der DDR inzwischen nicht mehr ken würde». DreOler sprach sich Westberliner Firma, die Grenz- vollzuges. Aus dem Haupt- Bonn welter Spitzanthema in aus. z. B. dafür aus, die Mindestrente befestigung ab. Bis zum 19. Mai mann der Volkspolizei wird Äußerungen bundesdeutscher Po- in der DDR beizubehalten und soll der gesamte Mauerab- beispielsweise.. ein Volkspoli- litiker. Spätestens am Donnerstag Der SPD-Sozialexper-te Rudolf diese Kategorie auch in der Bun- schnitt zwischen Reichstags- zei-Hauptkommissar, aus dem soll die DDR-©evölkerung über Dreßler forderte Bonn auf, der desrepublik einzuführen. -

NEWSLETTER No.17 November, 17Th 2000
NEWSLETTER No.17 November, 17th 2000 Marlene Dietrich Collection Berlin is a division of Filmmuseum Berlin - Deutsche Kinemathek If you want your fellow fans to receive this newsletter or if you just want to add informations write to [email protected]. If you want to support the work of the Filmmuseum Berlin-Deutsche Kinemathek of which Marlene Dietrich Collection Berlin is a division you can do so by joining the "Friends and Supporters of Filmmuseum Berlin". Just go to http://www.fffb.de The anniversary of the first showing of The discussed photo of Linda Darnell with "Morocco" has been on November 14th 1930. Marlene can now be seen in good quality Be prepared to read some french phrases in at www.marlene.com Section "News and the forthcoming Newsletter Special as we will Views". From the reactions we have gotten publish for the first time ever the letters the real there seems to be no doubt about it – it is Amy Jolly from Agadir (Morocco) wrote to Linda Darnell. Thanks to all of you who took Marlene. If you ever wondered what became of part in answering. Our question even started a Amy Jolly after she walked away through that discussion in a newsgroup for which film Linda famous gate - our “Morocco”- Special will tell Darnell was remembered best. you. This poster should make you hot for the 70s anniversary of "Morocco". The still from "Die freudlose Gasse" can not be enlarged, but if you go to http://www.marlene.com/news- views/mystery02.jpg you get a good quality still of Asta Nielsen, Hertha von Walther and Werner Krauss which should put an end to any discussion about Marlene playing the part of Else.