(Diptera: Syrphidae) in Vorarlberg
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

14 Beste Betriebe BS 2020 / 342.55 Kb
MANAGEMENT BROWN SWISS Die besten Betriebsleistungen (gereiht nach F + E - kg) Besitzer Kuhzahl Alter Milch Fett Trockentage KG % KG % KG KG % Betriebe 2,0 bis 5,9 Kühe Gasser Silvia u. Karl, Hohenems 3,5 8,4 10.335 4,36 450,4 3,58 369,6 820,0 13,9 Frick Karlheinz, Sulz 2,0 8,3 11.145 3,86 430,3 3,48 388,4 818,7 8,7 Kuster Klaus, Fußach 4,7 4,8 9.995 4,24 423,3 3,70 370,0 793,2 17,6 Hammerer Martin, Egg 2,5 4,9 10.016 4,25 426,1 3,64 364,4 790,5 4,6 Netzer Martin, Bludenz 3,4 4,8 9.811 4,31 422,7 3,56 348,8 771,5 8,8 Rusch Edith u. Christoph, Gisingen 4,4 4,4 10.006 4,00 399,9 3,69 369,1 769,0 7,3 Bilgeri Karin und Christian, Hitttisau 2,0 4,4 10.501 3,62 379,6 3,70 388,3 767,9 4,0 Loretz Marina und Gerhard, Sankt Gallenkirch 5,7 8,8 9.282 4,35 403,7 3,69 342,6 746,2 13,1 Berkmann Mario, Hittisau 2,8 4,5 8.807 4,45 392,3 3,82 336,7 729,0 7,2 Marlin Peter, St. Gallenkirch 3,8 6,1 9.304 4,02 374,2 3,75 348,7 722,9 6,0 Burtscher Franz, Bludenz-Braz 2,2 7,4 8.600 4,51 387,8 3,82 328,6 716,4 4,1 Vonbrül Magnus, Röns 2,9 5,5 8.762 4,43 388,1 3,71 325,2 713,3 13,1 Matt Martin u. -
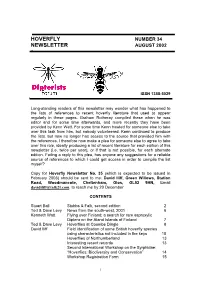
Hoverfly Newsletter 34
HOVERFLY NUMBER 34 NEWSLETTER AUGUST 2002 ISSN 1358-5029 Long-standing readers of this newsletter may wonder what has happened to the lists of references to recent hoverfly literature that used to appear regularly in these pages. Graham Rotheray compiled these when he was editor and for some time afterwards, and more recently they have been provided by Kenn Watt. For some time Kenn trawled for someone else to take over this task from him, but nobody volunteered. Kenn continued to produce the lists, but now no longer has access to the source that provided him with the references. I therefore now make a plea for someone else to agree to take over this role, ideally producing a list of recent literature for each edition of this newsletter (i.e. twice per year), or if that is not possible, for each alternate edition. Failing a reply to this plea, has anyone any suggestions for a reliable source of references to which I could get access in order to compile the list myself? Copy for Hoverfly Newsletter No. 35 (which is expected to be issued in February 2003) should be sent to me: David Iliff, Green Willows, Station Road, Woodmancote, Cheltenham, Glos, GL52 9HN, Email [email protected], to reach me by 20 December. CONTENTS Stuart Ball Stubbs & Falk, second edition 2 Ted & Dave Levy News from the south-west, 2001 6 Kenneth Watt Flying over Finland: a search for rare saproxylic Diptera on the Aland Islands of Finland 7 Ted & Dave Levy Hoverflies at Coombe Dingle 8 David Iliff Field identification of some British hoverfly species using characteristics not included in the keys 10 Hoverflies of Northumberland 13 Interesting recent records 13 Second International Workshop on the Syrphidae: “Hoverflies: Biodiversity and Conservation” 14 Workshop Registration Form 15 1 STUBBS & FALK, SECOND EDITION Stuart G. -

Diptera, Syrphidae) on the Balkan Peninsula
Dipteron Band 2 (6) S.113-132 ISSN 1436-5596 Kiel,15.9.1999 New data for the tribes Milesiini and Xylotini (Diptera, Syrphidae) on the Balkan Peninsula [Neue Daten fur die Triben Milesiini und Xylotini (Diptera, Syrphidae) van der Balkanhalbinsel] Ante VUJIC (Novi Sad) & Vesna MILANKOV (Novi Sad) Abstract: Distributional data are presented for four species of the tribe Milesiini (genus Criorhina MEIGEN, 1822) and 13 species of four genera of the tribe Xylotini (Brachypalpoides HIPPA, 1978, Brachypalpus MACQUART, 1834, Chalcosyrphus CURRAN, 1925, Xylota MErGEN, 1822) occuring on the Balkan Peninsula. The species Criorhina ranunculi (PANZER, [1804]) is recorded on the Balkan Peninsula for the fIrst time. A speci• men of Chalcosyrphus valgus (GMELIN, 1790) from Dubasnica mountain (Serbia) presents the fust verifIed record of the species on the Balkan Peninsula. Previously published reports of Xylota coeruleiventris ZETTERSTEDT,1838 on the Peninsula actually belong to X. jakuto• rum BAGACHANOVA,1980. Brachypalpus laphriformis (FALLEN, 1816), B. valgus (PANZER, [1798]), Criorhina asilica (FALLEN, 1816), Xylota jakutorum and X. jlorum (FABRICIUS, 1805) have been collected for the fust time in Montenegro. The record of Brachypalpus val· gus from Verno mountain is the first for Greece. A key to genera and species of the tribe Xylotini on the Balkan Peninsula and illustrations of characteristic morphological features are presented. Key words: Syrphidae, Brachypalpoides, Brachypalpus, Chalcosyrphus, Criorhina, Xylota, Balkan Peninsula Zusammenfassung: Verbreitungsangaben fur vier Arten der Tribus Milesiini (Gattung Criorhina MEIGEN,1822) und 13 Arten aus vier Gattung der Tribus Xylotini (Brachypalpoides HrpPA, 1978, Brachypalpus MACQUART,1834, Chalcosyrphus CURRAN,1925, Xylota MElGEN,1822), die auf der Bal• kanhalbinsel vertreten sind, werden vorgestellt. -
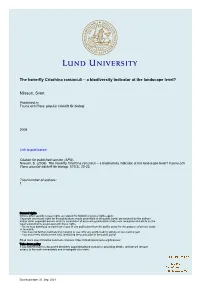
The Hoverfly Criorhina Ranunculi – a Biodiversity Indicator at the Landscape Level?
The hoverfly Criorhina ranunculi – a biodiversity indicator at the landscape level? Nilsson, Sven Published in: Fauna och Flora: populär tidskrift för biologi 2006 Link to publication Citation for published version (APA): Nilsson, S. (2006). The hoverfly Criorhina ranunculi – a biodiversity indicator at the landscape level? Fauna och Flora: populär tidskrift för biologi, 101(3), 20-23. Total number of authors: 1 General rights Unless other specific re-use rights are stated the following general rights apply: Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research. • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal Read more about Creative commons licenses: https://creativecommons.org/licenses/ Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. LUND UNIVERSITY PO Box 117 221 00 Lund +46 46-222 00 00 Download date: 30. Sep. 2021 Stor pälsblomfluga – en mångfaldsindikator på landskapsnivå? Stor pälsblomfluga är en vacker, humlelik blomfluga. Den är rödlistad i Sverige men har under de senaste åren påträffats i flera nya områden. Även om stor pälsblomfluga är förbisedd råder ingen tvekan om att de områden där arten påträffas ofta har särskilda kvaliteter som är viktiga att uppmärksamma och bevara på landskapsnivå. -

Hoverfly Newsletter No
Dipterists Forum Hoverfly Newsletter Number 48 Spring 2010 ISSN 1358-5029 I am grateful to everyone who submitted articles and photographs for this issue in a timely manner. The closing date more or less coincided with the publication of the second volume of the new Swedish hoverfly book. Nigel Jones, who had already submitted his review of volume 1, rapidly provided a further one for the second volume. In order to avoid delay I have kept the reviews separate rather than attempting to merge them. Articles and illustrations (including colour images) for the next newsletter are always welcome. Copy for Hoverfly Newsletter No. 49 (which is expected to be issued with the Autumn 2010 Dipterists Forum Bulletin) should be sent to me: David Iliff Green Willows, Station Road, Woodmancote, Cheltenham, Glos, GL52 9HN, (telephone 01242 674398), email:[email protected], to reach me by 20 May 2010. Please note the earlier than usual date which has been changed to fit in with the new bulletin closing dates. although we have not been able to attain the levels Hoverfly Recording Scheme reached in the 1980s. update December 2009 There have been a few notable changes as some of the old Stuart Ball guard such as Eileen Thorpe and Austin Brackenbury 255 Eastfield Road, Peterborough, PE1 4BH, [email protected] have reduced their activity and a number of newcomers Roger Morris have arrived. For example, there is now much more active 7 Vine Street, Stamford, Lincolnshire, PE9 1QE, recording in Shropshire (Nigel Jones), Northamptonshire [email protected] (John Showers), Worcestershire (Harry Green et al.) and This has been quite a remarkable year for a variety of Bedfordshire (John O’Sullivan). -

Of Serbia and Montenegro
Acta entomologica serbica, 2015, 20: 67-98 UDC 595.773.1(497.11)"2009" 595.773.1(497.16)"2009" DOI: 10.5281/zenodo.45394 NEW DATA ON THE HOVERFLIES (DIPTERA: SYRPHIDAE) OF SERBIA AND MONTENEGRO JEROEN VAN STEENIS1, WOUTER VAN STEENIS2, AXEL SSYMANK3, MENNO P. VAN ZUIJEN4, ZORICA NEDELJKOVIĆ5, ANTE VUJIĆ6 and SNEŽANA RADENKOVIĆ6 1 Research Associate Naturalis Biodiversity Center, Hof der Toekomst 48, 3823HX Amersfoort, The Netherlands E-mail: [email protected] 2 Research Associate Naturalis Biodiversity Center, Vogelmelk 4, 3621TP Breukelen, The Netherlands 3 Falkenweg 6, 53343 Wachtberg, Germany 4 Kolkakkerweg 21-2, 6706 GK Wageningen, The Netherlands 5 University of Novi Sad, BioSence Institute - Research Institute for Information Technologies in Biosystems, Trg Dr Zorana Đinđića 1, 21000 Novi Sad, Serbia 6 University of Novi Sad, Faculty of Science, Department of Biology and Ecology, Trg Dositeja Obradovića 2, 21000 Novi Sad, Serbia Abstract The results of a survey of hoverflies (Syrphidae) collected by the members of the pre-conference trip of the 5th International Symposium on Syrphidae are presented. Fieldwork took place from 8-22 June 2009 and involved 18 localities (12 in Serbia and 6 in Montenegro). The sites visited are described and short notes are given on some rare species. During the 15 days of fieldwork, about 5600 specimens were collected, representing 59 genera and 249 species. Seven species are recorded for the first time for Serbia: Epistrophe obscuripes, Merodon equestris, Merodon haemorrhoidalis, Microdon miki, Platycheirus angustipes, Rhingia borealis and Sphegina verecunda; and 19 species are recorded for the first time for Montenegro: Cheilosia crassiseta, Cheilosia lasiopa, Cheilosia pubera, Cheilosia rufimana, Cheilosia subpictipennis, Eumerus clavatus, Eumerus sogdianus, Lejogaster tarsata, Merodon haemorrhoidalis, Merodon serrulatus, Myolepta dubia, Neoascia interrupta, Neoascia tenur, Platycheirus aurolateralis, Platycheirus occultus, Platycheirus tatricus, Sericomyia silentis, Sphaerophoria laurae and Trichopsomyia flavitarsis. -

24 Beste MW Kühe HF / 492.83 Kb
GENETIK Holstein Lebende Holsteinkühe in Vorarlberg mit dem höchsten Milchzuchtwert - Stand 27.01.2021 (gereiht nach MW, GZW / nur HB-A) Lebens-Nr. Name Besitzer DL / EL MW GZW Vater Mutter-Vater AT 017.567.729 LINDSAY Spiegel Michael, Dornbirn 3/3 15780-3,46-3,28-1064 136 121 SMURF LEAD READY DE 01 22451282 ALEXIS Sano Vorarlberg e.U., Hittisau 2/1 12139-4,09-3,63-937 133 139 ARAXIS RUBICON DE 05 38910911 CANDYGIRL Nöckl Brigitte und Otto, Doren 3/2 11702-4,45-3,66-949 133 121 POWERBALL P HEADLINER DE 06 67027829 HERA Tschugmell Florian, Bürs 1/1 12717-3,03-3,13-784 129 120 SNOW RC ALMANDO DE 08 17174984 MELODY Marte Alwin, Koblach EL.35,2-3,91-3,19 127 130 GALORE FITZ AT 143.210.128 GLORIA Feurle Markus, Hägele Daniela , Krumbach 2/2 12309-4,12-3,40-926 127 115 BOOMAN ALEXANDER AT 033.336.868 RITA Gstöhl Christof und Alexander, Dornbirn 1/1 11201-3,57-3,21-760 127 BALIC APPLEJAX RC AT 315.258.638 ROSMARIE Moosbrugger Daniela und Simon , Krumbach 2/1 10150-4,80-3,24-816 126 118 LACOSTE RED SNOW RC AT 020.733.538 Meyer Martin, Nenzing EL.40,4-3,51-3,30 126 LENDARY SNOW RC DE 03 59111951 LUPITA Sano Vorarlberg e.U., Hittisau 2/1 14419-3,03-3,48-939 125 126 CITIZEN BALISTO DE 05 39802325 TIARA Fink Birgit und Georg , Lauterach 2/1 9899-3,31-3,28-652 125 125 BARNY RC NUGGET RDC AT 033.445.168 HILDA Spiegel Michael, Dornbirn 2/1 10492-4,35-3,52-825 125 122 KYRIAN BRAWLER AT 952.585.522 RIVANA Bilgeri Daniel, Hittisau 2/2 10600-3,64-3,08-713 125 118 FIREMAN RED ALTIMA DE 06 67220722 ANNA Tschugmell Florian, Bürs 1/1 10678-4,34-3,22-806 125 -

Gemeindefinanzstatistik 2016 Gemeindefinanzstatistik 2016
2018 Gemeindefinanzstatistik 2016 Gemeindefinanzstatistik 2016 Amt der Vorarlberger Landesregierung Landesstelle für Statistik Herausgeber und Hersteller Amt der Vorarlberger Landesregierung Landesstelle für Statistik Römerstraße 15 A-6901 Bregenz Internet: www.vorarlberg.at E-Mail: [email protected] Telefon: +43(0)5574/511-20155 bzw. 20157 Telefax: +43(0)5574/511-920197 Redaktion DI Egon Rücker Inhalt Ing. Dieter Amann Telefon: +43(0)5574/511-20159 E-Mail: [email protected] Bregenz, Februar 2018 Inhaltsverzeichnis Seite 1 Textteil 5 1.1 Allgemeines 5 1.2 Ergebnisse 5 1.3 Erläuterungen 14 2 Haushaltsgebarung 17 2.1 Übersicht über die Haushaltsgebarung 17 2.2 Einnahmen und Ausgaben der Haushaltsgebarung 2016 der Vorarlberger Gemeinden 20 2.3 Haushaltsgebarung 2016 nach Gemeinden und Haushaltsgruppen 24 2.4 Einnahmen und Ausgaben der Haushaltsgebarung 2016 nach Regionen 44 2.5 Haushaltsgebarung 2016 nach Regionen und Haushaltsgruppen 45 2.6 Einnahmen und Ausgaben der Haushaltsgebarung 2016 der Städte, Marktgemeinden und übrigen Gemeinden nach Haushaltsgruppen 50 2.7 Einnahmen und Ausgaben der Haushaltsgebarung 2016 nach Haushaltsgruppen und Gemeindegrößenklassen aufgrund der Wohnbevölkerung zum 31.10.2014 52 3 Einnahmen 56 3.1 Entwicklung der Einnahmen aus Abgaben und Steuern sowie steuerähnlichen Einnahmen in EURO (rückgerechnet) von 1968 bis 2007 56 3.2 Einnahmen aus Abgaben und Steuern sowie steuerähnliche Einnahmen im Jahr 2016 60 3.3 Schlüsselmäßige Bedarfszuweisungen und sonstige Finanzzuweisungen und Zuschüsse im Jahr -

Veranstalterliste RADIUS 2021 Stand: 23.03.2021
Veranstalterliste RADIUS 2021 Stand: 23.03.2021 ARBEITGEBER Veranstalter Unterveranstalter 1zu1 Prototypen GmbH & Co KG AAT Abwasser‐ und Abfalltechnik GmbH AK Vorarlberg ALPLA Hard Amann Girrbach AQUA Mühle Vorarlberg gGmbH Bachmann electronic GmbH BAUR GmbH BayWa Vorarlberg HandelsGmbH Besch und Partner BIFO Bischofberger Transporte GmbH Blum Buchdruckerei Lustenau Büro für Berufsintegrationsprojekte Öhe GmbH Café Bar Restaurant Dorfmitte Caritas Vorarlberg CARUSO Carsharing eGen Collini GmbH Doppelmayr Gruppe Dorf‐Installationstechnik GmbH Dornbirner Sparkasse Bank AG EGD Installations GmbH Energieinstitut Vorarlberg Erath&Partner Etiketten CARINI faigle Kunststoffe GmbH Finanzamt Österreich Dienststelle Vorarlberg Fusonic GmbH Gebrüder Weiss ‐ Vorarlberg Grass GmbH Haberkorn Haberkorn ‐ Suisse | Haberkorn ‐ Wolfurt Hermann Pfanner Getränke Lauterach Hexagon Geosystems Services AT Hilti AG Thüringen Hirschmann Automotive GmbH HOFER KG ‐ ZNL Rietz (V) Hydro Extrusion Nenzing GmbH Hypo Vorarlberg Bank AG IDENTEC SOLUTIONS AG illwerke vkw INNONAV IT‐Dienstleistungen GmbH Ivoclar Vivadent Manufacturing GmbH Kalb Analytik AG Künz GmbH Landesfeuerwehrverband Vorarlberg Lebenshilfe Vorarlberg Liebherr Werk Nenzing Seite 1 von 6 LKH Bludenz LKH Bregenz LKH Feldkirch LKH Hohenems Logwin ‐ Vorarlberg Marktgemeinde Nenzing meusburger Formaufbauten Mitarbeitende d. Gem. Hohenweiler Mitarbeitende d. Gemeinde Lochau Mitarbeitende d. Gemeinde Mäder Mitarbeitende d. Gemeinde Schwarzach Mitarbeitende d. Marktgem. Götzis Mitarbeitende d. Marktgem. Hard -

Country Open Air Des Sportclub Meiningen. 24. Und 25. August 2019, Sportplatz
B C M Y X Z slurZ slurB B C M Y X Z 0 B 20 B 40 B 80 B C M Y X Z CMY CMY CMY CMY B C M Y X Z C 20 C 40 C 80 B C M Y X Z slurC slurM B C M Y X Z 0BC M Y X Z B C M Y X Z CMY M 20 M 40 M 80 B C M Y X Z slurY slurX B C M Y X Z 0 Y 20 Y 40 Y 80 B C M Y X Z CMY CMY CMY CMY B C M Y X Z CMY X 20 X 40 X 80 B C M Y X Z CM CY MY CMY B C M Y X Z 0 Z 20 Z 40 Z 80 B C M Y X Z CMY CMY CMY CMY Prinect Micro−6i Format 102/105 Dipco 11.0i (pdf) © 2011 Heidelberger Druckmaschinen AG CM CY MY CMY B C M Y X Z 0 B 20 B 40 B 80 B C M Y X Z CMY CMY CMY CMY B C M Y X Z CMY C 20 C 40 C 80 B C M Y X Z slurZ slurB B C M Y X Z 0BC M Y X Z B C M Y X Z CMY M 20 M 40 M 80 B C M Y X Z slurC slurM B C M Y X Z 0 Y 20 Y 40 Y 80 B C M Y X Z CMY CMY CMY CMY B C M Y X Z X 20 X 40 X 80 B C M Y X Z slurY slurX B C M Y X Z 0 Z 20 Z 40 Z 80 B C M Y X Z CMY CMY CMY CMY B C M Y X Z C M C M C M C M C M C M Nr 34_2019.qxp_GB Umschlag 20.08.19 11:50 Seite 4 Nr 34_2019.qxp_GB Umschlag 20.08.19 11:50 Seite 1 Y X Y Z Y X Y Z Y X Y Z −−−−−−−−−−−−−−− 1 −−−−−−−−−−−−−−− 2 −−−−−−−−−−−−−−− 3 −−−−−−−−−−−−−−− 4 −−−−−−−−−−−−−−− 5 −−−−−−−−−−−−−−− 6 −−−−−−−−−−−−−−− 7 −−−−−−−−−−−−−−− 8 −−−−−−−−−−−−−−− 9 −−−−−−−−−−−−−−− 10 −−−−−−−−−−−−−− B = B −−−−−−−−−−−−−− 12 −−−−−−−−−−−−−− C = C −−−−−−−−−−−−−− 14 −−−−−−−−−−−−− M = M −−−−−−−−−−−−− 16 −−−−−−−−−−−−−− Y = Y −−−−−−−−−−−−−− 18 −−−−−−−−−−−−−− X = X −−−−−−−−−−−−−− 20 −−−−−−−−−−−−−− Z = Z −−−−−−−−−−−−−− 22 −−−−−−−−−−−−−−− 23 −−−−−−−−−−−−−−− 24 −−−−−−−−−−−−−−− 25 −−−−−−−−−−−−−−− 26 −−−−−−−−−−−−−−− 27 −−−−−−−−−−−−−−− 28 −−−−−−−−−−−−−−− 29 −−−−−−−−−−−−−−− 30 −−−−−−−−−−−−−−− 31 −−−−−−−−−−−−−−− 32 Fraxern Klaus Laterns Meiningen t Rankweil Röthis t Sulz Übersaxen Viktorsberg a Amts- und Anzeigenblatt Nr. -

Hoverflies Family: Syrphidae
Birmingham & Black Country SPECIES ATLAS SERIES Hoverflies Family: Syrphidae Andy Slater Produced by EcoRecord Introduction Hoverflies are members of the Syrphidae family in the very large insect order Diptera ('true flies'). There are around 283 species of hoverfly found in the British Isles, and 176 of these have been recorded in Birmingham and the Black Country. This atlas contains tetrad maps of all of the species recorded in our area based on records held on the EcoRecord database. The records cover the period up to the end of 2019. Myathropa florea Cover image: Chrysotoxum festivum All illustrations and photos by Andy Slater All maps contain Contains Ordnance Survey data © Crown Copyright and database right 2020 Hoverflies Hoverflies are amongst the most colourful and charismatic insects that you might spot in your garden. They truly can be considered the gardener’s fiend as not only are they important pollinators but the larva of many species also help to control aphids! Great places to spot hoverflies are in flowery meadows on flowers such as knapweed, buttercup, hogweed or yarrow or in gardens on plants such as Canadian goldenrod, hebe or buddleia. Quite a few species are instantly recognisable while the appearance of some other species might make you doubt that it is even a hoverfly… Mimicry Many hoverfly species are excellent mimics of bees and wasps, imitating not only their colouring, but also often their shape and behaviour. Sometimes they do this to fool the bees and wasps so they can enter their nests to lay their eggs. Most species however are probably trying to fool potential predators into thinking that they are a hazardous species with a sting or foul taste, even though they are in fact harmless and perfectly edible. -

Hoverfly (Diptera: Syrphidae) Richness and Abundance Vary with Forest Stand Heterogeneity: Preliminary Evidence from a Montane Beech Fir Forest
Eur. J. Entomol. 112(4): 755–769, 2015 doi: 10.14411/eje.2015.083 ISSN 1210-5759 (print), 1802-8829 (online) Hoverfly (Diptera: Syrphidae) richness and abundance vary with forest stand heterogeneity: Preliminary evidence from a montane beech fir forest LAURENT LARRIEU 1, 2, ALAIN CABANETTES 1 and JEAN-PIERRE SARTHOU 3, 4 1 INRA, UMR1201 DYNAFOR, Chemin de Borde Rouge, Auzeville Tolosane, CS 52627, F-31326 Castanet Tolosan Cedex, France; e-mails: [email protected]; [email protected] ² CNPF/ IDF, Antenne de Toulouse, 7 chemin de la Lacade, F-31320 Auzeville Tolosane, France 3 INRA, UMR 1248 AGIR, Chemin de Borde Rouge, Auzeville Tolosane, CS 52627, F-31326 Castanet Tolosan Cedex, France; e-mail: [email protected] 4 University of Toulouse, INP-ENSAT, Avenue de l’Agrobiopôle, F-31326 Castanet Tolosan, France Key words. Diptera, Syrphidae, Abies alba, deadwood, Fagus silvatica, functional diversity, tree-microhabitats, stand heterogeneity Abstract. Hoverflies (Diptera: Syrphidae) provide crucial ecological services and are increasingly used as bioindicators in environ- mental assessment studies. Information is available for a wide range of life history traits at the species level for most Syrphidae but little is recorded about the environmental requirements of forest hoverflies at the stand scale. The aim of this study was to explore whether the structural heterogeneity of a stand influences species richness or abundance of hoverflies in a montane beech-fir forest. We used the catches of Malaise traps set in 2004 and 2007 in three stands in the French Pyrenees, selected to represent a wide range of structural heterogeneity in terms of their vertical structure, tree diversity, deadwood and tree-microhabitats.