Schulentwicklungsplan 2014-2019
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Aarbergen * Bad Schwalbach Oestrich-Winkel * Rüdesheim Heidenrod
Aarbergen * Bad Schwalbach Eltville * Geisenheim Heidenrod * Hohenstein Hünstetten * Idstein * Kiedrich Lorch * Niedernhausen Oestrich-Winkel * Rüdesheim Schlangenbad * Taunusstein Waldems * Walluf * Wiesbaden Lesefest Rheingau-Taunus Liebe Besucher des Lesefestes, Wir freuen uns auf die Autorin Kirsten Boie, auf Ritter Trenk und einen schönen mittelalterlichen Tag im Kloster Eber- Lesefestfreunde und Leseratten, bach für Kinder und Ihre Eltern, Freunde, Geschwister und liebe Kinder, Jugendliche, Großeltern. Eltern und Lehrer, Das Lesefest 2017 findet von September 2017 bis Januar 2018 wieder allerorten im Rheingau-Taunus-Kreis statt. Un- Astrid Lindgren hat einmal ihre Kindheit zählige Autorenbegegnungen, Lesungen, Vorlesestunden und ihre erste Berührung mit einem und Fortbildungen werden Kinder und Leseratten jeden Al- Buch beschrieben: ters wieder in ihren Bann ziehen. „Ja, das grenzenloseste aller Abenteuer In Schulen und Kindertagesstätten, in Bibliotheken, Mehr- der Kindheit, das war das Leseabenteuer.“ generationenhäusern und Familienzentren, in der Back- stube, im Brentanohaus und im Kloster Eberbach und an In diesem Augenblick sei bei ihr der Lesehunger erwacht. Ein besonderen und historischen Orten im Rheingau und im Phänomen, das ich seit 15 Jahren im Rheingau-Taunus-Kreis Taunus begegnen wir Kinder- und Jugendbuchhelden, au- verspüren kann. Damals hing eine riesige Lesefestfahne am ßergewöhnlichen und spannenden Geschichten, germani- Eltviller Burgturm und wies auf das eintägige Lesefest der schen Göttern und „Suseldruseln“. -

Espenschied, Lorch, Lorchhausen, Ransel, Ranselberg, Wollmerschied
Integriertes kommunales Entwicklungskonzept der Stadt Lorch Espenschied, Lorch, Lorchhausen, Ransel, Ranselberg, Wollmerschied Gemeinsam erleben und gestalten in Lorch 2013 Im Auftrag der Stadt Lorch, Rheingau-Taunus-Kreis Integriertes kommunales Entwicklungskonzept der Stadt Lorch (IKEK) Bearbeitung: pro regio AG Kaiserstr. 47 60329 Frankfurt Tel.: 069 981 969 70 Fax: 069 981 969 72 [email protected] www.proregio-ag.de Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis A IKEK Lorch – Zielsetzung und Vorgehen 1 Einführung ........................................................................................................................................ 1 2 Vorgehen und Beteiligung ............................................................................................................... 1 B Die Stadt Lorch und ihre Stadtteile 3 Bestandsanalyse.............................................................................................................................. 6 3.1 Kurzcharakteristik ..................................................................................................................... 6 3.2 Bevölkerungsentwicklung und Prognose ................................................................................. 7 3.3 Städtebauliche Siedlungsentwicklung und Leerstand ........................................................... 13 3.4 Kommunale und soziale Infrastruktur .................................................................................... 16 3.5 Bildungsangebot ................................................................................................................... -

Historischer Tag: HESSENKASSE Holt Hessens Kommunen Aus Dem
Nr. 214-17 Wiesbaden, 17. Dezember 2018 Historischer Tag: HESSENKASSE holt Hessens Kommunen aus dem Dispo. Rheingau-Taunus-Kreis und seine Kommunen werden um 420 Mio. Euro entschuldet HESSENKASSE löst heute die letzten kommunalen Kassenkredite ab: „Der 17. Dezember 2018 dürfte in die Geschichte Hessens, vor allem aber in die Geschichte vieler unserer Kommunen, eingehen: Ab heute sind Hessens Kommunen ihre Kassenkredite los. Rund 4,9 Milliarden Euro kommunaler Kassenkredite sind heute endgültig auf die HESSENKASSE übergegangen. Kassenkredite sind der Dispo der Girokonten der Kommunen. Die HESSENKASSE hat nun Hessens Kommunen aus dem Dispo geholt“, sagte Hessens Finanzminister Dr. Thomas Schäfer heute in Wiesbaden. „179 Kommunen hatten noch bis vor kurzem Kassenkredite in Höhe von 4,9 Milliarden Euro. Ab heute sind sie alle auf 0 gestellt. Das hat es so nicht nur in Hessen noch nicht gegeben, sondern das ist bundesweit einmalig.“ 179 Kommunen in Hessen nehmen am Entschuldungsprogram der HESSENKASSE teil. An zwei Ablösetagen wurden ihre Schulden nun schrittweise von der HESSENKASSE übernommen. 3,6 Milliarden Euro wurden bereits im September aus den kommunalen Büchern genommen. Heute folgten weitere 1,3 Milliarden Euro. Rheingau-Taunus-Kreis und viele seiner Kommunen profitieren „Auch der Rheingau-Taunus-Kreis ist einer der Gewinner der HESSENKASSE. Der Kreis, Aarbergen, Bad Schwalbach, Eltville, Geisenheim, Heidenrod, Hohenstein, Hünstetten, Idstein, Niedernhausen, Oestrich-Winkel, Rüdesheim, Taunusstein und Waldems werden zusammen um über 420 Millionen Euro entschuldet. Das sind gewaltige Summen, die teils über Jahrzehnte angehäuft wurden. Nun drücken wir in einer gemeinsamen Pressesprecher: Ralph-Nicolas Pietzonka E-Mail: [email protected] 65185 Wiesbaden, Friedrich-Ebert-Allee 8 Pressemitteilungen im Internet: www.finanzen.hessen.de Telefon: (0611) 32- 2457 Folgen Sie uns bei Twitter: @finanzenhessen Telefax: (0611) 32- 2433 2 Anstrengung zusammen mit den Kommunen die Reset-Taste und ermöglichen ihnen den Neustart“, sagte Schäfer. -

Verzeichnis Der Ausbildungsbetriebe
Industrie- und Handelskammer Wiesbaden Anlagenmechaniker/-in ESWE Versorgungs AG Konradinerallee 25 65189 Wiesbaden InfraServ GmbH & Co. Wiesbaden KG Rheingaustr. 190- 196 65203 Wiesbaden InfraServ Wiesbaden Technik GmbH & Co. KG Rheingaustr. 190- 196 65203 Wiesbaden Automobilkaufmann/Automobilkauffrau Auktion & Markt AG Sandbornstr. 2 65197 Wiesbaden Auto Georg GmbH Ostring 11 65205 Wiesbaden Auto Zeh GmbH Wallufer Str. 12 65343 Eltville am Rhein Autohaus Basting & Euler GmbH Chauvignystr. 26 65366 Geisenheim Autohaus Bertram GmbH Am Klingenweg 8 65396 Walluf Autohaus Bilia GmbH & Co KG Black u. Decker-Str. 1- 3 65510 Idstein Autohaus Eren & Burggraf GmbH & Co.KG Walramstr. 33 65510 Idstein Autohaus Haese GmbH Schönbergstr. 15 65199 Wiesbaden Autohaus Langmann GmbH Peter-Sander-Str. 14a 55252 Mainz-Kastel Autohaus Ludwig GmbH Black u. Decker-Str. 28 65510 Idstein Autohaus Marnet GmbH & Co KG Rheingaustr. 90 65203 Wiesbaden Autohaus Schneider GmbH & Co. KG Rudolfstr. 5 65510 Idstein AUTOSCHMITT IDSTEIN GmbH Black u. Decker-Str. 5-7 65510 Idstein AUTOSCHMITT IDSTEIN GmbH Am Wörtzgarten 20 65510 Idstein Bildungswerk der Hessischen Wirtschaft e. V. Rheingaustr. 85b 65203 Wiesbaden Delta Automobile GmbH & Co. KG Peter-Sander-Str. 45 55252 Mainz-Kastel Diamant Autowelt GmbH Willi-Juppe-Str. 1- 3 65199 Wiesbaden Enders Automobile + Service GmbH & Co. KG Karl-Bosch-Str. 9 65203 Wiesbaden FCA MOTOR VILLAGE GERMANY GmbH Fritz-Haber-Str. 3 65203 Wiesbaden Hüsnü Ibrahim Tekeli -Kfz-Handel- An der Ankermühle 3a 65399 Kiedrich Löhr Auto SZ GmbH Mainzer Str. 130 65189 Wiesbaden S + R GmbH & Co. KG Im Rad 36- 38 65197 Wiesbaden Scherer + Rossel GmbH & Co. KG Mainzer Str. 105- 115 65189 Wiesbaden Taunus-Auto-Verkaufs-GmbH Mainzer Str. -

The-Gutenberg-Museum-Mainz.Pdf
The Gutenberg Museum Mainz --------------------------------------------------------------------- Two original A Guide Gutenberg Bibles and many to the other documents from the dawn of the age of printing Museum ofType and The most beautiful Printing examples from a collection of 3,000 early prints Printing presses and machines in wood and iron Printing for adults and children at the Print Shop, the museum's educational unit Wonderful examples of script from many countries of the world Modern book art and artists' books Covers and illustrations from five centuries Contents The Gutenberg Museum 3 Johannes Gutenberg- the Inventor 5 Early Printing 15 From the Renaissance to the Rococo 19 19th Century 25 20th Century 33 The Art and Craftmanship of the Book Cover 40 Magic Material Paper 44 Books for Children and Young Adults 46 Posters, Job Printing and Ex-Libris 48 Graphics Techniques 51 Script and Printing in Eastern Asia 52 The Development of Notation in Europe and the Middle East 55 History and Objective of the Small Press Archives in Mainz 62 The Gutenberg Museum Print Shop 63 The Gutenberg Society 66 The Gutenberg-Sponsorship Association and Gutenberg-Shop 68 Adresses and Phone Numbers 71 lmpressum The Gutenberg Museum ~) 2001 The Cutcnlx~rg Museum Mainz and the Cutcnbc1g Opposite the cathedral in the heart of the old part ofMainz Spons01ship Association in Germany lies the Gutenberg Museum. It is one of the oldest museums of printing in the world and This guide is published with tbc kind permission of the attracts experts and tourists from all corners of the globe. Philipp von Zahc1n publisher's in Mainz, In r9oo, soo years after Gutenberg's birth, a group of citi with regard to excLrpts of text ;md illustrations zens founded the museum in Mainz. -

Tierschutzverein Wiesbaden U.U. E.V
Wir sind für Ihre Tiere aktiv………… …….Firma Robin Hood Tierheimservice Tierschutzverein Wiesbaden u.U. e.V. Erneut kann durch die Initiative der Firma Robin Hood Tierheimservice dem Tierheim Wiesbaden eine große Menge hochwertiges Hunde- und Katzenfutter kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Wie schon in den Jahren 2000 - 2019 konnten die Mitarbeiter der Firma Robin Hood Tierheimservice auch in diesem Jahr zahlreiche Firmen aus der Region aktivieren, Futtersortimente für das Tierheim Wiesbaden zu sponsern. Der Tierschutzverein Wiesbaden u. U e.V. bedankt sich hiermit bei nachfolgend aufgeführten Sponsoren: 1 Spezial - Sortiment haben gesponsert: Geisenheim Dachdeckerei und Klempnerei Roland Grünert Idstein SD & T Systems Development & Technology AG Idstein Lars Lampe i-Consulting Wiesbaden Saalfrank Elektrobau Inh. Birgit Racky e.K. Wiesbaden SEG - STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT WIESBADEN MBH Wiesbaden SOULTANA GmbH Gerüstbau und Bedachung Wiesbaden Can Gerüstbau 1 Maxi - Sortiment haben gesponsert: Rüdesheim am Rhein signison GmbH Taunusstein Wölfinger Bedachungen GmbH Wiesbaden LiftConsulting GmbH Teilebetrieb optiPARK Wiesbaden F.O.L GmbH Wiesbaden Syracom AG Wiesbaden You Logic AG 1 Medium - Sortiment haben gesponsert: Aarbergen Arztpraxis Dr. med. Elke Klöppel Eltville Systemanalytiker Michael Metzner Oestrich-Winkel Der Schreiner Matthias Schreiner Taunusstein Vita-World GmbH Walluf Nubia GmbH Wiesbaden Friseursalon Just Nature Inh. Elvira Hermenau Wiesbaden Rechtsanwältin u. Notarin Diane Hilty Wiesbaden Schreinerei Gerd Michel e.K. Inh. Bernd Michel Wiesbaden SEGUNIA Komplettservice für Wohn- u. Gewerbeanlagen Wiesbaden Aukamm Apotheke Wiesbaden Creative Tours-Concepts - Agentur für Eventmarketing Wiesbaden ER-BAU Bauträger GmbH Wiesbaden Juwelier Oberleitner Wiesbaden TSN Neubauer e.K. 1 Small - Sortiment haben gesponsert: Bad Schwalbach Purper Finanz Mathias Purper Budenheim E. Puschner Bauunternehmen GmbH Eltville Steuerberater Stephan Bahlk Dipl.-BW (FH) Eltville Weingut H. -

Tagungszentrum Der Deutschen Bundesbankin Eltville Am Rhein
Tagungszentrum der Deutschen Bundesbank in Eltville am Rhein Tagungszentrum der Deutschen Bundesbank in Eltville am Rhein Der Name „Eltville“ steht in der Deutschen der Bank sowie die Gäste in diesem Haus Willkommen Bundesbank für Aus- und Fortbildung, die in wohl fühlen und der Aufenthalt auch einen Zeiten des schnellen Wandels einen besonders anregenden Gedanken- und Erfahrungs- hohen Stellenwert hat. Hier finden Lehrgänge austausch fördert. und Seminare für Mitarbeiterinnen und Mit- arbeiter der Bank statt. Außerdem werden Konferenzen und Tagungen auf nationaler und internationaler Ebene durchgeführt. Tagungszentrum der Architektur und Ausstattung des Tagungs- Deutschen Bundesbank zentrums sollen die Rahmenbedingungen Erbacher Straße 18, 65343 Eltville am Rhein für ein effektives Arbeiten in angenehmer Telefon 06123 901-0 Umgebung ermöglichen. Wir hoffen, dass Fax 06123 901-399 sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter E-Mail [email protected] Anreise Ankunft Barrierefreiheit Das Tagungszentrum liegt am westlichen Sie erhalten an der Rezeption Ihren Zim- Das Tagungszentrum ist im Gebäude Ortsrand von Eltville am Rhein und ist merschlüssel mit dem Zugangschip für den und im Außenbereich barrierefrei ca. 50 km von Frankfurt am Main entfernt. Haupteingang, die Tiefgarage und das Tor gestaltet. Mit der Bahn kommen Sie über die Bahn- am Rheinufer. Für Ihr Auto stehen Ihnen in Wenn Sie ein entsprechendes Ihre Anreise strecke Frankfurt am Main/Wiesbaden/ der Tiefgarage ausreichend Parkmöglich- Zimmer benötigen, setzen Sie sich Koblenz. Vom Bahnhof Eltville zum Tagungs- keiten zur Verfügung. Die Rezeption des bitte mit uns in Verbindung. zentrum sind es 1,2 km. Vor dem Bahnhof Tagungszentrums ist 24 Stunden besetzt. befindet sich ein Taxistand. Mit dem Auto erreichen Sie uns über die Abreise Rauchfrei Zimmer Autobahn 66 / Bundesstraße 42, Wir bitten Sie, Ihr Zimmer am Abreisetag Gemäß Gesetz zum Schutz vor den Gefahren Das Tageszentrum verfügt über 105 Einzel- Abfahrt Eltville-West / Erbach. -

Gesundheitswegweiser Rheingau Taunus Kreis
RHEINGAU TAUNUS KREIS Gesundheitswegweiser Rheingau-Taunus-Kreis und Umgebung Anbieterverzeichnis gesundheitsbezogener Angebote Ärzte/Fachärzte . Krankenhäuser/Kliniken . Gesundheits-Dienstleister . Senioren . Beratung und Hilfen INFORMATIV 2 INFORMATIVVORWORT „Krankheiten befallen uns nicht aus heiterem Himmel, Taunus, über das Wirken der Schlaganfallhilfe und über sondern entwickeln sich aus täglichen Sünden wider die gefährliche Keime in dieser neuen Ausgabe. Natur. Wenn sich diese gehäuft haben, brechen sie un- versehens hervor.“ (Hippokrates) Der Gesundheitswegweiser ist also nicht nur ein Nach- schlagewerk, in dem Sie umfassende Daten von A wie Akupunktur bis Z wie Zahnärzte finden sondern auch Liebe Leserinnen, liebe Leser, eine Broschüre mit vielen Informationen rund um Gesund- heit und Heiltherapien, wenn eine Erkrankung erfolgt ist. wir freuen uns, Ihnen die 2. Auflage des Gesundheits- Es liegt Ihnen also ein nützlicher Wegweiser aus dem wegweisers präsentieren zu können. Die rege Nachfra- Bereich Gesundheitswesen vor. ge nach der Broschüre – innerhalb von kurzer Zeit war die erste Auflage vergriffen – zeigt uns, dass wir ein Der Gesundheitswegweiser 2013 wäre ohne eine breite wichtiges Nachschlagewerk geschaffen haben, dessen Unterstützung nicht möglich. Unser besonderer Dank gilt Informationsgehalt als hoch eingeschätzt wird. Das freut daher unseren Inserenten, die es wiederum ermöglichten, uns natürlich. dass Ihnen diese Ausgabe des Gesundheitswegweisers kostenlos zur Verfügung gestellt werden kann. Und nicht In bewährter Form legt Ihnen das Gesundheitsamt des zuletzt danken wir dem VBS-Verlagsbüro Steigerwald Rheingau-Taunus-Kreises eine aktualisierte Fassung mit für die umfassende und fachkundige Hilfe bei der Erstel- Hilfsangeboten, Ansprechpartnern und Adressen aus lung des Wegweisers, den Sie auch im Internet unter dem Bereich des Gesundheitswesens im Rheingau- www.rheingau-taunus.de (Gesundheitsamt) vorfinden. -

Eltville: Umgestaltung Des Rheinufers
Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz Gute Beispiele der Städtebauförderung in Hessen Eltville: Umgestaltung des Rheinufers Ausgezeichnet mit dem Preis für zeitgenössische Gartenkultur Garten-Oskar 2017 der Deutschen Gesellschaft für Gartenkunst und Landeskultur e.V. Förderprogramm Stadtumbau in Hessen Das Rheinufer in Eltville konnte durch umfassende Umgestaltungsmaßnah- men im Zeitraum zwischen 2015 und 2017 als naturnaher Erlebnisraum für landschaftsbezogene Erholungs- und Freizeitaktivitäten aufgewertet wer- den. Dabei sind die charakteristischen Gegebenheiten sowie die Bedeu- tung des Uferbereiches für das Eltviller Orts- und Landschaftsbild berück- sichtigt worden. Entlang und im Nahbereich des überörtlichen Rad- / Wanderweges „Lein- pfad“ konnten die vorhandenen Freiräume, baulichen Anlagen und Wege durch gestalterische Maßnahmen aufgewertet und durch attraktivitätsstei- gernde Nutzungsangebote ergänzt werden. Die Umgestaltung des Rheinufers Eltville wurde im Jahr 2017 mit dem Preis für zeitgenössische Gartenkultur „Garten-Oskar“ der Deutschen Gesellschaft für Gartenkunst und Landeskultur e.V. ausgezeichnet. Eltville Rheinufer zwischen Hattenheim und Walluf Quelle: Bauamt der Stadt Eltville Die Umgestaltung des Rheinufers ist als interkommunale Fördermaßnahme im Städtebauförderprogramm Stad- tumbau in Hessen eingebunden in ein überörtliches Kon- zept, das auch die Uferbereiche in den Ortslagen von Er- bach und Hattenheim mit einbezieht. Eltville am Rhein ist eine traditionsreiche Stadt -

Rüdesheim Geisenheim Eltville Wiesbaden Montag
171 Rüdesheim Geisenheim Eltville Wiesbaden RMV-Servicetelefon: 069 / 24 24 80 24 t Montag - Freitag Am 24.12. und 31.12. Verkehr wie Samstag Verkehrsbeschränkung S4 S4 S4 S4 F4 S4 S4 S4 S4 LSZ LSZ Rüdesheim a. Rh. Hildegardis. 5.20 7.20 - Winzerweg 5.21 7.21 - Eibinger Kirche 5.22 7.22 - Krankenhaus 5.23 7.23 - Kirchstraße 5.24 7.24 - Rheinhalle Nord 7.19 7.19 - Bahnhof 4.43 5.43 6.43 7.43 - Bahnhof/Brömserburg 4.44 5.44 6.44 7.44 - Rheinhalle Süd 4.48 5.26 5.48 6.48 7.21 7.21 7.26 7.48 8.48 9.48 - Rheinhalle Nord 4.49 5.49 6.49 7.49 8.49 9.49 - Kirchstraße 4.49 5.49 6.49 7.49 8.49 9.49 0 - Krankenhaus 4.51 5.51 6.51 7.51 8.51 9.51 - Eibinger Kirche 4.52 5.52 6.52 7.52 8.52 9.52 - Winzerweg 4.53 5.53 6.53 7.53 8.53 9.53 - Hildegardisschule 4.54 5.54 6.54 7.54 8.54 9.54 10.45 10.47 - Friedhof 4.55 5.55 6.55 7.55 8.55 9.55 10.46 10.48 - Geisenheimer Straße 5.28 7.29 Geisenheim Rheingaubad 4.57 5.29 5.57 6.57 7.30 7.57 8.57 9.57 10.48 10.50 - Rheingauresidenz 4.58 5.30 5.58 6.58 7.32 7.58 8.58 9.58 10.49 10.51 - Ursulinen 5.00 5.33 6.00 7.00 7.28 7.28 7.35 8.00 9.00 10.00 10.51 10.53 - Rheinufer 5.02 5.34 6.02 7.02 7.37 8.02 9.02 10.02 10.53 10.55 - Bahnhof an 5.05 6.05 7.05 7.40 8.05 9.05 10.05 - Bahnhof ab 5.08 6.08 7.08 7.40 8.08 9.08 10.08 - Chauvignystraße 5.10 5.35 6.10 6.45 7.10 7.30 7.30 7.42 8.10 9.10 10.10 - Maschinenfabrik 5.11 5.36 6.11 6.46 7.11 7.43 8.11 9.11 10.11 10.59 11.01 Winkel Kapperweg 5.13 5.38 6.13 6.48 7.06 7.13 8.14 8.13 9.13 10.13 11.01 11.03 - Brentanohaus 5.15 5.40 6.15 6.35 6.50 7.08 7.15 7.35 7.35 8.16 8.15 9.15 10.15 11.03 11.05 - Graugasse 5.16 5.41 6.16 6.36 6.51 7.09 7.16 7.36 7.36 8.17 8.16 9.16 10.16 11.04 11.06 Mittelheim Basilika/Rheingaust 5.18 5.43 6.18 6.38 6.53 7.11 7.18 7.38 7.38 8.19 8.18 9.18 10.18 11.06 11.08 - Bahnhof/Weinheimer Str. -

Dr. Franz Josef Jung Born 1949 Eltville Am Rhein Nationality: German Lawyer and Notary
Dr. Franz Josef Jung Born 1949 Eltville am Rhein Nationality: German Lawyer and notary Candidate for Shareholder Representative for election at the Annual General Meeting on May 9, 2017 Dr. Franz Josef Jung is not a member of any statutory Supervisory Boards or of comparable control committees of commercial enterprises in Germany and abroad Biography After graduating from high school in 1968 and military service, Dr. Franz Josef Jung studied law from 1970 to 1974 at Johannes Gutenberg University in Mainz. He completed his legal clerkship between 1974 and 1976 at the District Court of Wiesbaden. In 1978, he obtained his Dr. jur. Degree with a doctorate in regional planning in Hesse. Dr. Jung has been working as a lawyer since 1976 and as a notary since 1983 in Eltville. His political career began when he joined the Junge Union in 1969. From 1973 to 1983, he was a member of the Federal Executive Board of the Junge Union Germany; from 1981 to 1983, he was it deputy Federal Chairman. Other milestones include: 1972 to 1987 Kreistag representative for the Rheingau-Taunus district 1983 to 2005 Member of the Hesse Landtag 1987 to 1991 General secretary of the Hesse CDU 1987 to 1999 Chief whip of the CDU Landtag fraction 1989 to 2017 Member of the 9th to 16th Federal Assembly 1998 to 2014 Deputy Chairman of the Hesse CDU 1998 to 2016 Member of the Federal Executive Board of CDU Germany 1999 to 2000 Hessian Minister for Federal and European Affairs and Head of State Chancellery 2003 to 2005 CDU Fraction Chief in the Hesse Landtag for the 16th electoral -
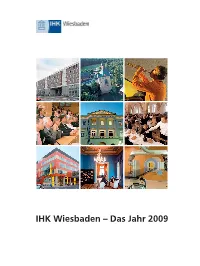
Jahresbericht-2009-Data.Pdf
IHK Wiesbaden – Das Jahr 2009 JAHRESBERICHT 2009 Stark in der Krise! Das Jahr 2009 stand auch für den IHK-Bezirk Wiesbaden im Zeichen der werden. Zugleich waren wir ein ständiger Ratgeber für die Politik, und Wirtschaftskrise – und doch gab es zahlreiche gute Nachrichten: mussten bisweilen hart darum ringen, auf ordnungspolitischem Kurs zu Beispielsweise haben alle ausbildungswilligen und ausbildungsfähigen bleiben. Viele der Kriseninterventionen waren in der Situation richtig – jungen Menschen ein Angebot auf Ausbildung erhalten. Rein rechne- manchen politischen Vorschlägen fehlte indes Maß und Mitte. Um aus risch konnte jeder suchende Jugendliche zwischen zwei Angeboten wäh- der Krise nachhaltig herauszukommen, bedarf es indes einer klaren len. Eine tolle Bilanz, die maßgeblich auf Vernunft und die Weitsicht der Arbeitsteilung zwischen Staat und Unternehmen sowie eine klaren ausbildenden Unternehmen zurückzuführen ist. Verantwortung für individuelles Handeln. Wirtschaftlich stand unser IHK-Bezirk über das ganze Jahr immer etwas Für die IHK Wiesbaden war das vergangene Jahr in vieler Hinsicht posi- besser da als die anderen IHK-Bezirke Hessens. Zugleich erholte sich die tiv: Die IHK-Vollversammlung wurde neu gewählt und sorgte in der Konjunktur in Hessen schneller als im Durchschnitt der anderen Zusammensetzung der 63 Unternehmerinnen und Unternehmer für eine Bundesländer. Schließlich konnte sich die Bundesrepublik Deutschland gute Mischung aus frischen Ideen und solider Erfahrung. Neue Initiativen in der Wirtschaftskrise stärker behaupten als die Mehrzahl der anderen wie der IHK-Wirtschaftsführerschein wurden auf den Weg gebracht, un- Wirtschaftsnationen. Ein umfangreicher Abbau von Arbeitsplätzen wur- ser Service und unser Erscheinungsbild wurden weiter verbessert und un- de dank Kurzarbeit und flexibler Regelungen in den Unternehmen ver- sere Medienpräsenz ausgebaut.