Der Fischotter Lutra Lutra
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

(Und Gemeinden) Landkreise Aachen Anhalt-Zerbst Ahlen Annaberg
Aktive Teilnehmer an den BAVers-Tagungen bis 2015 Städte (und Gemeinden) Landkreise Aachen Anhalt-Zerbst Ahlen Annaberg Ansbach Aue-Schwarzenberg Aschaffenburg Augsburg Augsburg Bad Doberan Bad Salzuflen Bad Ems Bamberg Bad Kreuznach Bayreuth Barnim Bergisch-Gladbach Bautzen Berlin Bitterfeld Bielefeld Börde Bochum Borken Bonn Burgenlandkreis Bottrop Cuxhaven Brandenburg Dahme-Spreewald Braunschweig Delitzsch Bremerhaven Diepholz Chemnitz Döbbeln Coburg Düren Cottbus Ennepe-Ruhr Darmstadt Enzkreis Delmenhorst Elbe-Elster Dietzenbach Emsland Dortmund Forchheim Dresden Freiberg Duisburg Freising Düren Fürth Düsseldorf Fulda Emden Gießen Aktive Teilnehmer an den BAVers-Tagungen bis 2015 Städte (und Gemeinden) Landkreise Eisenhüttenstadt Groß-Gerau Essen Güstrow Flensburg Havelland Frankenthal Hildesheim Frankfurt am Main Höxter Frankfurt/Oder Kamenz Fürth Kelheim Gelsenkirchen Köthen Gera Lahn-Dill Geseke Leipziger Land Görlitz Löbau-Zittau Göttingen Main-Kinzig Greifswald Main-Taunus Gütersloh Mansfelder Land Jena Meißen Hagen Merseburg-Querfurt Halle (Saale) Mettmann Hamburg Mittlerer Erzgebirgskreis Hamm Mittweida Hannover Muldentalkreis Harsewinkel München Heilbronn Neustadt/Aisch Herne Niesky Hof Nordfriesland Hoyerswerda Nordwestmecklenburg Kaiserslautern Oberhavel Kassel Oder-Spree Kiel Ohrekreis Koblenz Offenbach Aktive Teilnehmer an den BAVers-Tagungen bis 2015 Städte (und Gemeinden) Landkreise Köln Osnabrück Krefeld Osterholz-Scharmbeck Landau Ostprignitz-Ruppin Landshut Parchim Leipzig Passau Lippstadt Peine Magdeburg Potsdam-Mittelmark -

Selbsttötungen Im Freistaat Sachsen
Selbsttötungen im Freistaat Sachsen 2006 A IV 10 - j/06 ISSN 1435-8670 Bevölkerung,Gebiet, Erwerbstätigkeit Preis:€ 1,50 Zeichenerklärung - Nichtsvorhanden(genauNull) x Tabellenfachgesperrt, weilAussagenichtsinnvoll 0 WenigeralsdieHälftevon1in derletztenbesetztenStelle,jedoch () Aussagewertisteingeschränkt mehralsnichts … Angabefälltspäteran p vorläufigeZahl / Zahlenwertnichtsichergenug r berichtigteZahl . Zahlenwertunbekanntoder s geschätzteZahl geheimzuhalten Herausgeber: StatistischesLandesamtdesFreistaatesSachsen Macherstraße63 Postfach1105 01917Kamenz 01911Kamenz Telefon Vermittlung0357833-0 Präsidentin/Sekretariat -1900 Telefax-1999 Auskunft -1913,-1914 Telefax-1921 Bibliothek -4352 Telefax-1598 Vertrieb -4316 Internetwww.statistik.sachsen.de [email protected] KeinZugangfürelektronischsigniertesowieverschlüsselteDokumente © StatistischesLandesamtdesFreistaatesSachsen,Kamenz,Juli 2007 FürnichtgewerblicheZweckesindVervielfältigungundunentgeltlicheVerbreitung,auchauszugsweise, mitQuellenangabegestattet.DieVerbreitung,auchauszugsweise,überelektronischeSysteme/Daten- trägerbedarfdervorherigenZustimmung.AlleübrigenRechtebleibenvorbehalten. Inhalt Seite Vorbemerkungen 3 Vorsätzliche Selbstbeschädigungen (Selbsttötungen) im Freistaat Sachsen 2006 4 Tabellen 1. Vorsätzliche Selbstbeschädigungen 2005 und 2006 nach Altersgruppen und Geschlecht 5 2. Vorsätzliche Selbstbeschädigungen 2006 nach Art der Tötung und Altersgruppen 6 3. Vorsätzliche Selbstbeschädigungen 2006 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie Geschlecht 7 -

The State Reservoir Administration of Saxony Property from Floods
Masthead Publisher: Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen Bahnhofstraße 14, 01796 Pirna, Germany Internet: www.talsperren-sachsen.de Tel.: +49 (0) 3501 796 – 0, Fax: +49 (0) 3501 796-116 E-mail: [email protected] Editors: Press and Public Relations Copy Deadline: February 2007 Photographs: Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen, Kirsten J. Lassig, www.photocase.com Circulation: 1,000 copies Design: Heimrich & Hannot GmbH Printing: Druckfabrik Dresden GmbH Paper: 100 % chlorine free bleached THE STATE RESERVOIR (No access for electronically signed as well as for encrypted electronic documents) ADMINIstrATION OF SAXONY Note This informational brochure is published by the Saxon State Government in the scope of its public relations work. It may not be used by parties or campaign Function – Organization – Projects aids for the purpose of election advertising. This is valid for all elections. CONTENts 4 10 12 14 18 24 FOREWORD ORGANIZATION OF THE THE NERVE CENTER ON-SITE EXPERTISE: Zwickauer Mulde/ FLOOD PROTECTION AND STATE RESERVOIR OF THE STATE RESERVOIR THE REGIONAL WORKS Obere Weiße Elster DRINKING WATER SUPPLy – 5 ADMINISTRATION OF SAXONY ADMINISTRATION OF SAXONY: TWO EXAMPLES STEWARDSHIP HEADQUARTERS IN PIRNA 14 20 OF SAXony’S WATERS Oberes Elbtal Spree/Neiße 24 Function of the State Reservoir Comprehensive flood protection Administration of Saxony 16 22 for the city of Torgau Freiberger Mulde/ Elbaue/Mulde/ Zschopau Untere Weiße Elster 26 Complex overhaul of the Klingenberg dam 2 CONTENTS 3 FOREWORD The first water reservoirs in Saxony were built as Saxony was founded in 1992 as the first public early as 500 years ago. The mining industry was enterprise in Saxony. -

The Protestant Ethic and Work: Micro Evidence from Contemporary Germany
Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung www.diw.de SOEPpapers on Multidisciplinary Panel Data Research 330 Jörg L. Spenkuch A The Protestant Ethic and Work: Micro Evidence from Contemporary Germany Berlin, November 2010 SOEPpapers on Multidisciplinary Panel Data Research at DIW Berlin This series presents research findings based either directly on data from the German Socio- Economic Panel Study (SOEP) or using SOEP data as part of an internationally comparable data set (e.g. CNEF, ECHP, LIS, LWS, CHER/PACO). SOEP is a truly multidisciplinary household panel study covering a wide range of social and behavioral sciences: economics, sociology, psychology, survey methodology, econometrics and applied statistics, educational science, political science, public health, behavioral genetics, demography, geography, and sport science. The decision to publish a submission in SOEPpapers is made by a board of editors chosen by the DIW Berlin to represent the wide range of disciplines covered by SOEP. There is no external referee process and papers are either accepted or rejected without revision. Papers appear in this series as works in progress and may also appear elsewhere. They often represent preliminary studies and are circulated to encourage discussion. Citation of such a paper should account for its provisional character. A revised version may be requested from the author directly. Any opinions expressed in this series are those of the author(s) and not those of DIW Berlin. Research disseminated by DIW Berlin may include views on public policy issues, but the institute itself takes no institutional policy positions. The SOEPpapers are available at http://www.diw.de/soeppapers Editors: Georg Meran (Dean DIW Graduate Center) Gert G. -

And Long-Term Electoral Returns to Beneficial
Supporting Information: How Lasting is Voter Gratitude? An Analysis of the Short- and Long-term Electoral Returns to Beneficial Policy Michael M. Bechtel { ETH Zurich Jens Hainmueller { Massachusetts Institute of Technology This version: May 2011 Abstract This documents provides additional information referenced in the main paper. Michael M. Bechtel is Postdoctoral Researcher, ETH Zurich, Center for Comparative and International Studies, Haldeneggsteig 4, IFW C45.2, CH-8092 Zurich. E-mail: [email protected]. Jens Hainmueller is Assistant Professor of Political Science, Massachusetts Institute of Technology, 77 Mas- sachusetts Avenue, Cambridge, MA 02139. E-mail: [email protected]. I. Potential Alternative Explanation for High Electoral Returns in Affected Regions Some have pointed out that the SPD's victory in 2002 may have simply resulted from Gerhard Schr¨oder(SPD) being much more popular than his political opponent Edmund Stoiber and not from the incumbent's massive and swift policy response to the Elbe flooding. For this argument to be valid we should see a differential reaction to the announcement of Stoiber's candidacy in affected and control regions. We use state-level information on the popularity of chancellor Schr¨oderfrom the Forsa survey data to explore the validity of this argument. Figure 2 plots monthly Schr¨oder'sapproval ratings in affected and unaffected states in 2002. Figure 1: Popularity Ratings of Gerhard Schr¨oderand Flood Onset 60 55 50 45 Schroeder Popularity in % 40 35 2002m1 2002m3 2002m5 2002m7 2002m9 2002m2 2002m4 2002m6 2002m8 Treated states (>10% of districts affected) Controls Election Flood Note: Percent of voters that intend to vote for Gerhard Schr¨oderwith .90 confidence envelopes. -
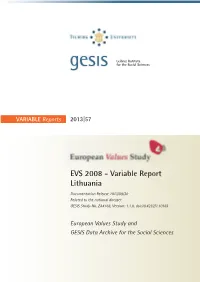
Variable Report ZA4768
VARIABLE Reports 2013|57 EVS 2008 - Variable Report Lithuania Documentation Release 2013/09/30 Related to the national dataset GESIS Study-No. ZA4768, Version: 1.1.0, doi:10.4232/1.10163 European Values Study and GESIS Data Archive for the Social Sciences │ Acknowledgements The fieldwork of the 2008 European Values Study (EVS) was financially supported by universities and research institutes, national science foundations, charitable trusts and foundations, companies and church organizations in the EVS member countries. A major sponsor of the surveys in several Central and Eastern European countries was Renovabis. Renovabis - Solidarity initiative of the German Catholics with the people in Central and Eastern Europe: Project No. MOE016847 http://www.renovabis.de/. , http://www.europeanvaluesstudy.eu/evs/sponsoring.html. The project would not have been possible without the National Program Directors in the EVS member countries and their local teams. Gallup Europe developed a special questionnaire translation system WebTrans, which appeared to be very valuable and enhanced the quality of the project. Special thanks also go to the teams at Tilburg University, CEPS/INSTEAD Luxembourg, and GESIS Data Archive for the Social Sciences Cologne. 2 GESIS-Variable Reports 57 Contents Introduction and preliminary remarks ............................................................................................................................. 3 1 European Values Study 1981-2008 ...................................................................................................................... -

1.1 Fläche Und Bevölkerung 6
1.1 Fläche und Bevölkerung 1 Allgemeine statistische Angaben 1.1 Fläche und Bevölkerung Sachsen nimmt mit einer Fläche von 18 416 km² und einem Bundesanteil von 5,2 Prozent den 10. Platz in der Größenordnung der 16 Bundesländer ein. Die Bevölkerung des Freistaates zählte am 31.12.2005 nach Angaben des Statistischen Landesamtes 4 273 754 Einwohner, unter ihnen 119 786 Ausländer. Der Anteil der Ausländer an der Gesamtbevölke- rung betrug 2,8 Prozent und lag gemessen am Bundesdurchschnitt (8,8 Prozent) vergleichsweise niedrig. Rein statistisch lebten je Quadratkilometer in Sachsen 232 Einwohner, einer mehr als im Durchschnitt der Bundesrepublik. Tabelle 1: Alters- und Geschlechtsstruktur der Bevölkerung insgesamt Altersgruppe Bevölkerung insgesamt davon männlich weiblich Anzahl in % Anzahl in % Anzahl in % Kinder 405 314 9,5 207 371 51,2 197 943 48,8 Jugendliche 185 005 4,3 95 324 51,5 89 681 48,5 Heranwachsende 167 816 3,9 87 235 52,0 80 581 48,0 Erwachsene 3 515 619 82,3 1 693 310 48,2 1 822 309 51,8 insgesamt 4 273 754 100,0 2 083 240 48,7 2 190 514 51,3 Tabelle 2: Alters- und Geschlechtsstruktur der deutschen Bevölkerung Altersgruppe deutsche Bevölkerung davon männlich weiblich Anzahl in % Anzahl in % Anzahl in % Kinder 394 752 9,5 201 914 51,1 192 838 48,9 Jugendliche 180 962 4,4 93 186 51,5 87 776 48,5 Heranwachsende 163 262 3,9 84 741 51,9 78 521 48,1 Erwachsene 3 414 992 82,2 1 634 107 47,9 1 780 885 52,1 insgesamt 4 153 968 100,0 2 013 948 48,5 2 140 020 51,5 Tabelle 3: Alters- und Geschlechtsstruktur der ausländischen Bevölkerung -

Jugendweihe Magazin
ugendweihe J Regierungsbezirk Magazin Leipzig 2006/07 U1 Ihre Stadt. Ihr Leben. Ihre Seite. Konzerte, Ausstellungen, Sportveranstaltungen, Restaurants Alle Biergärten, Bringdienste, Sportstudios, Kartbahnen Infos Schwimm- bäder, Saunen über Vereine, Hotels, Cam- pingplätze, Ferienwohnungen Ihre Museen, Theater, Stadtpläne Stadt Wetter, Routen- planer, Radarfallen, Fabrikverkäufe, Immobi- lien, Branchenverzeichnis, Jobs … Herausgegeben in Zusammenarbeit Nachdruck oder Reproduktion, gleich • Dokumentationen mit der Trägerschaft. welcher Art, ob Fotokopie, Mikrofilm, • Bildung und Forschung Änderungswünsche, Anregungen und Datenerfassung, Datenträger oder • Bau und Handwerk Ergänzungen für die nächste Auflage Online nur mit schriftlicher Genehmi • Bio, Gastro, Freizeit WEKA info verlag gmbh dieser Broschüre nimmt die Verwal gung des Verlages. tung oder das zuständige Amt entge Infos auch im Internet: Lechstraße 2 gen. Titel, Umschlaggestaltung sowie 04109189/1. Auflage/2006 www.allesdeutschland.de D86415 Mering Art und Anordnung des Inhalts sind www.allesaustria.at zugunsten des jeweiligen Inhabers In unserem verlag erscheinen www.seninfo.de Telefon +49 (0) 82 33/3 840 dieser Rechte urheberrechtlich Produkte zu den Themen: www.klinikinfo.de Telefax +49 (0) 82 33/3 841 03 geschützt. • Bürgerinformation www.zukunftschancen.de Nachdruck und Übersetzungen sind – • Klinik und Gesundheitsinformation info@wekainfo.de auch auszugsweise – nicht gestattet. • Senioren und Soziales www.wekainfo.de Liebe Leser Jede Gesellschaft, jede Kultur auf einfach ist, sich in der Welt der Erwachsenen zurechtzufinden, rich- dieser Erde hat ihre eigene Form tige und gute Entscheidungen zu treffen. Wir, der Sächsische Ver- Ihre Stadt. Ihr Leben. entwickelt, junge Menschen in die band für Jugendarbeit und Jugendweihe e.V., helfen euch, Antwor- Gemeinschaft der Erwachsenen ten auf eure Fragen zu finden, und begleiten euch auf eurem Weg Ihre Seite. -

Econstor Wirtschaft Leibniz Information Centre Make Your Publications Visible
A Service of Leibniz-Informationszentrum econstor Wirtschaft Leibniz Information Centre Make Your Publications Visible. zbw for Economics Haupt, Harry; Meier, Verena Working Paper Dealing with heterogeneity, nonlinearity and club misclassification in growth convergence: A nonparametric two-step approach Working Papers, No. 455 Provided in Cooperation with: Center for Mathematical Economics (IMW), Bielefeld University Suggested Citation: Haupt, Harry; Meier, Verena (2011) : Dealing with heterogeneity, nonlinearity and club misclassification in growth convergence: A nonparametric two-step approach, Working Papers, No. 455, Bielefeld University, Institute of Mathematical Economics (IMW), Bielefeld This Version is available at: http://hdl.handle.net/10419/81103 Standard-Nutzungsbedingungen: Terms of use: Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen Documents in EconStor may be saved and copied for your Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden. personal and scholarly purposes. Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle You are not to copy documents for public or commercial Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich purposes, to exhibit the documents publicly, to make them machen, vertreiben oder anderweitig nutzen. publicly available on the internet, or to distribute or otherwise use the documents in public. Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen (insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten, If the documents have -

Landkreis Nordsachsen
Landkreis Nordsachsen 7. Beteiligungsbericht für das Wirtschaftsjahr 01.01.2008 - 31.12.2008 Stand 01.10.2009 Inhaltsverzeichnis Abkürzungsverzeichnis V Vorwort VII I. Beteiligungsübersicht 1 II. Unmittelbare Beteiligungen des Landkreises Nordsachsen 5 II.1 Allgemeine Gesamtlage 5 II.2 Besonderheiten der einzelnen Beteiligungen 5 III. Finanzbeziehungen zwischen Landkreis und Beteiligungen 7 IV. Übersicht der Stammeinlagen des Landkreises Nordsachsen bei unmittelbaren Beteiligungen (Eigenbetrieb und GmbH) 11 V. Kennziffernbericht 13 VI. Kommunaler Eigenbetriebe des Landkreises Nordsachsen 21 V.1 Kommunaler Eigenbetrieb „Kultur- und Bildungseinrichtungen des Landkreises Delitzsch“ 21 V.2 Eigenbetrieb „Bildungsstätten des Landkreises Torgau-Oschatz 27 V.3 Eigenbetrieb Rettungsdienst des Landkreises Nordsachsen 31 VII. Einzeldarstellung der Beteiligungsgesellschaften des Landkreises Nordsachsen und deren Tochtergesellschaften 35 VII.1 Kreiskrankenhaus Delitzsch GmbH 35 VII.1.1 Seniorenpflege und Wohnen GmbH 39 VII.1.2 Kreiskrankenhaus Delitzsch Service GmbH 43 VII.2 Kreiskrankenhaus Torgau „Johann Kentmann“ gGmbH 47 VII.2.1 Krankenhaus Service GmbH 53 VII.2.2 VITARIS Pflege- und Altenheim gGmbH 57 VII.3 Collm Klinik Oschatz GmbH 61 VII.3.1 Collmed GmbH 67 VII.4 Technologie- und Gründerzentrum Torgau GmbH 71 VII.5 Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH 75 VII.6 Entsorgungs-, Entwicklungs- und Baugesellschaft Delitzsch mbH 79 III VII.6.1 Anlagenbau Umweltprojekt GmbH 83 VII.7 Kreiswerke Delitzsch GmbH 87 VII.8 Gesellschaft für Kreisentwicklung und Wohnungsbau im Landkreis Delitzsch mbH 93 VII.9 Abfallwirtschaft Torgau-Oschatz GmbH 97 VII.10 Behindertenzentrum Landkreis Delitzsch gGmbH 103 VII.11 Kurbetriebsgesellschaft Dübener Heide mbH 107 VI.8.1 HEIDE SPA Hotel Geschäftsführungs GmbH 111 VI.8.2 HEIDE SPA Hotel GmbH & Co. KG 115 VII.12 Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH 119 VII.13 Omnibus – Verkehrsgesellschaft mbH „Heideland“ (OVH) 125 VII.14 Flughafen Leipzig / Halle GmbH 131 VIII. -

Erläuterung Zur Codierung in Der Tabelle "Messstellenverzeichnis"
BMBF Projekt "Bedeutung der Nebenflüsse für den Feststoffhaushalt der Elbe" Anhang C - Schwebstoff-Messstellenverzeichnis Erläuterung zur Codierung in der Tabelle "Messstellenverzeichnis" M_A = erster Monat, für den ein Messwert vorliegt M_B = letzter Monat, für den ein Messwert vorliegt M_f = Messfrequenz Fl.-Km = Flusskilometer BP-Nr. = Bezugspegel (Nummer siehe Tabelle D, "Verzeichnis der Bezugspegel") Z = Zuständigkeit (Codierung siehe Tabelle unten) CodeBehörde Bundesland Seite AStAUN Schwerin Meck.-Vorpommern E - 3 BNLWK Lüneburg Niedersachsen E - 4 CLUA Brandenburg Brandenburg E - 2 DStadtUm Berlin, ITOX Berlin E - 1 E StAU Magdeburg F StAU Halle Sachsen-Anhalt E - 6 G StAU Dessau/Wittenberg H LfUG Dresden J StUfa Leipzig K StUfa Chemnitz Sachsen E - 5 L StUfa Plauen M StUfa Bautzen N UBG Radebeul O TLU Jena Thüringen E - 8 P SUA Suhl/Erfurt keine Messwerte vorliegend Schwebstoff-Messwerte vorliegend, Konzentrations-Auswertung durchgeführt Schwebstoff-Messwerte sowie zugehöriger Pegel vorliegend, Konzentrations- und Fracht-Auswertung durchgeführt Bestimmungsmethode an allen Messstellen: DIN 38409 H2 - 2 Anhang C - Schwebstoff-Messstellenverzeichnis BMBF Projekt "Bedeutung der Nebenflüsse für den Feststoffhaushalt der Elbe" Nebengewässer der Elbe Messstelle afS - Messreihe Lage der Messstelle BP-Nr. Z 1.Ordnung 2.Ordnung 3.Ordnung 4.Ordnung M_A M_B M_f RW HW Fl.-Km Aland Schnackenburg 05.1980 07.2000 1 - 13 587824 587824 B Aland Wanzer 01.1992 12.1999 5 - 26 4,9 E Boize Boizenburg 01.1992 12.2000 4 - 26 591672 591672 1 A Dahle Seidewitz 04.1990 12.1993 2 - 6 5700750 4583050 0,3 J Dahle Außig Mdg. 01.1994 09.2001 8 - 17 5697700 4583015 3,8 J Dahle Schirmenitz 5695660 4582580 6,3 J Dahle Cavertitz 5695140 4578900 10,5 J Dahle uh. -

Gastgeberverzeichnis Der Stadt Wurzen Und Umgebung
Gastgeberverzeichnis der Stadt Wurzen und Umgebung Objekt Zimmer und Preise pro Übernachtung Ausstattung (A), Lage (L), Sonstiges (S) Wurzen (04808) Ferienwohnung Daniel Schirner FeWo für 4 Personen A: Küche, 2 Zimmer, Bettwäsche inkl., Handtücher sind Postgasse 19 Ab 12,50 € (bei 4er Belegung) inkl. Endreinigung mitzubringen Mobil: 0174/9 50 42 50 Aufbettung 5,00 € p.P. L: Zentrumsnah, direkt in der Altstadt, Einkaufmög- E-Mail: [email protected] lichkeiten, Restaurants, Parkplätze und der Bahnhof Wurzen sind alle zu Fuß in fünf bis zehn Gehminuten erreichbar S: Grillecke Ferienwohnung Sebastian, Frau Ernst FeWo für 4 Personen L: ruhige Lage mit Nähe zum Zentrum, günstige Fr.-Ludwig-Jahn-Str. 12 18,00 € pro Person Verkehrsanbindung Telefon/Telefax: 03425/92 31 97 (Kinderermäßigung, bei längerem Aufenthalt Rabatt möglich) Mobil: 0173/9 65 25 81 Frühstück auf Wunsch Ferienwohnung Familie Filges FeWo für 2-3 Personen L: Nähe Parkanlage, sehr gute Verkehrsanbindung Hermann-Ilgen-Str. 3 Januar – Dezember Telefon: 03425/81 72 26 Tagespreis für die FeWo 1. Nacht 53,00 € Telefax: 03425/81 72 25 jede weitere Nacht 38,00 € E-Mail: [email protected] (inkl. Endreinigung) Internet: www.fewo-filges.de Ferienwohnung Frau Krückeberg 2 FeWo von April-Oktober A FeWo1: Esszimmer, Küche, Vollbad, Schlafzimmer, Lessingstr. 24 FeWo1 (ca. 68 qm über 2 Etagen) für 4 Personen 40,00 € Wohnzimmer, Kinderzimmer, Handtücher vorhanden, Telefon: 03425/85 65 66 FeWo2 (ca. 56 qm) für 5 Personen 50,00 €, Bettwäsche nicht vorhanden, TV Anfragen: Frau Krückeberg0421/80