Mobilitätsleitbild Für Die Region Linz
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

References Say More Than 1000 Words
REFERENCES SAY MORE THAN 1000 WORDS REFERENCES SAY MORE THAN 1000 WORDS 01 AUSTRIA Industry: Gebauer & Griller Linz Actual Window Haid Hefner Austria Weisskirchen Office and commercial buildings: Airport Linz IAEA Seibersdorf – Clean room laboratory Almi Oftering Bene Headquarter Waidhofen/Ybbs Injectoplast Waidhofen/Thaya Engel machinery factory Generali insurance headquarter Linz Kaindl industrial supply Leonding Austrian Federal Railway Johannes Kepler University Linz Magna Klagenfurt Banner batteries Linz Kaindl residence and commercial Mannesmann Pipe Mill Vienna house Barracks Hoersching Miba Austria Kaindl Vienna Baxter ‐ new office & lab Vienna Neuson Building machinery Baxter cleanroom production KPMG Alpentreuhand Linz Leonding Vienna Mega Cooking Centre Vienna Ott machinery factory Lambach Baxter plasma Linz Paris Lodron Centre Salzburg Ottakringer brewery Vienna BRP Rotax / Motor factory Purkert metal Asten Health / Sports facilities: Gunskirchen Chemie Linz Rauch fruit juices Nüziders Children's Village St. Isidore Combined heat and power station Rosenbauer Leonding Leonding Linz Starlim Sterner Group Marchtrenk Deaconess Hospital Salzburg Switchboards Tann Marchtrenk ‐ Meat factory Holmes Place gyms o Honeywell Wien Technology centre Perg Hospital Ried o Johnson Controls Wien Trench Electric Linz Hospital “Sisters of Mercy” Vienna o Sauter System Wien Umdasch Amstetten Medical Centre Wels o Trench Austria Leonding Welser Profile Gresten Medicent Medical Centres Ebner Industrial -

Linz Simonystraße Bussteig 1 Gültig Ab: 21.04.2019 2 0 17.22 S 400 Steyr City Point 0 18.33
Départ/Departure Aktuelle Abfahrt Abfahrten Linz Simonystraße Bussteig 1 gültig ab: 21.04.2019 2 0 17.22 S 400 Steyr City Point 0 18.33 . Montag - Freitag 17.23 410 Sierning Busterminal 0 18.09 14.00 Linie Verlauf/Endhaltestelle an 0 17.41 410 Niederneukirchen Ortsmitte 0 18.06 14.03 409 Asten Ortsmitte 2 14.15 . 0 18.21 14.23 05.00 Linie Verlauf/Endhaltestelle an 17.46 611 Traun Hauptplatz (Neubauer Straße) ¶' Enns Dr.-Renner-Straße 17.52 401 Steyr City Point 0 19.07 Mauthausen Bahnhof (Vorplatz) 14.34 0 06.15 05.06 400 Steyr City Point 0 0 2 . 14.46 611 Traun Hauptplatz (Neubauer Straße) 15.21 . 18.00 Linie Verlauf/Endhaltestelle an 0 16.00 06.00 Linie Verlauf/Endhaltestelle an 14.52 401 Steyr City Point 18.07 611 Haid Busterminal (Hauptplatz) 0 18.43 0 06.03 409 Asten Ortsmitte 2 06.15 . 18.11 410 Sierning Busterminal 0 19.00 15.00 Linie Verlauf/Endhaltestelle an ¶' Enns Dr.-Renner-Straße 06.23 18.22 S 400 Enns Hauptplatz (Stadtturm) 0 18.49 15.42 S 410 Sierning Busterminal 0 16.23 Mauthausen Bahnhof (Vorplatz) 06.34 18.41 411 Hofkirchen i.Tkr. Ortsmitte 0 19.17 15.42 F 410 Sierning Busterminal 0 16.23 06.12 412 Hofkirchen i.Tkr. Ortsmitte 0 06.35 18.46 611 Traun Hauptplatz (Neubauer Straße) 0 19.21 õ 06.12 S 401 Steyr City Point 0 07.21 18.52 401 Steyr City Point 0 20.05 15.46 611 Traun Hauptplatz (Neubauer Straße) 0 16.21 06.12 F 401 Steyr City Point 0 07.25 0 0 0 07.30 . -

Neukonzeption Wirtschaftförderung Und Stadtmarketing Heilbronn
CIMA Beratung + Management GmbH Kaufkraftstrom- und Einzelhandelsstrukturanalyse Oberösterreich-Niederbayern Detailpräsentation für den Bezirk Linz Land Stadtentwicklung M a r k e t i n g Regionalwirtschaft Einzelhandel Wirtschaftsförderung Citymanagement I m m o b i l i e n Präsentation am 09. Februar 2015 Ing. Mag. Georg Gumpinger Organisationsberatung K u l t u r T o u r i s m u s I Studien-Rahmenbedingungen 2 Kerninhalte und zeitlicher Ablauf . Kerninhalte der Studie Kaufkraftstromanalyse in OÖ, Niederbayern sowie allen angrenzenden Räumen Branchenmixanalyse in 89 „zentralen“ oö. und 20 niederbayerischen Standorten Beurteilung der städtebaulichen, verkehrsinfrastrukturellen und wirtschaftlichen Innenstadtrahmenbedingungen in 38 oö. und 13 bayerischen Städten Entwicklung eines Simulationsmodells zur zukünftigen Erstbeurteilung von Einzelhandelsgroßprojekte . Bearbeitungszeit November 2013 bis Oktober 2014 . „zentrale“ Untersuchungsstandorte im Bezirk Ansfelden Neuhofen an der Krems Asten Pasching Enns St. Florian Hörsching Traun Leonding 3 Unterschiede zu bisherigen OÖ weiten Untersuchungen Projektbausteine Oberösterreich niederbayerische Grenzlandkreise angrenzende Räume Kaufkraftstrom- 13.860 Interviews 3.310 Interviews 630 Interviews in analyse Südböhmen davon 1.150 830 Interviews in im Bezirk Linz Land Nieder- und Oberbayern Branchenmix- 7.048 Handelsbetriebe 2.683 Handelsbetriebe keine Erhebungen analyse davon 660 im Bezirk Linz Land City-Qualitätscheck 38 „zentrale“ 13„zentrale“ keine Erhebungen Handelsstandorte -
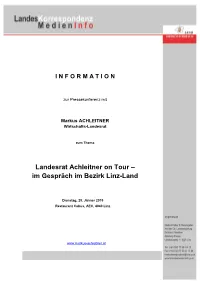
I N F O R M a T I O N
I N F O R M A T I O N zur Pressekonferenz mit Markus ACHLEITNER Wirtschafts-Landesrat zum Thema Landesrat Achleitner on Tour – im Gespräch im Bezirk Linz-Land Dienstag, 29. Jänner 2019 Restaurant Cubus, AEC, 4040 Linz www.markus-achleitner.at LR Achleitner 2 Auf Tour durch alle Bezirke Oberösterreichs Vergangene Woche startete Wirtschafts-Landesrat seine Tour durch alle oberösterreichischen Bezirke und verbrachte jeweils einen Tag in den Bezirken Kirchdorf und Ried im Innkreis. „Nach den ersten Wochen in meiner neuer Funktion ist es mir wichtig, in die Regionen zu kommen, mir selbst ein Bild zu machen und aus erster Hand im Gespräch mit den Menschen zu erfahren, was die Anliegen und Wünsche an das Zukunftsressort sind“, erklärt Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner. Im Mittelpunkt der Bezirkstage steht dabei naturgemäß der Kontakt mit den Unternehmerinnen und Unternehmer im Bezirk. Deshalb startete der heutige Tag mit einem Business-Frühstück mit den Vertreterinnen und Vertretern der Wirtschaft im Bezirk Linz-Land. Darüber hinaus am Programm stehen Besuche mit Firmenbesichtigungen in den Unternehmen TRUMPF Maschinen Austria in Pasching und bei Rosenbauer International AG in Leonding. Im Rahmen des Besuchs bei Rosenbauer International AG wird auch ein Gespräch mit den Vertreterinnen und Vertreter der Industrie im Bezirk stattfinden. Bis April wird Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner alle Bezirke besuchen. „Politik findet nicht hinter dem Schreibtisch statt, sondern im Gespräch mit den Menschen und dafür werde ich mir in den nächsten Monaten noch ausgiebiger als sonst Zeit nehmen“, betont Wirtschafts- Landesrat Achleitner. Pressekonferenz am 29. Jänner 2019 LR Achleitner 3 Aktuelle wirtschaftliche Situation und aktuelle Projekte im Bezirk Linz-Land Arbeitsmarkt Die Situation des Arbeitsmarktes in Oberösterreich zeigt sich aktuell grundsätzlich sehr erfreulich. -

Liquefied Natural Gas (LNG) the Fuel of the Future
Liquefied natural gas (LNG) The fuel of the future ENGLISH Energy supplies for the future LNG – the fuel of the future Securing energy supplies for the future that can provide We firmly believe that gas can make an important Transportation plays an essential role in a functioning economy. All medium and long energy sustainably and affordably, while also reducing contribution to meeting climate protection targets, greenhouse gas emissions and improving energy because of its flexibility and range of uses – for heating term forecasts predict growth in the volume of road traffic, especially heavy goods efficiency, represents one of the biggest challenges and transportation, and in industry. facing the world today. This important goal of the United As a result, RAG is investing in pioneering LNG infra- traffic. Nations Climate Change Conference in Paris will only structure, driving forward this environmentally friendly be achieved by huge collaborative efforts. For years, development. Commissioning of our first LNG filling Global, European and national climate protection targets In the future, gas produced from renewable sources RAG has been working on innovative solutions that station, at Ennshafen port in September 2017, is the aim at a reduction in emissions produced by vehicles. (biogas and gas generated from wind and solar, using take account of changes in energy policies and the first milestone in this process. The use of gas as a fuel can make a major contribution power to gas) might also be used in addition to conven- situation in the energy industry. to achieving these targets, since vehicle traffic contrib- tional natural gas. So ready supplies of gas will be RAG has been producing natural gas in Austria for utes about 45% of emissions. -

M1928 1945–1950
M1928 RECORDS OF THE GERMAN EXTERNAL ASSETS BRANCH OF THE U.S. ALLIED COMMISSION FOR AUSTRIA (USACA) SECTION, 1945–1950 Matthew Olsen prepared the Introduction and arranged these records for microfilming. National Archives and Records Administration Washington, DC 2003 INTRODUCTION On the 132 rolls of this microfilm publication, M1928, are reproduced reports on businesses with German affiliations and information on the organization and operations of the German External Assets Branch of the United States Element, Allied Commission for Austria (USACA) Section, 1945–1950. These records are part of the Records of United States Occupation Headquarters, World War II, Record Group (RG) 260. Background The U.S. Allied Commission for Austria (USACA) Section was responsible for civil affairs and military government administration in the American section (U.S. Zone) of occupied Austria, including the U.S. sector of Vienna. USACA Section constituted the U.S. Element of the Allied Commission for Austria. The four-power occupation administration was established by a U.S., British, French, and Soviet agreement signed July 4, 1945. It was organized concurrently with the establishment of Headquarters, United States Forces Austria (HQ USFA) on July 5, 1945, as a component of the U.S. Forces, European Theater (USFET). The single position of USFA Commanding General and U.S. High Commissioner for Austria was held by Gen. Mark Clark from July 5, 1945, to May 16, 1947, and by Lt. Gen. Geoffrey Keyes from May 17, 1947, to September 19, 1950. USACA Section was abolished following transfer of the U.S. occupation government from military to civilian authority. -

Bezirklinz/Linzland
DDiiee LLaannddwwiirrttsscchhaafftt sseettzztt eeiinn ZZeeiicchheenn BBeezziirrkk LLiinnzz // LLiinnzz LLaanndd Kontakt: Landwirtschaftskammer OÖ Referat Lebensmittel und Erwerbskombinationen Ing. Dipl.-Päd. Ritzberger Maria Auf der Gugl 3, 4021 Linz T +43 50 6902-1260, [email protected] Stand Juni 2021 Fotonachweis: Agrar.Projekt.Verein/Stinglmayr (Titelfoto), Agrar.Projekt.Verein/Cityfoto (18, 26, 27, 34), Agrar.Projekt.Verein/Lechner (16, 29, 38), Velechovsky/p-format/priglinger (35), LK OÖ, Fotos wurden von den Betrieben für die Betriebsvorstellungen zur Verfügung gestellt. Seite 2 Die Landwirtschaft setzt ein Zeichen mit „Gutes vom Bauernhof“ Der Kauf heimischer Lebensmittel steht nicht nur für Frische, kurze Transportwege und Saisonalität der Produkte, sondern sichert auch den Arbeitsplatz Bauernhof. Gerade in der heutigen Zeit, wo Rückverfolgbarkeit und Herkunft der Produkte immer wichtiger werden, sollte der Einkauf in der Nähe beim Bauern eine besondere Rolle spielen. Dies hilft nicht nur dem einzelnen Bauern selbst, sondern erhält eine lebendige, vielfältige und gesunde Region. Beim Erwerb eines bäuerlichen Produktes können Sie auch Details über Produktion, Herstellung sowie Vorzüge und Einsatzmöglichkeiten eines Produktes direkt vom Produzenten erfahren. Um bäuerliche Familienbetriebe bei ihrer Arbeit in der Direktvermarktung zu unterstützen, wurde österreichweit ein Programm zur Qualitätssicherung erarbeitet, welches sich durch die Marke „Gutes vom Bauernhof“ präsentiert. In Oberösterreich gibt es derzeit 368 Betriebe, die mit dieser Marke ausgezeichnet sind. Durch den einheitlichen Werbeauftritt bei Hof- und Markttafeln, Foldern und dgl. sind diese Betriebe leicht für den Konsumenten erkennbar. Betriebe, die mit diesem Zeichen ausgezeichnet sind, garantieren für ..... fachgerechte und sorgfältige Verarbeitung ihrer Produkte . Sicherstellung der Herkunft . Qualität der Produkte, durch Einhaltung der österreichischen Gütesiegelrichtlinien . -

Abteilung Gemeinden
Abteilung Gemeinden ¾ Gemeindeaufsicht Sicherstellung der Gesetzmäßigkeit der Gemeindeselbstverwaltung ein- schließlich der Finanzkontrolle ¾ Gemeindefinanzen Umsetzung des Finanzausgleiches durch Zuteilung der Gemeinde- ertragsanteile und sonstiger Finanz- ausgleichsmittel Gewährung projektbezogener Bedarfs- zuweisungen ¾ Personenstandswesen Klärung von Rechtsfragen im Personen- standswesen, insbesondere bei Auslandsberührungen Aufsicht über die Standesämter und Vollziehung des Namensrechtes ¾ Staatsbürgerschaftsrecht Durchführung von Verfahren zum Erwerb und Verlust, zur Beibehaltung und Feststellung der österreichischen Staatsbürgerschaft ¾ Wahlen Organisation und Leitung von Wahlen und Bürgerrechtsverfahren aufgrund bundes- und landesgesetzlicher Vorschriften "Status und Perspektiven der interkommunalen Kooperation aus Sicht der Länder – das Beispiel Oberösterreich" Dr. Michael Gugler Amt der oö. Landesregierung Abt. Gemeinden 1 interkommunale Zusammenarbeit/ Gemeindekooperationen - warum? • Wünsche nach neuen Infrastruktureinrichtungen steigen laufend – in Gemeinden und Städten zunehmend Leistungs- und Kostendruck • finanzielle Rahmenbedingungen ändern sich massiv – Ausgaben steigen – sinkende freie Budgetmittel bei den Gemeinden – Steuereinnahmen nur begrenzt ausweitbar Ausgaben der Gemeinden Ausgaben der Gemeinden in OÖ 2.500 Ausgaben steigen 2.000 Finanz, Wi_ Förd. 1.500 Dienstleistung Straßen, Wasserbau Mio. € 1.000 Soziales, Gesundheit Sozialausgaben Unterricht, Kultur Verwaltung Sicherheit 500 Ausgaben der Gemeinden in OÖ 135 -

09:30 Marktplatz Gallneukirchen
Engerwitzdorf ROUTE NORD 09:30 Marktplatz Gallneukirchen Programm ab Gallneukirchen : www.radlobby.at/sternradln 09 :30 Abfahrt RADLkonvoi NORD nach Linz 10 :30 Ankunft in Linz am Hauptplatz , Mobilitätsfest 11 :00 Abfahrt zur Linzer -Radparade H:\SternRADLn_2021\Bewerbung\Routen\0930Uhr.jpg Wartberg Ennsdorf Neuhofen an der Krems OÖ SternRADLn zur Linzer Rad-Parade Im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche veranstaltet der Verein Radlobby OÖ am Samstag, 18. September 2021 bereits zum 8. Mal eine große, gemütliche Sternradfahrt zum Linzer Hauptplatz. Heuer werden TeilnehmerInnen aus über 50 Gemeinden und sogar aus anderen Bundesländern erwartet. Bei der Sternfahrt zeigen die RadlerInnen unter dem Motto "Radpedal statt Gaspedal" wie umweltfreundliche Mobilität aussehen kann. Für das letzte Stück der Fahrt wird ab Steyregg, Leonding, Puchenau, Gallneukirchen, Bad Leonfelden, Zwettl an der Rodl und Hellmonsödt gemeinsam auf den Hauptfahrbahnen zum Linzer Hauptplatz geradelt. Linzer Rad-Parade – Fröhliche Fahrt durch die Innenstadt! Vom Linzer Hauptplatz startet wie jedes Jahr die große Linzer Rad-Parade mit einer fröhlichen Fahrt im von der Polizei völlig abgesicherten Konvoi auf der Hauptfahrbahn durch die Innenstadt. Dabei soll gezeigt werden, wieviel Spaß Radfahren machen kann, wenn genügend Platz und Sicherheit vorhanden sind, und damit auf den nötigen Ausbau von sicheren Geh- und Radwegen in und um Linz und in ganz OÖ hingewiesen werden. Gemeinsame Rundfahrt durch Linz und über die Donaubrücken Der öffentlichkeitswirksame Höhepunkt ist die gemeinsame Rundfahrt um 11 Uhr: Hunderte gutgelaunte RadlerInnen fahren vom Hauptplatz aus für eine Stunde durch Linz. Dies wird die größte fröhlichste Radtour, die Linz je gesehen hat und erstmals über ALLE 3 Donaubrücken führen wird. -

Eindruck Classic Almkönig
Wi esenh o Sc e hie Neudorf 720 ß feg Haslhof tra g 600 er S ettl Imbiss Zw G Buchholz e w er 742 S be p c a e r g h ß Sc e a h i i w r c k n e t e r e s s g s f t t e r s a i e p l w ß l e e u h g a M ü H 707 m g z l e gg t fe u ie S h a c Koth r S - e Wiesen t s w n i e F g e Lindenweg Stamering e w w r n e e d d e n i ß n L a tzstr e g pla k Obergen Sport Freizeitanlage c u e l t Rammersdorf r t i e M b O Davidschlag Bergweg Ring Buchholz straße Ring 574 straße 0 Eic 14 F henwe öhre nweg u a r e e t aß 627 s tr n i S O F Ei r de g f B e b n e 673 r f ern l d w o r do tt e or n d do rfst f e n r e er l rn Ber aße r St h e w g ra ü B B e ß e e Z e K w M r n apellen nd Eidendorf Hofing o g r f s S tr c aß e h Blü a ten u g g e e S Sch e w mi w c ed r n h we k lo g w Z c e s a ö s ss a o tr e g Ge un B aße ühl e en ng 825m l e R rm lw Bücherei e r Lede d Badebiotop b r d b a R Untergeng e o gr r R z i ( 571m) g ul n 566 S g R Hofing L e o ed l Volksschule d ermüh l w n g e erge g 650 nt Neußerling U (594m) E c k s t S e i c f n or 14 e h d rw l n 0 o Stötten r e e g s B s Stötten Oberg s 590 eng t r a ß S583 e ul zgraben g n we e en erberg it m Geng e lu sl B Fe l ls e le F it en pNeußerlingp pOberneukirchenp pZwettl/Rodlp Güt St. -

Die Sackspinnerfauna Des Linzer Stadtgebietes (Lepidoptera: Psychidae)
© Naturkdl. Station Stadt Linz/Austria; download unter www.biologiezentrum.at Naturk. Jb. d. Stadt Linz, Bd. 37 - 39,1994: 231 - 244 231 ERWIN HAUSER DIE SACKSPINNERFAUNA DES LINZER STADTGEBIETES (LEPIDOPTERA: PSYCHIDAE) (4 Abbildungen) Anschrift des Verfassers: Dr. Erwin HAUSER Forschungsgemeinschaft Wilhelminenberg Otto-Koenig-Institut Staning A-443l Haidershofen, Dorf a. d. Enns 69 a THE BAGWORM-MOTH FAUNA OF LINZ, DANUBE (UPPER AUSTRIA) (LEPIDOPTERA: PSYCHIDAE) SUMMARY All available data on bagworms (Psychidae, Lepidoptera) of the urban districts of Linz (Upper Austria) are presented. 22 species have been recorded, their habitats are summari zed critically in a map. Recent data on Psychids are rare, that is in the major part due to the little collecting activities of the recent past. Only few species, which live in warm-dry, little affected habitats, seems to be really endangered. An unusual high number of species, 13, has been recorded from the habitat .Llrfahrwänd". © Naturkdl. Station Stadt Linz/Austria; download unter www.biologiezentrum.at 232 E. HAUSER: Sackspinnerfauna des Linzer Stadtgebietes INHALTSVERZEICHNIS Seite 1. Einleitung. ................................... .. 232 2. Methoden .................................... .. 232 3. Liste der Psychidenarten. ............................ .. 233 4. Der Lebensraum Urfahrwänd ............................ 242 5. Diskussion 243 6. Zusammenfassung. ............................... .. 243 7. Dank 244 8. Literatur ..............................'......... 244 1. EINLEITUNG Die Sackspinner (Psychidae) sind unter den Schmetterlingen eine jener Gruppen, die in Faunenlisten spärlich vertreten sind. Das liegt nicht daran, daß sie so selten wären. Der Grund ist vielmehr ihre versteckte Lebensweise und die Unattraktivität für Schmetterlingsammler, da die Tiere unscheinbar und außerdem schwierig zu determinieren sind. Ziel dieser Arbeit ist eine Zusammenfassung aller Daten sowie eine stich probenartige Bestandsaufnahme von Psychiden in ausgesuchten Le bensräumen. -

Raiffeisen Tarockcup Austria 2019/2020 St
raiffeisen tarockcup austria 2019/2020 http://www.tarockcup.at St. Peter / Wbg. (St. Johann / Wbg.), [email protected] Platz Nr Name Startort R1 R2 R3 Max Total Cup 1 5105 Kurbel Petra Kollerschlag 49 67 73 73 189 223 2 5708 Bohaumilitzky Christa Haslach a.d.M. 15 52 77 77 144 198 3 5461 Bruckner Otto Mag. Linz 57 41 45 57 143 180 4 696 Gartner Friedrich Kirchschlag b.L. 135 -8 15 135 142 168 5 2057 Beneder Sepp Bad Leonfelden -23 -25 184 184 136 156 6 5121 Kaiser Martin Eidenberg 43 56 23 56 122 147 7 4531 Maderthaner Bernd Dr. Weyer 59 16 45 59 120 138 8 2017 Kollik Heinrich Julbach 17 83 18 83 118 131 9 942 Lorenz Ernst Reichenau i.M. 20 48 45 48 113 124 10 2281 Wagner Elfriede Au / Donau 87 -3 22 87 106 117 11 1274 Wartner Herbert Aigen-Schlägl 118 20 -35 118 103 110 12 2121 Manzenreiter Hermann Bad Leonfelden 58 0 36 58 94 105 13 393 Raninger Rudolf Julbach 24 18 51 51 93 100 14 5594 Mittermayr Johann Kleinzell 33 34 26 34 93 95 15 1134 Kling Rudolf Perg 33 39 20 39 92 90 16 100 Gabriel Martin Puchenau 60 19 11 60 90 85 17 75 Enne Richard Gramastetten 31 22 37 37 90 80 18 5502 Spindelböck Irmgard Oepping 50 -30 52 52 72 76 19 430 Schinkinger Hubert Lembach i.M. 10 -22 83 83 71 72 20 5556 Luckeneder Alfred Walding 4 31 32 32 67 68 21 197 Huemer Manfred Bad Leonfelden -25 41 49 49 65 64 22 326 Neumüller Martha St.