Die Vielen Gesichter Des Holocaust
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Hannah Garza, Mechelen, Belgium, January 2016
Understanding the Recent Phenomena of Holocaust Remembrance in the Form of National Holocaust Museums and Memorials in Belgium, France, and Germany Hannah Elizabeth Garza Universiteit van Amsterdam Graduate School of Humanities A thesis submitted for the degree of Masters in Holocaust and Genocide Studies Spring 2017 !1 Abstract This thesis will focus on national Holocaust museums and memorials in Europe, in specific regards to the national Holocaust museums of Belgium and France, and the national Holocaust memorial of Germany. This dissertation will begin with a brief overview of the scholars used within each chapter, along with a discussion on the development of national Holocaust museums in Europe in the introduction chapter. Following the introduction, the first chapter will discuss the Kazerne Dossin Memorial Museum in Mechelen, Belgium. Chapter two will then cover the Mémorial de la Shoah in Paris, France. Finally, chapter three will then focus on the Memorial to the Murdered Jews of Europe in conjunction with its underground information center in Berlin, Germany. This thesis will endeavor to explore the themes represented in each museum in relation to German compliance, and the role of the bystanders from each Nation. The goal is to understand how each of these national institutions discussed within the text, portray their involvement in the events of the Holocaust and Second World War by way of State compliance and the actions of their bystanders. Through the initiatives of the museum and memorials published catalogs, personal -
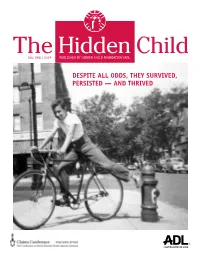
Despite All Odds, They Survived, Persisted — and Thrived Despite All Odds, They Survived, Persisted — and Thrived
The Hidden® Child VOL. XXVII 2019 PUBLISHED BY HIDDEN CHILD FOUNDATION /ADL DESPITE ALL ODDS, THEY SURVIVED, PERSISTED — AND THRIVED DESPITE ALL ODDS, THEY SURVIVED, PERSISTED — AND THRIVED FROM HUNTED ESCAPEE TO FEARFUL REFUGEE: POLAND, 1935-1946 Anna Rabkin hen the mass slaughter of Jews ended, the remnants’ sole desire was to go 3 back to ‘normalcy.’ Children yearned for the return of their parents and their previous family life. For most child survivors, this wasn’t to be. As WEva Fogelman says, “Liberation was not an exhilarating moment. To learn that one is all alone in the world is to move from one nightmarish world to another.” A MISCHLING’S STORY Anna Rabkin writes, “After years of living with fear and deprivation, what did I imagine Maren Friedman peace would bring? Foremost, I hoped it would mean the end of hunger and a return to 9 school. Although I clutched at the hope that our parents would return, the fatalistic per- son I had become knew deep down it was improbable.” Maren Friedman, a mischling who lived openly with her sister and Jewish mother in wartime Germany states, “My father, who had been captured by the Russians and been a prisoner of war in Siberia, MY LIFE returned to Kiel in 1949. I had yearned for his return and had the fantasy that now that Rivka Pardes Bimbaum the war was over and he was home, all would be well. That was not the way it turned out.” Rebecca Birnbaum had both her parents by war’s end. She was able to return to 12 school one month after the liberation of Brussels, and to this day, she considers herself among the luckiest of all hidden children. -

Europe and the World in the Face of the Holocaust
EUROPE AND THE WORLD subject IN THE FACE OF THE HOLOCAUST – PASSIVITY AND COMPLICITY Context6. Societies in all European countries, death camps. Others actively helped the whether fighting against the Germans, Germans in such campaigns ‘in the field’ occupied by or collaborating with them, or carried out in France, the Baltic States, neutral ones, faced an enormous challenge Romania, Hungary, Ukraine and elsewhere. in the face of the genocide committed against Jews: how to react to such an enormous After the German attack on France in June crime? The attitudes of specific nations as well 1940, the country was divided into two zones: as reactions of the governments of the occupied Northern – under German occupation, and countries and the Nazi-free world to the Holocaust Southern – under the jurisdiction of the French continue to be a subject of scholarly interest and state commonly known as Vichy France (La France great controversy at the same time. de Vichy or Le Régime de Vichy) collaborating with the Germans. Of its own accord, the Vichy government Some of them, as noted in the previous work sheet, initiated anti-Jewish legislation and in October guided by various humanitarian, religious, political, 1940 and June 1941 – with consent from head of personal or financial motives, became involved in state Marshal Philippe Petain – issued the Statuts aiding Jews. There were also those, however, who des Juifs which applied in both parts of France and exploited the situation of Jews for material gain, its overseas territories. They specified criteria for engaged in blackmail, denunciation and even determining Jewish origin and prohibited Jews murder. -

2018 Disseminator Grant
2018 Disseminator Grant: Project Title: Unraveling the Past to Create a Better and Inclusive Future Jacqueline Torres-Quinones, Ed.D [email protected] South Dade Senior High School 7701 ONCE I THOUGHT THAT ANTI-SEMITISM HAD ENDED; TODAY IT IS CLEAR TO ME THAT IT WILL PROBABLY NEVER END. - ELIE WIESEL, JEWISH SURVIVOR For Information concerning ideas with Impact opportunities including Adapter and Disseminator grants, please contact: Debra Alamo, interim Program Manager Ideas with Impact The Education Fund 305-558-4544, Ext 105 Email: [email protected] www.educationfund.org Acknowledgment: First and foremost, the Unraveling the Past to Create a Better and Inclusive Future Grant, has led to the development of a practical and relevant Holocaust unit filled with various lessons that can be chunked and accessible resources for secondary teachers to use. The supportive guidance was provide by Eudelio Ferrer-Gari , a social science guru- [email protected] from Dr. Rolando Espinosa K-8 Center, The Echoes and Reflections, and the Anti-Defamation League Organizations. Within this grant, teachers will be able to acquire knowledge of how to help students understand the Holocaust better and assist them to make critical thinking connective decisions as well of how they can make a positive difference today- when dealing with challenging social and political issues. Resources used throughout the grant: Founded in 2005, Echoes & Reflections is a comprehensive Holocaust education program that delivers professional development and a rich array of resources for teachers to help students make connections to the past, gain relevant insight into human dilemmas and difficult social challenges, and to determine their roles and responsibility in the world around them. -

USHMM Finding
https://collections.ushmm.org Contact [email protected] for further information about this collection LINDHEIM FAMILY PAPERS, 1923-2012 2014.206.1 United States Holocaust Memorial Museum Archives 100 Raoul Wallenberg Place SW Washington, DC 20024-2126 Tel. (202) 479-9717 e-mail: [email protected] Descriptive Summary Title: Lindheim family papers Dates: 1923-2012 Accession number: 2014.206.1 Creator: Lindheim family (Frankfurt am Main, Germany) Extent: 7 folders Repository: United States Holocaust Memorial Museum Archives, 100 Raoul Wallenberg Place SW, Washington, DC 20024-2126 Abstract: The Lindheim family papers relate the emigration experiences of the Lindheim family of Frankfurt am Main, Germany in 1939 as well as their efforts to assist other family members to leave Nazi occupied Belgium. The papers include identification documents, affidavits of support, correspondence, memoirs, restitution paperwork, and family photographs. Languages: German, English Administrative Information Access: Collection is open for use, but is stored offsite. Please contact the Reference Desk more than seven days prior to visit in order to request access. Reproduction and use: Collection is available for use. Material may be protected by copyright. Please contact reference staff for further information. Preferred citation: (Identification of item), Lindheim family papers (2014.206.1), United States Holocaust Memorial Museum Archives, Washington, DC. Acquisition information: Fred Lindheim donated the Lindheim family papers to the United States Holocaust Memorial Museum in 2014. Accruals: Accruals may have been received since this collection was first processed, see archives catalog at collections.ushmm.org for further information. Processing history: Katelynn Vance, August 2019 1 https://collections.ushmm.org https://collections.ushmm.org Contact [email protected] for further information about this collection Biographical note Fred Lindheim was born on July 3, 1932 to Berthold Lindheim (1895-1973) and Hertha (née Frankel, 1897-1992) Lindheim in Frankfurt am Main, Germany. -
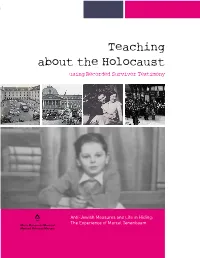
Teaching About the Holocaust Using Recorded Survivor Testimony 1
Teaching about the Holocaust using Recorded Survivor Testimony 1 Teaching about the Holocaust using Recorded Survivor Testimony Anti-Jewish Measures and Life in Hiding: The Experience of Marcel Tenenbaum Reproducible material © Montreal Holocaust Museum, 2018 Reproducible material © Montreal Holocaust Museum, 2018 2 Teaching about the Holocaust using Recorded Survivor Testimony Teaching about the Holocaust using Recorded Survivor Testimony 5151, chemin de la Côte-Ste-Catherine, Montréal (Québec) H3W 1M6 Telephone: 514-345-2605 Fax: 514-344-2651 Email: [email protected] museeholocauste.ca/en/ Produced by the Montreal Holocaust Museum, 2016, 2018. Content and production: Jacqueline Celemenski, Original concept and design Cornélia Strickler, Head of Education Erica Fagen, Education Agent Belle Jarniewski and Stan Carbone, Freeman Family Foundation Holocaust Education Centre of the Jewish Heritage Centre of Western Canada Inc. Tony Tavares, Linda Connor, and Val Noseworthy, Adaptation of pedagogical tool for Manitoba, Manitoba Education and Training Graphic Design: Kina Communication Thank you to Marcel Tenenbaum for sharing his personal stories and to the Oral History Focus Group for assisting in the development of this project. ISBN : 978-2-924632-15-4 (PDF), 978-2-924632-16-1 (print) Legal deposit - Bibliothèque et Archives nationales Québec, 2018 Credits for visual and other primary source documents: Fonds Kummer/ Kazerne Dossin; Bundesarchiv, Bild 146- 1975-021-20 / Pincornelly / CC-BY-SA; Marcel Tenenbaum; Centre for Historical Research and Documentation on War and Contemporary Society. The contents of this guide may be copied and distributed for educational purposes only. Acknowledgements: This project has been made possible in part by the Government of Canada. -

List of Nazi Concentration Camps from Wikipedia, the Free Encyclopedia
Create account Log in Article Talk Read Edit View history List of Nazi concentration camps From Wikipedia, the free encyclopedia Navigation This article needs additional citations for verification. Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed. (October 2009) Main page Contents This article presents a partial list of more prominent Nazi concentration camps set up across Europe during World War II and the Holocaust. A Featured content more complete list drawn up in 1967 by the German Ministry of Justice names about 1,200 camps and subcamps in countries occupied by Nazi Current events Germany,[1] while the Jewish Virtual Library writes: "It is estimated that the Nazis established 15,000 camps in the occupied countries."[2] Most Random article of these camps were destroyed. Donate to Wikipedia The later camps, built by the Third Reich mostly between 1939 and 1942, were intended to hold large groups of prisoners without trial or judicial process, including Jews, gypsies, Slavs, prisoners of war and many others, seen as undesirable by the occupation administration. In modern Interaction historiography, the term refers to a place of mistreatment, starvation, forced labour, and murder. Some of the data presented in this table originates from The War Against the Jews by Lucy Dawidowicz.[3] Help About Wikipedia Contents Community portal 1 Table Recent changes 2 See also Contact Wikipedia 3 References 4 Bibliography Toolbox 5 External links What links here Related changes Table [edit] Upload file Extermination camps are marked with light red, Concentration camps are marked with light blue, Labour camps are marked with gray, while Special pages Transit camps and Collective points remain unmarked. -

To Honor All Children File4.Pdf
528 Unit VI: Survival, Liberation, and Legacy Unit Goal: The students will recognize and demonstrate empathy for the immensity of the human destruction caused by the Holocaust, for the determination and courage required to go on to build new lives, and for the world's struggle to confront the issues of genocide and moral responsibility to act as "rescuer." Performance Objectives Teaching/Learning Strategies and Activities Instructional Materials/Resources Students will be able to: 1. Discuss the liberation of the camps and A. Survival, Liberation, and Legacy the role of the liberators as witnesses in the post war world. B. Survival and Liberation 2. Analyze and discuss the unique role of 1. "Armageddon Revisited: from the 1. "Armageddon Revisited…" by Paul Zell. those Jews who had escaped their Nazi Holocaust to D-Day, A Survivor's/ Two readings from his personal memoirs persecutors and later returned as Liberator's Tale" by Paul Zell. Two are included in the guide. liberators. readings included in guide with lessons. Paul Zell was a young boy in Vienna, Austria when Kristallnacht convinced his father that the family 2. Visit Internet web sites listed in lesson in had to find a way out of Austria. Later, guide for additional information about living in the United States, Zell returns rescue and liberation. to Europe as a member of the U.S. Army. In the second reading, Zell describes his arrival at Buchenwald and the impact that it has upon him. 2. Liberation: Teens In Concentration 3. Reading selected from a volume of the Camps and the Teen Soldiers Who series Teen Witnesses to the Holocaust. -
Claims Resolution Tribunal
CLAIMS RESOLUTION TRIBUNAL In re Holocaust Victim Assets Litigation Case No. CV96-4849 Certified Award to the Estate of Claimant [REDACTED 1]1 to Claimant [REDACTED 2] represented by Arie Davidovici to Claimant [REDACTED 3] and to Claimant [REDACTED 4] in re Account of F. Burger Claim Numbers: 204456/MBC; 204458/MBC; 204930/MBC; 207779/MBC; 212064/MBC;2 707811/MBC;3 727937/MBC; 727987/MBC4 Award Amount: 49,375.00 Swiss Francs This Certified Award is based upon the claim of Ivan Zoltan Burger ( Claimant Ivan Burger ) to the accounts of Dezso Burger and Ivan Burger;5 the claim of Sandor Burger ( Claimant Sandor Burger ) to the accounts of Ignacz Burger and Sandor Burger;6 the claim of [REDACTED 4], née [REDACTED] ( Claimant [REDACTED 4] ), to the account of Oskar Burger;7 and the 1 In a telephone call with the CRT, the wife of Claimant [REDACTED 1] ( Claimant [REDACTED 1] ) informed the CRT that her husband passed away on 19 October 2005. 2 Claimant [REDACTED 4] ( Claimant [REDACTED 4] ) submitted two Claim Forms, which were registered under the Claim Numbers 212064 and 300017. The CRT has determined that these claims are duplicate claims and is treating them under the consolidated Claim Number 212064. 3 In 1999 Claimant [REDACTED 2] ( Claimant [REDACTED 2] ) submitted an Initial Questionnaire ( IQ ), numbered FRE-0020117, to the Court in the United States. Although this IQ was not a Claim Form, the Court, in an Order signed on 30 July 2001, ordered that those IQs which can be processed as claim forms be treated as timely claims. -
Holocaust and Jewish Resistance Teachers' Program Summer 2014
Holocaust and Jewish Resistance Teachers’ Program Summer 2014 Documents Holocaust and Jewish Resistance Teachers’ Program American Gathering of Holocaust Survivors and Their Descendants 122 W 30th St # 205 New York, NY 10001-4009 (212) 239-4230 www.hajrtp.org June – July 2014 Program Directors Elaine Culbertson Stephen Feinberg COPYRIGHT NOTICE The Content here is provided under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License (“CCPL” or “license”). This Content is protected by copyright and/or other applicable law. Any use of the Content other than as authorized under this license or copyright law is prohibited. By exercising any rights to the work provided here, you accept and agree to be bound by the terms of this license. To the extent this license may be considered to be a contract, the licensor grants you the rights contained here in consideration of your acceptance of such terms and conditions. Under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License, you are invited to copy, distribute and/or modify the Content, and to use the Content here for personal, educational, and other noncommercial purpose on the following terms: • You must cite the author and source of the Content as you would material from any printed work. • You must also cite and link to, when possible, the website as the source of the Content. • You may not remove any copyright, trademark, or other proprietary notices, including attribution, information, credits, and notices that are placed in or near the Content. • You must comply with all terms or restrictions other than copyright (such as trademark, publicity, and privacy rights, or contractual restrictions) as may be specified in the metadata or as may otherwise apply to the Content. -

Teaching About the Holocaust Using Recorded Survivor Testimony 1
Teaching about the Holocaust using Recorded Survivor Testimony 1 Teaching about the Holocaust using Recorded Survivor Testimony Anti-Jewish Measures and Life in Hiding: The Experience of Marcel Tenenbaum Reproducible material © Montreal Holocaust Museum, 2018 Reproducible material © Montreal Holocaust Museum, 2018 2 Teaching about the Holocaust using Recorded Survivor Testimony Teaching about the Holocaust using Recorded Survivor Testimony 5151, Côte-Sainte-Catherine Road (Maison Cummings) Montreal (Quebec) H3W 1M6 Canada Telephone: 514-345-2605 Fax: 514-344-2651 Email: [email protected] http://museeholocauste.ca/en/ Produced by the Montreal Holocaust Museum, 2016, 2018. Content and production: Jacqueline Celemenski, Original concept Cornélia Strickler, Head of Education Erica Fagen, Education Agent Graphic Design: Fabian Will and Kina Communication Thank you to Marcel Tenenbaum for sharing his personal stories and to the Oral History Focus Group for assisting in the development of this project. ISBN : 978-2-924632-50-5 (PDF), 978-2-924632-49-9 (print) Legal Deposit - Bibliothèque et Archives nationales Québec, 2018 Credits for visual and other primary source documents: Fonds Kummer/ Kazerne Dossin; Bundesarchiv, Bild 146- 1975-021-20 / Pincornelly / CC-BY-SA; Marcel Tenenbaum; Centre for Historical Research and Documentation on War and Contemporary Society. The contents of this guide may be copied and distributed for educational purposes only. Acknowledgements: This project has been made possible in part by the Government of Canada. -

Military History Anniversaries 0501 Thru 051519
Military History Anniversaries 1 thru 15 May Events in History over the next 15 day period that had U.S. military involvement or impacted in some way on U.S military operations or American interests May 01 1778 – American Revolution: The Battle of Crooked Billet begins in Hatboro, PA » On 1 JAN John Lacey was appointed brigadier-general and given command of a large body of militia with the aim of interrupting British supply lines, especially those reaching Philadelphia. Crooked Billet was the Headquarters of Lacey, and became the target of the British commander in Philadelphia, Gen. William Howe. Lacey had been charged with patrolling the area north of Philadelphia, between the Delaware and Schuylkill Rivers, with responsibility for warning Valley Forge of attacks, checking British foraging raids, and preventing local trade with the British. Most of the enlistments of the few troops he had were due to expire shortly. Promised, and desperately needed, reinforcements were slow arriving or simply not coming. The British dispatched a joint force of British troops and Hessians on 30 APR and they surprised the American forces whose commander was still in bed. The British had surprised the Americans and attempted to cut them off with a "pincer" type movement. Bands of Loyalists and British horsemen grew increasingly bold, and their raids into Lacey's sector were becoming more frequent. On 1 MAY, during the morning, Lacey found his camp near the Crooked Billet Tavern virtually surrounded by the British. Though outnumbered, Lacey rallied his troops during the initial attack and was able to withdraw to a nearby wooded area and make a stand.