Zum Virtuellen Parteitag 2020
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Deutscher Bundestag
Deutscher Bundestag 239. Sitzung des Deutschen Bundestages am Dienstag, 7. September 2021 Endgültiges Ergebnis der Namentlichen Abstimmung Nr. 1 Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD Entwurf eines Gesetzes zur Errichtung eines Sondervermögens "Aufbauhilfe 2021" und zur vorübergehenden Aussetzung der Insolvenzantragspflicht wegen Starkregenfällen und Hochwassern im Juli 2021 sowie zur Änderung weiterer Gesetze (Aufbauhilfegesetz 2021 - AufbhG 2021) in der Ausschussfassung hier: Artikel 12 (Änderung des Infektionsschutzgesetzes) Artikel 13 (Einschränkung von Grundrechten) Drs. 19/32039 und 19/32275 Abgegebene Stimmen insgesamt: 625 Nicht abgegebene Stimmen: 84 Ja-Stimmen: 344 Nein-Stimmen: 280 Enthaltungen: 1 Ungültige: 0 Berlin, den 07.09.2021 Beginn: 14:35 Ende: 15:05 Seite: 1 Seite: 2 Seite: 2 CDU/CSU Name Ja Nein Enthaltung Ungült. Nicht abg. Dr. Michael von Abercron X Stephan Albani X Norbert Maria Altenkamp X Peter Altmaier X Philipp Amthor X Artur Auernhammer X Peter Aumer X Dorothee Bär X Thomas Bareiß X Norbert Barthle X Maik Beermann X Manfred Behrens (Börde) X Veronika Bellmann X Sybille Benning X Dr. André Berghegger X Melanie Bernstein X Christoph Bernstiel X Peter Beyer X Marc Biadacz X Steffen Bilger X Peter Bleser X Norbert Brackmann X Michael Brand (Fulda) X Dr. Reinhard Brandl X Dr. Helge Braun X Silvia Breher X Sebastian Brehm X Heike Brehmer X Ralph Brinkhaus X Dr. Carsten Brodesser X Gitta Connemann X Astrid Damerow X Alexander Dobrindt X Michael Donth X Marie-Luise Dött X Hansjörg Durz X Thomas Erndl X Dr. Dr. h. c. Bernd Fabritius X Hermann Färber X Uwe Feiler X Enak Ferlemann X Axel E. -

(Jens Spahn), Ralph Brinkhaus
Sondierungsgruppen Finanzen/Steuern CDU: Peter Altmaier (Jens Spahn), Ralph Brinkhaus CSU: Markus Söder, Hans Michelbach SPD: Olaf Scholz, Carsten Schneider Wirtschaft/Verkehr/Infrastruktur/Digitalisierung I/Bürokratie CDU: Thomas Strobl, Carsten Linnemann CSU: Alexander Dobrindt, Ilse Aigner, Peter Ramsauer SPD: Thorsten Schäfer-Gümbel, Anke Rehlinger, Sören Bartol Energie/Klimaschutz/Umwelt CDU: Armin Laschet, Thomas Bareiß CSU: Thomas Kreuzer, Georg Nüßlein, Ilse Aigner SPD: Stephan Weil, Matthias Miersch Landwirtschaft/Verbraucherschutz CDU: Julia Klöckner, Gitta Connemann CSU: Christian Schmidt, Helmut Brunner SPD: Anke Rehlinger, Rita Hagel Bildung/Forschung CDU: Helge Braun, Michael Kretschmer CSU: Stefan Müller, Ludwig Spaenle SPD: Manuela Schwesig, Hubertus Heil Arbeitsmarkt/Arbeitsrecht/Digitalisierung II CDU: Helge Braun, Karl-Josef Laumann CSU: Stefan Müller, Emilia Müller SPD: Andrea Nahles, Malu Dreyer Familie/Frauen/Kinder/Jugend CDU: Annegret Kramp-Karrenbauer, Nadine Schön CSU: Angelika Niebler, Paul Lehrieder SPD: Manuela Schwesig, Katja Mast Soziales/Rente/Gesundheit/Pflege CDU: Annegret Kramp-Karrenbauer, Hermann Gröhe, Sabine Weiss CSU: Barbara Stamm, Melanie Huml, Stephan Stracke SPD: Malu Dreyer, Andrea Nahles, Karl Lauterbach Migration/Integration CDU: Volker Bouffier, Thomas de Maizière CSU: Joachim Herrmann, Andreas Scheuer SPD: Ralf Stegner, Boris Pistorius Innen/Recht CDU: Thomas Strobl, Thomas de Maizière CSU: Joachim Herrmann, Stephan Mayer SPD: Ralf Stegner, Eva Högl Kommunen/Wohnungsbau/Mieten/ländlicher -

Mr Josep Borrell Vice-President of the European Commission High Representative of the Union for the CFSP Rue De La Loi 170 1000 Brussels
Mr Josep Borrell Vice-President of the European Commission High Representative of the Union for the CFSP Rue de la Loi 170 1000 Brussels Brussels, 16th April 2021 Dear Mr. High Representative; Mr Vice-President of the Commission: A delegation from the illegitimate National Assembly of the Bolivarian Republic of Venezuela, which emerged from the electoral farce organised on 6th December 2020 by the regime of Nicolás Maduro, recently paid a visit to Brussels and was officially received by the institution you lead. According to a statement you made on behalf of the European Union on 6th December, this spurious process took place in the absence of electoral conditions that could have guaranteed its credibility, without any respect for political pluralism, and in an atmosphere of persecution and disqualification of democratic leaders whose legitimate rights were curtailed. Your statement concludes that such circumstances could not consider this process credible, inclusive, and transparent and therefore the results did not represent the will of the Venezuelan people. That initial statement was confirmed on 6 January of this year by a new declaration, in similar terms to those expressed on 6 December, and by the conclusions of the Foreign Affairs Council of 25 January. These reiterated the lack of recognition of the electoral process and regretted the behaviour of the authorities of the Maduro regime, whose actions are preventing a solution to the serious crisis in Venezuela. We were surprised and gravely concerned to learn that on 14th April, at your request, senior officials of the European External Action Service received the aforementioned delegation, comprising Iris Varela, Pedro Carreño and Desirée Santos Amaral, at the EEAS headquarters. -

Deutscher Bundestag
Deutscher Bundestag 44. Sitzung des Deutschen Bundestages am Freitag, 27.Juni 2014 Endgültiges Ergebnis der Namentlichen Abstimmung Nr. 4 Entschließungsantrag der Abgeordneten Caren Lay, Eva Bulling-Schröter, Dr. Dietmar Bartsch, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. zu der dritten Beratung des Gesetzentwurfs der Bundesregierung Entwurf eines Gesetzes zur grundlegenden Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes und zur Änderung weiterer Bestimmungen des Energiewirtschaftsrechts - Drucksachen 18/1304, 18/1573, 18/1891 und 18/1901 - Abgegebene Stimmen insgesamt: 575 Nicht abgegebene Stimmen: 56 Ja-Stimmen: 109 Nein-Stimmen: 465 Enthaltungen: 1 Ungültige: 0 Berlin, den 27.06.2014 Beginn: 10:58 Ende: 11:01 Seite: 1 Seite: 2 Seite: 2 CDU/CSU Name Ja Nein Enthaltung Ungült. Nicht abg. Stephan Albani X Katrin Albsteiger X Peter Altmaier X Artur Auernhammer X Dorothee Bär X Thomas Bareiß X Norbert Barthle X Julia Bartz X Günter Baumann X Maik Beermann X Manfred Behrens (Börde) X Veronika Bellmann X Sybille Benning X Dr. Andre Berghegger X Dr. Christoph Bergner X Ute Bertram X Peter Beyer X Steffen Bilger X Clemens Binninger X Peter Bleser X Dr. Maria Böhmer X Wolfgang Bosbach X Norbert Brackmann X Klaus Brähmig X Michael Brand X Dr. Reinhard Brandl X Helmut Brandt X Dr. Ralf Brauksiepe X Dr. Helge Braun X Heike Brehmer X Ralph Brinkhaus X Cajus Caesar X Gitta Connemann X Alexandra Dinges-Dierig X Alexander Dobrindt X Michael Donth X Thomas Dörflinger X Marie-Luise Dött X Hansjörg Durz X Jutta Eckenbach X Dr. Bernd Fabritius X Hermann Färber X Uwe Feiler X Dr. Thomas Feist X Enak Ferlemann X Ingrid Fischbach X Dirk Fischer (Hamburg) X Axel E. -

Verbandsnachrichten 1/2020
VERBANDSNACHRICHTEN AUSGABE 1 | 2020 AUS DEM HAMBURGER VERBAND 54. Steuerberaterball im Hotel Atlantic, S. 6 BERUFSAUSÜBUNG Musterverfahrensdokumentation Mobiles Scannen, S. 29 BERUFSRECHT Anpassungen im Berufsrecht der Steuerberater, S. 38 Das Magazin des Steuerberaterverbandes Hamburg Was Steuerberater heute so im Kopf haben? CHIPS Denn mit Software-Lösungen von Agenda geht die tägliche Arbeit ganz leicht von der Hand. So haben Sie vor allem eines im Kopf: den Erfolg Ihrer Mandanten. Zum Beispiel den des IT-Start-ups und wie es am besten von ö entlichen Fördergeldern pro tiert. agenda-steuerberater.de 11:46:10 STEUERBERATERVERBAND HAMBURG INHALTSVERZEICHNIS AUS DEM HAMBURGER VERBAND Schadenersatz wegen verzögerter Mandatsbearbeitung? 42 54. Steuerberaterball im Hotel Atlantic 6 Beurteilung der SV-Pflicht von Geschäftsführern durch StB 42 Der Verband spendet Erlös der Steuerberaterball-Tombola 11 Übermittlung gemeinsamer Steuererklärungen bei fehlender Zustimmung eines Ehegatten Bezirksgruppen stellen sich vor – Bezirksgruppe Ost 12 42 Abrechnungsfragen bei interdisziplinären Kanzleien Gehen Sie am 16. August 2020 an den Start der 46 25. EuroEyes Cyclassics im Team „Steuerberaterverband HH“ 13 STEUERRECHT Einladung zur 17. Norddeutschen Steuer-Open 2020 13 Steuerfreie Veräußerung von Kapitallebensversicherungen 56. Steuerrechtliches Seminar Westerland auf dem Zweitmarkt 49 07. bis 14. September 2020 14 Untergang von Gewerbeverlusten bei Betriebsverpachtung 49 Vom Vorstand und der Geschäftsführung wahrgenommene Finanzgericht Hamburg Termine -

An Den Parteitag 2019
Anträge an den Parteitag 2019 85. Parteitag der Christlich-Sozialen Union 18./19. Oktober 2019, München 2 Herausgeber: CSU-Landesleitung, Franz Josef Strauß-Haus Mies-van-der-Rohe-Str. 1, 80807 München Verantwortlich: Dr. Carolin Schumacher, Hauptgeschäftsführerin der CSU Redaktion: Werner Bumeder, Florian Bauer, Karin Eiden, Isabella Hofmann Auflage: Oktober 2019 (Stand: 04.10.2019) 3 4 Zusammensetzung der Antragskommission 2019 Stefan Müller, MdB Parlamentarischer Geschäftsführer der CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag, Vorsitzender der Antragskommission Dr. Markus Söder, MdL Bayerischer Ministerpräsident, Vorsitzender der CSU Markus Blume, MdL Generalsekretär der CSU Florian Hahn, MdB Stellvertretender Generalsekretär der CSU, Vorsitzender der Arbeitsgruppe Angelegenheiten der Europäischen Union in der CDU/CSU-Fraktion Dr. Carolin Schumacher Hauptgeschäftsführerin der CSU Dorothee Bär, MdB Stellvertretende Vorsitzende der CSU, Staatsministerin im Bundeskanzleramt, Beauftragte der Bundesregierung für Digitalisierung Dr. Kurt Gribl Stellvertretender Vorsitzender der CSU, Oberbürgermeister der Stadt Augsburg Melanie Huml, MdL Stellvertretende Vorsitzende der CSU, Bayerische Staatsministerin für Gesundheit und Pflege Dr. Angelika Niebler, MdEP Stellvertretende Vorsitzende der CSU, Vorsitzende der CSU-Europagruppe Manfred Weber, MdEP Stellvertretender Vorsitzender der CSU, Vorsitzender der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament 5 Alexander Dobrindt, MdB Vorsitzender der CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag, Erster Stellvertretender -

Paper: the Political Economy of Germany in the Sovereign Debt Crisis
The Political Economy of Germany in the Sovereign Debt Crisis Daniela Schwarzer German Institute for International and Security Affairs (SWP) Paper prepared for Resolving the European Debt Crisis, a conference hosted by the Peterson Institute for International Economics and Bruegel, Chantilly, France, September 13-14, 2011. 1. The German Economic Situation Economic Growth Perspectives and Employment After the downturn in 2008–09, there has been a strong economic recovery in Germany in 2010 and the first half of 2011. But in the context of an economic deceleration expected for the OECD countries, also the German economy will probably slow down considerably in the second half of 2011 and in 2012. Export growth is likely to weaken as key export markets cool down, partly due to fiscal tightening in Germany’s main trading partners. Export growth scored a high 14.4 percent in 2010 and is likely to decelerate to 8 percent in 2011, as a consequence of fiscal tightening and the flattening of the stock cycle in most major markets. Meanwhile, import growth is expected to decrease from 12.8 percent in 2010 to a still strong 6.6 percent in 2011. Domestic demand is also expected to decline as consumers and business are becoming more cautious. Private consumption growth is forecast to accelerate to 1.6 percent in 2011 from 0.4 percent in 2010, but will then stay at around 1.4 percent on average in 2012 to 2015. Employment is expected to expand which will support domestic demand, but real wages are expected to grow only slowly. -

Plenarprotokoll 19/229
Plenarprotokoll 19/229 Deutscher Bundestag Stenografischer Bericht 229. Sitzung Berlin, Mittwoch, den 19. Mai 2021 Inhalt: Erweiterung und Abwicklung der Tagesord- Stefan Keuter (AfD) . 29247 C nung . 29225 B Olaf Scholz, Bundesminister BMF . 29247 C Absetzung der Tagesordnungspunkte 8, 9, 10, Stefan Keuter (AfD) . 29247 D 16 b, 16 e, 21 b, 33, 36 und 39 . 29230 C Olaf Scholz, Bundesminister BMF . 29247 D Ausschussüberweisungen . 29230 D Sepp Müller (CDU/CSU) . 29248 A Feststellung der Tagesordnung . 29232 B Olaf Scholz, Bundesminister BMF . 29248 B Sepp Müller (CDU/CSU) . 29248 C Zusatzpunkt 1: Olaf Scholz, Bundesminister BMF . 29248 C Aktuelle Stunde auf Verlangen der Fraktio- Christian Dürr (FDP) . 29248 D nen der CDU/CSU und SPD zu den Raketen- angriffen auf Israel und der damit verbun- Olaf Scholz, Bundesminister BMF . 29249 A denen Eskalation der Gewalt Christian Dürr (FDP) . 29249 B Heiko Maas, Bundesminister AA . 29232 B Olaf Scholz, Bundesminister BMF . 29249 C Armin-Paulus Hampel (AfD) . 29233 C Dr. Wieland Schinnenburg (FDP) . 29250 A Dr. Johann David Wadephul (CDU/CSU) . 29234 C Olaf Scholz, Bundesminister BMF . 29250 A Alexander Graf Lambsdorff (FDP) . 29235 C Dorothee Martin (SPD) . 29250 B Dr. Gregor Gysi (DIE LINKE) . 29236 C Olaf Scholz, Bundesminister BMF . 29250 B Omid Nouripour (BÜNDNIS 90/ Dorothee Martin (SPD) . 29250 C DIE GRÜNEN) . 29237 C Olaf Scholz, Bundesminister BMF . 29250 D Dirk Wiese (SPD) . 29238 C Lisa Paus (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) . 29250 D Dr. Anton Friesen (AfD) . 29239 D Olaf Scholz, Bundesminister BMF . 29251 A Jürgen Hardt (CDU/CSU) . 29240 B Dr. Gesine Lötzsch (DIE LINKE) . 29251 C Kerstin Griese (SPD) . -

0508 1 MINUTES Meeting of 8 May 2012, from 9.00 to 12.30 And
EUROPEAN PARLIAMENT 2009 - 2014 Committee on the Internal Market and Consumer Protection IMCO_PV(2012)0508_1 MINUTES Meeting of 8 May 2012, from 9.00 to 12.30 and from 15.00 to 18.30 BRUSSELS The meeting opened at 9:13 on Tuesday 8 May 2012, with Malcolm Harbour (Chair) in the chair. 1. Adoption of agenda The agenda was adopted in the order shown in these minutes. 2. Chair’s announcements The Chair informed the Members that the meeting is webstreamed live. 3. Approval of minutes of meetings of: 12 April 2012 PV – PE487.702v01-00 ------ 4. 20 main concerns of European citizens and business with the functioning of the Single Market IMCO/7/07622 2012/2044(INI) SEC(2011)1003 Rapporteur: Regina Bastos (PPE) PR – PE483.745v01-00 AM – PE487.715v01-00 Responsible: IMCO – Opinions: ECON, EMPL, ITRE, TRAN, CULT, JURI, PETI Consideration of amendments Speakers: Malcolm Harbour (ECR), Regina Bastos (EPP), Emma McClarkin (ECR), Heide Rühle (Greens/EFA), Barbara Weiler (S&D), Andreas Schwab (EPP), Jacek Golinski (European Commission, DG MARKT) PV\900956EN.doc PE488.051v01-00 EN United in diversity EN ------ 5. Consumer programme 2014-2020 IMCO/7/07737 ***I 2011/0340(COD) COM(2011)0707 – C7-0397/2011 Rapporteur: Robert Rochefort (ALDE) PR – PE486.107v01-00 Responsible: IMCO – Opinions: BUDG – José Manuel Fernandes PA – PE487.806v01-00 (PPE) JURI – Cecilia Wikström (ALDE) PA – PE487.762v01-00 Consideration of draft report Deadline for tabling amendments: 14 May 2012, 12.00 Speakers: Robert Rochefort (ALDE), Zuzana Roithová (EPP), María Irigoyen Pérez (S&D), Heide Rühle (Greens/EFA), Malcolm Harbour (ECR), Jacqueline Minor (European Commission, DG SANCO) ------ 6. -

Arbeitsbericht Der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 2012
Für ein starkes Deutschland und Europa Arbeitsbericht der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag 2012 Für ein starkes Deutschland und Europa Arbeitsbericht der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag 2012 Inhalt 4 Vorwort 60 Gut zu wissen Deutschland bleibt vorn Zahlen und Fakten aus der Fraktionsbilanz 8 Weichen für eine europäische 62 Weitere Informationen Stabilitätsunion sind gestellt zu ausgewählten Politikfeldern 16 Lehren aus der Krise: 63 Veranstaltungen Finanzmarktregulierung auf gutem Weg 66 Fraktionsvorstand 20 Ausgeglichener Bundeshaushalt schon Geschäftsführender Vorstand in Reichweite Arbeitsgruppen Soziologische Gruppen und Beisitzer 24 Energiewende meistern – Umwelt schonen 70 Weitere Gremien 28 Gegen den Trend: Wirtschaft und Beauftragte des Vorsitzenden Arbeitsmarkt florieren Landesgruppen Gremien des Bundestages 36 Wahlfreiheit für Eltern – soziale Sicherheit auch in der Zukunft 73 237 CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete 40 Den ländlichen Raum lebenswert halten 75 Kontakt 48 Das Urheberrecht muss auch im digitalen Zeitalter gelten 76 Impressum 52 Freiheit und Sicherheit in einer vernetzten und globalisierten Welt 56 Freiheit, Demokratie und Menschenrechte achten Volker Kauder Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 4 Vorwort Vorwort Deutschland bleibt vorn Wir können stolz auf unser Land und die Leis- hier völlig einig. An dieser Stelle möchte ich tungen seiner Bürger sein. Trotz der Euro-Staats- meiner Ersten Stellvertreterin Gerda Hassel- schuldenkrise ist Deutschland stark geblieben. feldt ausdrücklich für ihren Einsatz danken, Die Menschen haben Arbeit. Der Staat und vor die Fraktion gerade in diesen schwierigen allem unsere sozialen Sicherungssysteme ver- Fragen immer wieder zusammenzuführen. fügen über ein stabiles finanzielles Fundament. Die deutsche Wirtschaft wächst stetig. Wo ist Wir helfen unseren europäischen Freunden, dies sonst noch in Europa so der Fall? wenn sie in Not sind. -
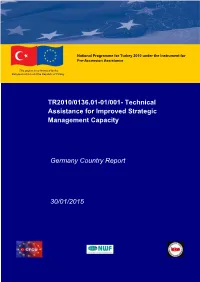
TR2010/0136.01-01/001- Technical Assistance for Improved Strategic
National Programme for Turkey 2010 under the Instrument for Pre-Accession Assistance This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey TR2010/0136.01-01/001- Technical Assistance for Improved Strategic Management Capacity Germany Country Report 30/01/2015 1 Table of Contents Page 1. General Information 4 1.1. Sources and Aims 4 1.2. Structural Aspects of the German State 4 1.3. Area and Population 7 1.4. GDP and Financial and Budgetary Situation 10 1.5. Main Economic and Commercial Characteristics 12 2. Government and Public Administration of the Federal Level 15 2.1. Federal Constitutional Structure (head of state, head of government, parliament, judiciary) 15 2.2. Central Bodies (chancellor, ministers) 16 2.3. Public Administration 17 2.3.1. Public Administration: employees 17 2.3.2. Public Administration: assessment and training 19 2.4. Reforms to the Structure of Government (past, in progress, planned) 22 3. Four Examples of Länder/Federal States (according to size, history, economic structure and geographic direction) 26 3.1. Baden-Württemberg - General Structure 28 3.1.1. Government and Public Administration 28 3.1.2. Reforms 30 3.2. Brandenburg - General Structure 32 3.2.1. Government and Public Administration 32 3.2.2. Reforms 33 3.3. Lower Saxony - General Structure 34 3.3.1. Government and Public Administration 35 3.3.2. Reforms 36 3.4. Saarland - General Structure 38 3.4.1. Government and Public Administration 38 3.4.2. Reforms 39 4. Strategic Planning and Public Budgeting 41 4.1. -

Deutscher Bundestag
Deutscher Bundestag 228. Sitzung des Deutschen Bundestages am Freitag, 7. Mai 2021 Endgültiges Ergebnis der Namentlichen Abstimmung Nr. 1 Änderungsantrag der Abgeordneten Christian Kühn (Tübingen), Daniela Wagner, Britta Haßelmann, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zu der zweiten Beratung des Gesetzentwurfs der Bundesregierung Drs. 19/24838, 19/26023, 19/29396 und 19/29409 Entwurf eines Gesetzes zur Mobilisierung von Bauland (Baulandmobilisierungsgesetz) Abgegebene Stimmen insgesamt: 611 Nicht abgegebene Stimmen: 98 Ja-Stimmen: 114 Nein-Stimmen: 431 Enthaltungen: 66 Ungültige: 0 Berlin, den 07.05.2021 Beginn: 12:25 Ende: 12:57 Seite: 1 Seite: 2 Seite: 2 CDU/CSU Name Ja Nein Enthaltung Ungült. Nicht abg. Dr. Michael von Abercron X Stephan Albani X Norbert Maria Altenkamp X Peter Altmaier X Philipp Amthor X Artur Auernhammer X Peter Aumer X Dorothee Bär X Thomas Bareiß X Norbert Barthle X Maik Beermann X Manfred Behrens (Börde) X Veronika Bellmann X Sybille Benning X Dr. André Berghegger X Melanie Bernstein X Christoph Bernstiel X Peter Beyer X Marc Biadacz X Steffen Bilger X Peter Bleser X Norbert Brackmann X Michael Brand (Fulda) X Dr. Reinhard Brandl X Dr. Helge Braun X Silvia Breher X Sebastian Brehm X Heike Brehmer X Ralph Brinkhaus X Dr. Carsten Brodesser X Gitta Connemann X Astrid Damerow X Alexander Dobrindt X Michael Donth X Marie-Luise Dött X Hansjörg Durz X Thomas Erndl X Dr. Dr. h. c. Bernd Fabritius X Hermann Färber X Uwe Feiler X Enak Ferlemann X Axel E. Fischer (Karlsruhe-Land) X Dr. Maria Flachsbarth X Thorsten Frei X Dr. Hans-Peter Friedrich (Hof) X Maika Friemann-Jennert X Michael Frieser X Hans-Joachim Fuchtel X Ingo Gädechens X Dr.