Dissertation
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
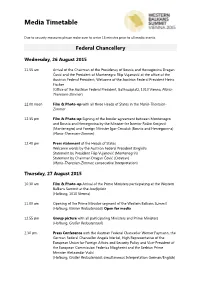
Media Timetable
Media Timetable Due to security measures please make sure to arrive 15 minutes prior to all media events. Federal Chancellery Wednesday, 26 August 2015 11.55 am Arrival of the Chairman of the Presidency of Bosnia and Hercegovina Dragan Čović and the President of Montenegro Filip Vujanović at the office of the Austrian Federal President; Welcome of the Austrian Federal President Heinz Fischer (Office of the Austrian Federal President, Ballhausplatz, 1010 Vienna, Maria- Theresien-Zimmer) 12.00 noon Film & Photo-op with all three Heads of States in the Maria-Theresien- Zimmer 12.35 pm Film & Photo-op Signing of the border agreement between Montenegro and Bosnia and Hercegovina by the Minister for Interior Raško Konjević (Montenegro) and Foreign Minister Igor Crnadak (Bosnia and Herzegowina) (Maria-Theresien-Zimmer) 12.40 pm Press statement of the Heads of States Welcome words by the Austrian Federal President (English) Statement by President Filip Vujanović (Montenegrin) Statement by Chairman Dragan Čović (Croatian) (Maria-Theresien-Zimmer; consecutive Interpretation) Thursday, 27 August 2015 10.30 am Film & Photo-op Arrival of the Prime Ministers participating at the Western Balkans Summit at the Josefsplatz (Hofburg, 1010 Vienna) 11.00 am Opening of the Prime Minister segment of the Western Balkans Summit (Hofburg, Kleiner Redoutensaal) Open for media 12.55 pm Group picture with all participating Ministers and Prime Ministers (Hofburg, Großer Redoutensaal) 2.30 pm Press Conference with the Austrian Federal Chancellor Werner Faymann, the -

Österreich Hat Eine Bundeskanzlerin
Ausg. Nr. 185 • 5. Juni 2019 Das unparteiische, un ab hängige Ma ga - zin für Österrei cherinnen und Österrei - cher in aller Welt erscheint zehn Mal im Jahr in vier verschiedenen pdf-Formaten http://www.oesterreichjournal.at Österreich hat eine Bundeskanzlerin Foto: HBF / Carina Karlovits Peter Lechner Foto: HBF Die bisherige Verfassungsgerichtshof-Präsidentin Brigitte Bierlein – im Bild mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen – wird nach Enthebung der ÖVP/FPÖ- Koalitionsregierung mit ihrer Regierungsmannschaft bis zur Einsetzung einer im September neu zu wählenden Bundesregierung unser Land nach innen und außen repräsentieren. Seite 46 Sie sehen hier die Variante A4 mit 72 dpi und geringer Qualität von Bildern und Grafiken ÖSTERREICH JOURNAL NR. 185 / 05. 06. 2019 2 Die Seite 2 Liebe LeserInnen, liebe Landsleute, während wir an der vorliegenden Ausgabe gearbeitet haben, ist uns die Regierung „abhandengekommen“. Das bedeutet, daß in einigen Beiträgen über Regierungsmitglieder berichtet wird, die zum Zeitpunkt unseres Er- scheinens nicht mehr ihre Funktionen innehatten. Apropos Regierung: ab der Seite 46 fassen wir zusammen, wie es zum Bruch der Koaltionsregierung gekommen ist und zeichnen den Weg bis zur Angelo- Wahl zum Europäischen Parlament 3 bung der Übergangsregierung unter Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein nach. Liebe Grüße aus Wien Michael Mössmer Der Inhalt der Ausgabe 185 Wahl zum EU-Parlament 2019 3 Tourismusforum Burgenland 69 Van der Bellen trifft Putin 11 »Blaufränkischland pur« Kampf gegen Antisemitismus stündlich Wien/Deutschkreutz 70 als zentrales Anliegen 13 Eisenstadts Bürgerbudget 71 Neuwahl im September 46 Fest der Freude 15 FH Burgenland: erste Promotion 72 Aus dem Außenministerium 18 Jo und der krumme Teufel 73 Europa ist ein Europa der Regionen 23 ORF: »Die große Burgenland Tour« 74 UNESCO-Welterbe Präsentation 24 Salon Europa Forum Wachau 25 Die Zauberflöte in St. -

Dissertation / Doctoral Thesis
DISSERTATION / DOCTORAL THESIS Titel der Dissertation /Title of the Doctoral Thesis The dark side of campaigning. Negative campaigning and its consequences in multi-party competition. verfasst von / submitted by Mag. Martin Haselmayer angestrebter akademischer Grad / in partial fulfilment of the requirements for the degree of Doktor der Philosophie (Dr. phil.) Wien 2018 / Vienna 2018 Studienkennzahl lt. Studienblatt / A 784 300 degree programme code as it appears on the student record sheet: Dissertationsgebiet lt. Studienblatt / Politikwissenschaft / Political Science field of study as it appears on the student record sheet: Betreut von / Supervisor: Prof. Dr. Wolfgang C. Müller Assoc. Prof. Thomas Meyer, PhD Contents 1 Introduction ...................................................................................................................... 1 The road thus far: Research on negative campaigning 4 Enhancing the understanding of negative campaigning 16 Implications 22 Plan of the dissertation 27 2 Sentiment Analysis of Political Communication: Combining a Dictionary Approach with Crowdcoding ............................................................................................................. 29 Introduction 30 Measuring sentiment in political texts 31 Employing crowdcoding to create a sentiment dictionary 34 Building a negative sentiment dictionary 35 Scoring sentences and texts 40 Validating the procedure 41 Applications 45 Conclusions 50 3 Friendly fire? Negative Campaigning Among Coalition Partners ........................... -

Austria Election Preview: Sebastian Kurz and the Rise of the Austrian ‘Anti-Party’ Page 1 of 4
LSE European Politics and Policy (EUROPP) Blog: Austria election preview: Sebastian Kurz and the rise of the Austrian ‘anti-party’ Page 1 of 4 Austria election preview: Sebastian Kurz and the rise of the Austrian ‘anti-party’ Austria goes to the polls on 15 October, with the centre-right ÖVP, led by 31-year-old Sebastian Kurz, currently ahead in the polls. Jakob-Moritz Eberl, Eva Zeglovits and Hubert Sickinger provide a comprehensive preview of the vote, writing that although polling is consistent with the idea the ÖVP and Kurz are the probable election winners, a noteworthy number of voters are still undecided. Kurz becoming the next chancellor is thus not as set in stone as Angela Merkel’s win in Germany was. Credit: Michael Tholen (CC BY-NC-ND 2.0) Austria’s last parliamentary election in September 2013 resulted in two new parties gaining parliamentary representation, the populist Team Stronach (founded by billionaire Frank Stronach) and the liberal NEOS, while the BZÖ, Jörg Haider’s party which was in government between 2002 and 2006, failed to pass the threshold for parliamentary representation. The governing parties, the Social Democrats (SPÖ) and the People’s Party (ÖVP), recorded all-time lows in support, but still formed a coalition after the election. Team Stronach, however, deteriorated into insignificance very soon afterwards. Since then, however, Austrian voters have become increasingly dissatisfied with the performance of the SPÖ- ÖVP government. Eventually, the so-called refugee crisis in 2015 led to the right-wing populist FPÖ surging into first place in the polls. Soon after, in 2016, both government parties suffered a heavy defeat in the presidential elections, when their candidates gained only around 10% of the vote each, and failed to participate in the second, decisive round of the contest. -

Nationalrates 28
Nn ATIO ALRAT Bilanz 2008–2013 XXIV. GESETZGEBUNGSPERIODE DES NATIONALRATES 28. Oktober 2008 bis 28. Oktober 2013 Bilanz XXIV. GESETZGEBUNGSPERIODE DES NATIONALRATES (2008–2013) Impressum: Herausgeberin/Medieninhaberin/Herstellerin: Parlamentsdirektion Adresse: Dr. Karl Renner-Ring 3, 1017 Wien Konzeption: Gerhard Marschall Redaktion: Barbara Blümel, Harald Brunner, Gudrun Faudon-Waldner, Ute Krycha-Weilinger, Andreas Pittler, Dieter Weisser Fotoredaktion: Ute Krycha-Weilinger, Bernhard Zofall Layout/Graphik einschließlich Titelbild: Dieter Weisser Titelfoto: Stefan Olah Statistik Info-Grafiken: Harald Brunner Statistik (Zahlen): Hans Achter Externes Lektorat: PROperformance KG onlinelektorat, [email protected] Druck: Gutenberg-Werbering GmbH ISBN: 978-3-901991-27-1 Wien, im Oktober 2013 INHALT Editorial Nationalratspräsidentin Barbara Prammer: Bilanz fällt positiv aus ................................................. 5 Bilanz der Gesetzgebungsperiode Gastkommentar Theo Öhlinger: Demokratie ist ein mühsames Geschäft .......................................... 6 Finanz- und Wirtschaftspolitik Aktives Parlament in Zeiten der Krise ............................................................................. 10 Gastkommentar Norbert Feldhofer: Österreichische Stabilisierungspolitik......................................... 11 Gastkommentar Harald Waiglein: Neue finanz- und wirtschaftspolitische Steuerungsarchitektur .................. 13 Gastkommentar Klaus Liebscher: Europäische und österreichische Reaktionen auf die Finanzkrise................. 14 -

GENERAL ELECTIONS in AUSTRIA 29Th September 2013
GENERAL ELECTIONS IN AUSTRIA 29th September 2013 European Elections monitor The Social Democratic Party’s “grand coalition” re-elected in Austria Corinne Deloy Translated by Helen Levy Like their German neighbours (with whom they share the same satisfactory economic results) the Austrians chose to re-elect their leaders in the general elections on 29th September. Both countries are also due to be governed by grand coalitions rallying the two main political parties – one on the left and the other on the right – during the next legislature. Results As expected the outgoing government coalition formed With 5.8% of the vote (11 seats), the Team Stronach by the Social Democratic Party (SPÖ) of outgoing for Austria, a populist, eurosceptic party founded in Chancellor Werner Faymann and the People’s Party September 2012 by Austro-Canadian businessman (ÖVP) of Vice-Chancellor Michael Spindelegger, came Frank Stronach, will be making its debut in the Natio- out ahead in the election. The SPÖ won 27.1% of the nal Council (Nationalrat), the lower chamber of parlia- vote and 53 seats (five less in comparison with the ment, likewise the Neos-New Austria, a liberal party previous election on 28th September 2008); the ÖVP created on 27th October 2012 by Matthias Strolz, a won 23.8% and 46 seats (- 4). The election illustrates former ÖVP member and supported by the industrialist the continued decline in the electorate of both parties: Hans Peter Haselsteiner, which won 4.8% of the vote together they achieved the lowest score in their his- and 9 seats. tory, mobilizing just half of the electorate (50.9%, i.e. -
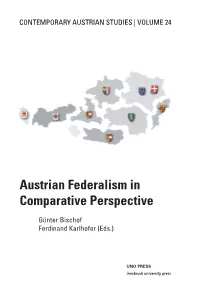
Austrian Federalism in Comparative Perspective
CONTEMPORARY AUSTRIAN STUDIES | VOLUME 24 Bischof, Karlhofer (Eds.), Williamson (Guest Ed.) • 1914: Aus tria-Hungary, the Origins, and the First Year of World War I War of World the Origins, and First Year tria-Hungary, Austrian Federalism in Comparative Perspective Günter Bischof AustrianFerdinand Federalism Karlhofer (Eds.) in Comparative Perspective Günter Bischof, Ferdinand Karlhofer (Eds.) UNO UNO PRESS innsbruck university press UNO PRESS innsbruck university press Austrian Federalism in ŽŵƉĂƌĂƟǀĞWĞƌƐƉĞĐƟǀĞ Günter Bischof, Ferdinand Karlhofer (Eds.) CONTEMPORARY AUSTRIAN STUDIES | VOLUME 24 UNO PRESS innsbruck university press Copyright © 2015 by University of New Orleans Press All rights reserved under International and Pan-American Copyright Conventions. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form, or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording, or any information storage nd retrieval system, without prior permission in writing from the publisher. All inquiries should be addressed to UNO Press, University of New Orleans, LA 138, 2000 Lakeshore Drive. New Orleans, LA, 70148, USA. www.unopress.org. Printed in the United States of America Book design by Allison Reu and Alex Dimeff Cover photo © Parlamentsdirektion Published in the United States by Published and distributed in Europe University of New Orleans Press by Innsbruck University Press ISBN: 9781608011124 ISBN: 9783902936691 UNO PRESS Publication of this volume has been made possible through generous grants from the the Federal Ministry for Europe, Integration, and Foreign Affairs in Vienna through the Austrian Cultural Forum in New York, as well as the Federal Ministry of Economics, Science, and Research through the Austrian Academic Exchange Service (ÖAAD). The Austrian Marshall Plan Anniversary Foundation in Vienna has been very generous in supporting Center Austria: The Austrian Marshall Plan Center for European Studies at the University of New Orleans and its publications series. -

Austria Aims for Tax Agreement with Liechtenstein by Stefanie Steiner and Christian Wimpissinger
Volume 66, Number 5 April 30, 2012 (C) Tax Analysts 2012. All rights reserved. Tax Analysts does not claim copyright in any public domain or third party content. Austria Aims for Tax Agreement With Liechtenstein by Stefanie Steiner and Christian Wimpissinger Reprinted from Tax Notes Int’l, April 30, 2012, p. 414 Reprinted from Tax Notes Int’l, April 30, 2012, p. 414 COUNTRY (C) Tax Analysts 2012. All rights reserved. Tax Analysts does not claim copyright in any public domain or third party content. DIGEST Austria Aims for Tax Agreement With stein by Austrian taxpayers are held by foundations, which number about 50,000 in a country less than Liechtenstein double the size of Manhattan (160 square kilometers). The Austrian government has announced its inten- Foundations offer a particular feature that appeals to tion to negotiate a bilateral withholding tax agreement some taxpayers: The beneficiaries generally are not with Liechtenstein and to finalize it by the end of identified in public documents. An Austria- April. Liechtenstein agreement that is based on the rationale The Liechtenstein agreement should focus not only of the Swiss agreement but focuses on foundations on bank accounts, but even more, on undeclared invest- would be much more complicated to administer. While ments held in Liechtenstein foundations (stiftungen), the the banking market consists of a specific number of Austrian government said. However, Finance Secretary banks with access to a large number of customers, the Andreas Schieder noted that unlike the negotiations number of foundations, as previously noted, is ex- with Switzerland, talks with Liechtenstein might be tremely high, and each foundation has only a small more cumbersome, both legally and politically. -

Parlamentarische Materialien
Stenographisches Protokoll 54. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich XXII. Gesetzgebungsperiode Dienstag, 16. März 2004 1 Stenographisches Protokoll 54. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich XXII. Gesetzgebungsperiode Dienstag, 16. März 2004 Dauer der Sitzung Dienstag, 16. März 2004: 12.00 – 12.03 Uhr 14.49 – 18.08 Uhr ***** Inhalt Nationalrat Gedenken an die Opfer des Terroranschlags in Madrid ......................................... 10 Trauerkundgebung anlässlich des Ablebens von Kardinal Dr. Franz König ........... 10 Personalien Verhinderungen ...................................................................................................... 8 Geschäftsbehandlung Verlangen auf Durchführung einer kurzen Debatte über die Anfragebeantwor- tung 1253/AB gemäß § 92 Abs. 1 der Geschäftsordnung ...................................... 10 Durchführung einer kurzen Debatte gemäß § 57a Abs. 1 der Geschäftsordnung .... 58 Redner: Michaela Sburny ................................................................................................... 59 Bundesminister Dr. Martin Bartenstein .............................................................. 61 Dr. Reinhold Mitterlehner ..................................................................................... 63 Mag. Hans Moser .................................................................................................. 65 Mag. Dr. Magda Bleckmann ................................................................................. 66 Dr. Kurt Grünewald .............................................................................................. -

Percent Threshold Necessary for Parliamentary Representation, Eas Preelection Polls Had Predicted That It Would Fall Short
[NTHE OCTOBER national election, the Social Democratic Party oi austria (SPO) narrowly defeated the ruling People's Party (OVP) by 35.34 percent (68 seats) to 34.33 percent (66 seats), and stoodready to assume power after more than six years in the opposition. Although it wasclear that Social Democratic leader Alfred Gusenbauer would bethe next chancellor, his options for forming a coalition were severely limited. The SPO had ruled out any cooperation with thetwo far-right parties, the Freedom Party (FPO), which received 11.04percent of the vote (21 seats), and the Alliance for the Future of Austria (BZO), whichgarnered 4.11 percent (7 seats). A coalition with the Green Party, whichcame in third with 11.05 percent (21 seats), would not provide theSocial De- mocrats with the necessary majority, and so the new government would likely take the form of a grand coalition between the SocialDemocrats and the People's Party. Several aspects of the election surprised observers. Although the Peo- s Party had been expected to lose ground, few had thought that it ild be defeated. Also, far-right leader Jörg Haider maintained histoe- 1 in national politics: his far-right BZO just managedto finish over -percent threshold necessary for parliamentary representation, eas preelection polls had predicted that it would fall short. The Free- arty, which Haider had led for two decades before quitting it after wer struggle in 2005, did well enough to ensure that it would play a ig opposition role. Lllimigration was a major campaign issue, as many Austrians feared the proposed entry of Turkey into the European Union would flood ountry with cheap labor. -
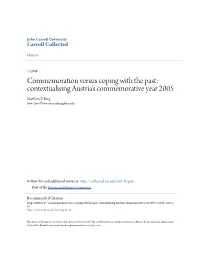
Contextualising Austria's Commemorative Year 2005 Matthew .P Berg John Carroll University, [email protected]
John Carroll University Carroll Collected History 1-2008 Commemoration versus coping with the past: contextualising Austria's commemorative year 2005 Matthew .P Berg John Carroll University, [email protected] Follow this and additional works at: http://collected.jcu.edu/hist-facpub Part of the European History Commons Recommended Citation Berg, Matthew P., "Commemoration versus coping with the past: contextualising Austria's commemorative year 2005" (2008). History. 19. http://collected.jcu.edu/hist-facpub/19 This Article is brought to you for free and open access by Carroll Collected. It has been accepted for inclusion in History by an authorized administrator of Carroll Collected. For more information, please contact [email protected]. Commemoration versus Vergangenheitsbewältigung: Contextualizing Austria’s Gedenkjahr 2005* Abstract This essay explores the politics of memory in post-1945 Austrian political culture, focusing on the shift between the fiftieth anniversary of the Anschluss and the sixtieth anniversary of the end of the Second World War. Postwar Austrian society experienced a particular tension associated with the Nazi past, manifested in communicative and cultural forms of memory. On the one hand, the support of many for the Third Reich—expressed through active or passive complicity—threatened to link Austria with the perpetrator status reserved for German society. On the other, the Allies’ Moscow Declaration (1943) created a myth of victimization by Germany that allowed Austrians to avoid confronting difficult questions concerning the Nazi era. Consequently, discussion of Austrian involvement in National Socialism became a taboo subject during the initial decades of the Second Republic. The 2005 commemoration is notable insofar as it marked a significant break with this taboo. -

Volkswirtschaftliche Tagung 2007
Die Vortragenden Speakers Die Vortragenden Speakers Joaquín Almunia leave). He also was Vice Rector for Joaquín Almunia was born in Spain Infrastructure at the above mentioned on June 17, 1948. He is married and university (1998–2002). In addition, has to two children. He graduated in Christoph Badelt is the President of Law and Economics at the University the Austrian Rectors’ Conference of Deusto (Bilbao), studied at L’École (since 2005). At an earlier time, he Pratique des Hautes Études de Paris, worked as Visiting Professor at the then followed the “Senior Managers University of Klagenfurt, Austria and in Government” program at the Ken- the University of Wisconsin, Madison, nedy School of Government, Harvard U.S.A. (1981–1982, 1984–1985). His University. He is an Associate Lec- numerous publications include Hand- turer at the University of Alcalá de book of Nonprofit Organizations, So- Henares (Madrid) on Employment cial Policy, The Economic Situation and Social Security Law. Mister of Families in Austria, Evaluation of Almunia started his professional life the System of Care Allowances, Eco- as economist at the Council Bureau of the Spanish Chambers of Commerce in Brussels (1972–1975). He was then chief economist of the UGT, a Span- ish trade union (1976–1979). His first political position was as a Mem- ber of the Spanish Parliament in 1979 (he remained a MP until 2004). From 1982 to 1986, Joaquín Almunia was Minister of Employment and Social Security and Minister of Public nomic Relations between Genera- Administration from 1986 to 1991. tions, Costs of Long Term Care, He was also Spokesperson of the So- Families between Equity and Dis- cialist Parliamentary Group between crimination, The Situation of Handi- 1994 and 1997.