Bewertung Schleitrave.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

For Lübeck and Travemünde
Travemünde Traditional Thai Massage & Day Spa Girl power with a sea view Germany’s youngest female captain in Travemünde Mermaid THAI SPA OF THE YEAR 2018/2019 Luxury Travel Awards London/Birmingham UK meets Neptun Fishmongers with passion „...probably one of A bed under the the most beautiful Baltic sky day spas in Europe.“ Unforgettable moments in the sleeper beach basket Magazin FARANG, Berlin WORLD CHAMPIONSHIP MASSAGE 2018 Copenhagen Certified to NATIONAL SKILL STANDARD Silver and Bronze Medal - Category „Asian Massage“ of the Government of Thailand IMA International Massage Association as the first and only operation in the north and one in seven in Germany TRADITIONAL SPA OF THE YEAR Department of Skill Development , Ministry of Labour, Bangkok GERMANY 2017/2018 Luxury Travel Awards London/Birmingham UK Magazine for Lübeck and Travemünde SU WANYO Thai Massage & Day Spa +49 (0)451-70785330 An der Obertrave 8 [email protected] D - 23552 Lübeck facebook/Su.Wanyo.Spa www.wanyo.de Germany |Jana|Nitsch|&| |Peter|Belli| ne special location which there was no way to keep your writing has excited the smallest neat.” He went to school in Lübeck visitors to the Christmas from Grade 4 onwards but only from Hanse hands-on markets for generations, November to March when the family Ois the Fairytale Forest at the foot of set up its winter camp on Volksfest- Hanse hands-on St. Mary’s church. It first opened its platz. Otherwise, this family of travel- doors in 1962 and since then it has put ling show artists moved from funfair a smile on children’s faces every year to funfair right across the country, and at Christmas time. -
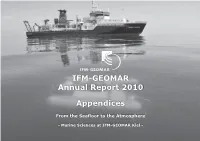
IFM-GEOMAR Annual Report 2010 Appendices
IFM-GEOMAR Annual Report 2010 Appendices From the Seafl oor to the Atmosphere - Marine Sciences at IFM-GEOMAR Kiel - IFM-GEOMAR Report 2010 - Appendices Editor: Andreas Villwock Leibniz-Institut für Meereswissenschaften / Leibniz Institute of Marine Sciences IFM-GEOMAR Dienstgebäude Westufer / West Shore Campus Düsternbrooker Weg 20 D-24105 Kiel Germany Leibniz-Institut für Meereswissenschaften / Leibniz Institute of Marine Sciences IFM-GEOMAR Dienstgebäude Ostufer / East Shore Campus Wischhofstr. 1-3 D-24148 Kiel Germany Tel.: ++49 431 600-2800 Fax: ++49 431 600-2805 E-mail: [email protected] Web: www.ifm-geomar.de Cover: RV Maria S. Merian and submersible JAGO (JAGO Team, IFM-GEOMAR). Table of Contents: Mesocosm systems in the Kongs Fjord Svalbard (M. Nicolai, (IFM-GEOMAR). Appendices 1. Management and Organization 1 1.1 IFM-GEOMAR Overview 1 1.2 Organizational Structure 2 2. Human Resources 5 3. Budgets and Projects 9 3.1 Budget Tables 9 3.2 Projects 14 4. Ship statistics and Expeditions 2010 44 5. Publications 48 5.1 Books (Authorship) 48 5.2 Books (Editorship) 48 5.3 Book Contributions 48 5.4 Peer-reviewed Publications 50 5.5 Other (non-reviewed) Publications 68 5.6 University Publications 71 6. Scientifi c and Public Presentations 74 6.1 Invited Scientifi c Presentations 74 6.2 Other Scientifi c Presentations 77 6.3 Poster 94 6.4 Public Lectures 105 6.5 Radio & TV Interviews 106 7. Scientifi c Exchange and Cooperation 108 7.1 Visitors at IFM-GEOMAR 108 7.2 Visits by IFM-GEOMAR staff 109 7.3 Conferences & Meetings (organized by IFM-GEOMAR staff) 109 7.4 Colloquia & Seminars at IFM-GEOMAR 111 7.5 Expert Activities 115 7.6 Editorial Boards 118 7.7 Honors and Awards 119 8. -

A History of German-Scandinavian Relations
A History of German – Scandinavian Relations A History of German-Scandinavian Relations By Raimund Wolfert A History of German – Scandinavian Relations Raimund Wolfert 2 A History of German – Scandinavian Relations Table of contents 1. The Rise and Fall of the Hanseatic League.............................................................5 2. The Thirty Years’ War............................................................................................11 3. Prussia en route to becoming a Great Power........................................................15 4. After the Napoleonic Wars.....................................................................................18 5. The German Empire..............................................................................................23 6. The Interwar Period...............................................................................................29 7. The Aftermath of War............................................................................................33 First version 12/2006 2 A History of German – Scandinavian Relations This essay contemplates the history of German-Scandinavian relations from the Hanseatic period through to the present day, focussing upon the Berlin- Brandenburg region and the northeastern part of Germany that lies to the south of the Baltic Sea. A geographic area whose topography has been shaped by the great Scandinavian glacier of the Vistula ice age from 20000 BC to 13 000 BC will thus be reflected upon. According to the linguistic usage of the term -

Touristisches Modellprojekt Innere Lübecker Bucht Bewerbung
Touristisches Modellprojekt innere Lübecker Bucht Bewerbung Die Protagonisten der Bewerbung gemeinsam am Steuerrad: v.l.n.r.: André Rosinski, Vorstand TA-Lübecker Bucht/ Bettina Schäfer, Bürgermeisterin Gemeinde Scharbeutz/ Joachim Nitz, Geschäftsführer Timmendorfer Strand Niendorf Tourismus GmbH/ Melanie Puschaddel-Freitag, amtierende Bürgermeisterin Gemeinde Timmendorfer Strand/ Udo Gosch, Bürgermeister Gemeinde Sierksdorf/ Mirko Spieckermann, Bürgermeister Stadt Neustadt in Holstein Touristisches Modellprojekt innere Lübecker Bucht Bewerbung Neustadt in Holstein mit Pelzerhaken und Rettin Sierksdorf Scharbeutz mit Haffkrug Timmendorfer Strand mit Niendorf Kontakt: Tourismus-Agentur Lübecker Bucht AöR Timmendorfer Strand Niendorf Strandallee 134 Tourismus GmbH Timmendorfer Platz 10 23683 Scharbeutz 23669 Timmendorfer Strand 04503 – 7794-111, 0172-4792160 04503 – 3577-80, 0173-395 0451 www.luebecker-bucht.guide www.luebecker-bucht-ostsee.de www.timmendorfer-strand.de www.luebecker-bucht-partner.de Verfasser und Ansprechpartner für Rückfragen: • André Rosinski, Vorstand Tourismus-Agentur Lübecker Bucht AöR • Joachim Nitz, Geschäftsführer Timmendorfer Strand Niendorf Tourismus GmbH Lübecker Bucht, 7. April 2021 Seite - 2 - Inhalt 1. Rahmenbedingungen .......................................................................... - 4 - 1.1 Bewerber, Ziel, zeitliches Vorgehen ......................................................... - 4 - 1.2 Entwicklung Infektionsgeschehen ........................................................... - 5 - 1.3 -
Bauernhofcafés Und Festscheunen 2020/2021
Bauernhofcafés 2020/2021 Gemütlich Kaffeetrinken auf dem Land Auf einen Blick Diese Broschüre stellt Ihnen schnell und unkompliziert die schönsten Bauernhofcafés und Festscheunen Schleswig-Holsteins vor. In der Mitte (S. 16-17) finden Sie über die Landkarte Cafés und Festscheunen direkt in Ihrer Nähe. Eine interaktive Karte für die digitale Navigation finden Sie unter www.lksh.de/bauernhofcafes. Informationen zu den Bauernhofcafés und Festscheunen im Detail finden Sie auf der Website des jeweiligen Betriebs. Alle aufgeführten Informationen entsprechen den Angaben der Betriebsinhaber/-innen. Für diese Angaben und gegebenenfalls auftretende Veränderungen übernimmt die Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein keine Gewähr. An einer Rückmeldung zu unserer Broschüre „Gemütlich Kaffeetrinken auf dem Land 2020/2021“ sind wir sehr interessiert. Sie erreichen uns unter www.lksh.de und per E-Mail unter [email protected] Legende Landwirtschaftlicher Betrieb Bio-Café Festscheune Vegane Speisen Barrierefrei Hofladen Übernachtungsmöglichkeit Geschenkartikel Warme Speisen 2 Foto: www.pepelange.de „Es ist wunderbar nach einem Spaziergang oder einer Radtour in ein Bauernhofcafé einzukehren! Ich liebe selbstgemachte Kuchen und Torten. Und ich bin immer wieder von der Kreativität, der Gastfreundlichkeit und dem Können unserer Bauernhofcafés begeistert! Fest- scheunen geben jedem Fest eine individuelle Note und machen es zu einem unvergesslichen Ereignis!“ Ute Volquardsen Präsidentin der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein 3 1 „Kaffeetafeln im Heu“ – Heuherberge-Hedwigsruh Herzlich willkommen im Heu-Café! Regional - frisch - hausgemacht: Suchen Sie den natürlichen Rahmen - Feine Kuchen und Torten für Ihre nächste Feier oder Ausflugs- - Herzhafte Suppenküche tour? Dann kehren Sie zu Kaffeetafel - neu: Orig. „Heu-Berger” oder Landfrühstück bei uns ein – Termine und individuelle hyggelige Caféstuben/Kaminofen, Angebote auf Anfrage Gartenterrasse, Tenne, Scheune mit - ab 20 Personen Heu & Stroh für unsere kleinen März-Dezember Gäste; Ziegen, Kaninchen, Hühner. -

Neuaufstellung Des Flächennutzungsplanes Der Stadt Neustadt in Holstein
0 i 0 Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes der Stadt Neustadt in Holstein VORENTWURF JANUAR 2018 Titelgestaltung: eigene Darstellung ii Inhaltsverzeichnis i INHALTSVERZEICHNIS INHALTSVERZEICHNIS ............................................................................................................................... i Abkürzungen ..................................................................................................................................... iv Abbildungsverzeichnis ...................................................................................................................... iv Tabellenverzeichnis ............................................................................................................................ v I. Grundlagen und Aufgaben des Flächennutzungsplanes .......................................................... 1 1. Planerfordernis ............................................................................................................................ 1 2. Rechtliche Rahmenbedingungen ............................................................................................... 3 2.1 Rechtsgrundlage ........................................................................................................................................................ 3 2.2 Bindungswirkung ....................................................................................................................................................... 3 2.3 Rechtsschutz ............................................................................................................................................................... -

BP Schlei/Trave
Stand 22.12.2014 Entwurf Bewirtschaftungsplan für den 2. Bewirtschaftungszeitraum gemäß Art. 13 der Richtlinie 2000/60/EG (§ 83 WHG) für die Flussgebietseinheit Schlei/Trave Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Mecklenburg-Vorpommern Entwurf des 2. Bewirtschaftungsplans für die FGE Schlei/Trave Inhaltsverzeichnis Tabellenverzeichnis IX Verzeichnis der Anhänge XIII Abkürzungsverzeichnis XVI Einführung 1 Teil A gemäß Anhang VII WRRL 7 1 Allgemeine Beschreibung der Merkmale der Flussgebietseinheit Schlei/Trave 7 1.1 Oberflächengewässer 13 1.1.1 Lage und Grenzen der Wasserkörper 13 1.1.2 Ökoregionen und Oberflächenwasserkörpertypen im Einzugsgebiet/Ermittlung von Bezugsbedingungen für die Oberflächenwasserkörpertypen 14 1.2 Grundwasser 17 2 Zusammenfassung der signifikanten Belastungen und an- thropogenen Auswirkungen auf den Zustand von Oberflächengewässern und Grundwasser 19 2.1 Oberflächengewässer 19 2.1.1 Kriterien für die Signifikanz von Belastungen 21 2.1.2 Punktuelle Schadstoffquellen (Anh. II 1.4) 25 2.1.3 Signifikante diffuse Stoffeinträge 26 2.1.4 Signifikante Wasserentnahmen/Wiedereinleitungen 31 2.1.5 Signifikante Abflussregulierungen/hydromorphologische Veränderungen 31 2.1.6 Wassermangel und Dürren 33 2.1.7 Einschätzung sonstiger signifikanter anthropogener Belastungen 33 2.1.8 Bestandsaufnahme prioritäre Stoffe 34 2.2 Grundwasser 34 2.2.1 Diffuse Quellen 36 2.2.2 Punktquellen 36 2.2.3 Grundwasserentnahmen 38 2.2.4 Intrusionen 39 2.2.5 Unbekannte Belastungen 39 3 Ermittlung und Kartierung der Schutzgebiete (gemäß Artikel 6 und Anhang IV 1 WRRL) 41 3.1 Gebiete zur Entnahme von Wasser für den menschlichen Gebrauch (Anh. IV 1 i) 41 - I - Entwurf des 2. Bewirtschaftungsplans für die FGE Schlei/Trave 3.2 Gebiete zum Schutz wirtschaftlich bedeutender aquatischer Arten (Anh. -

Angeln Rund Um Dassow Der Landesanglerverband Mecklenburg-Vorpommern E.V
Angeln rund um Dassow Der Landesanglerverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. gibt für Gastangler, die im Besitz eines amtli- chen Fischereischeines (auch zeitlich befristeter Fischereischein!) sind, Gastangelberechtigungen aus. Mit dieser Berechtigung ist dann das Angeln in Pacht und Eigentumsgewässern des Landesanglerver- bandes MV e.V. (laut Ge-wässerverzeichnis) gestattet. Gastanglern ist es jedoch nicht gestattet, auf Gewässern der Berufsfischerei Mecklenburg-Vorpommerns (im Gewässerverzeichnis mit BF markiert) zu angeln. Diese Berufsfischereigewässer dürfen nur von Mitgliedern des LAV MV e.V., die im Besitz einer Jahres- angelberechtigung sind, beangelt werden. Die Rechte und Pflichten laut Gesetzen und Verordnungen des Landes Mecklenburg-Vorpommern (Fi- schereigesetz, Binnenfischereiverordnung, Gewässerordnung, lokale Bestimmungen) sind bei der Aus- übung des Angelns einzuhalten. Diese rechtlichen Grundlagen sowie das Gewässerverzeichnis, sind auf unserer Webseite nachzulesen. Das Gewässerverzeichnis kann aber auch als Broschüre in unserer Geschäftstelle erworben werden. Folgende weitere Regelungen sind zu beachten: 1. Es sind 3 Handangeln und die Benutzung einer Köderfischsenke gestattet. 2. Nachtangeln ist erlaubt. 3. Untermaßige und geschützte bzw. während der Schonzeit gefangene Fische müssen zurückgesetzt werden. 4. Die Angelberechtigung sowie der Fischereischein sind beim Angeln mitzuführen und auf Verlangen der Fischereiaufsicht oder Polizeibeamten vorzuzeigen. Deren Weisungen ist Folge zu leisten. Der Gastangler ist verpflichtet, -

Ämter, Amtsfreie Gemeinden Und Städte in Schleswig-Holstein
WESTERLAND Landschaft Sylt Wiedingharde Süderlügum GLÜCKSBURG (Ostsee) Karrharde Harrislee NIEBÜLL Langballig FLENSBURG Leck Schafflund Bökingharde Steinbergkirche Handewitt Hürup Föhr-Land Sörup Gelting WYK auf Föhr Satrup Amrum Stollberg Oeversee Bredstedt-Land KAPPELN Kappeln-Land Stand: 31.12.2006 Eggebek BREDSTEDT Böklund Süderbrarup Reußenköge Schwansen Tolk © Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein Viöl Hattstedt Pellworm Schuby SCHLESWIG Schlei Silberstedt Nordstrand Windeby HUSUM Haddeby ECKERNFÖRDE Dänischenhagen FEHMARN Treene Laboe Hütten Schönberg (Holstein) Kropp Gettorf Friedrichstadt Altenholz Probstei HEILIGENHAFEN Wittensee Dänischer Wohld Heikendorf Großenbrode Eiderstedt Mönkeberg Stapelholm Fockbek Sankt Peter-Ording Osterrönfeld Kronshagen Lütjenburg-Land Oldenburg-Land Lunden BÜDELSDORF Schacht-Audorf Schönkirchen TÖNNING Selent/Schlesen Klausdorf OLDENBURG in Holstein RENDSBURG Achterwehr KIEL LÜTJENBURG Hennstedt Oldenburg- Hohner Harde Molfsee Raisdorf Land Helgoland WESSELBUREN Weddingstedt Tellingstedt Grube Nortorf-Land Flintbek PREETZ Jevenstedt Lensahn Die Kreise Schleswig-Holsteins Plön-Land Malente Wesselburen HEIDE Preetz-Land NORTORF Bordesholm Grömitz Büsum Heide-Land Albersdorf zum Kreis Bordesholm-Land Ostholstein-Mitte PLÖN EUTIN Pinneberg Hohenwestedt-Land Plön-Land Meldorf-Land Hanerau-Hademarschen Wankendorf NEUSTADT in Holstein Bokhorst Bosau MELDORF Hohenwestedt Süsel NEUMÜNSTER Aukrug Bornhöved Meldorf-Land Schenefeld Kellinghusen-Land Scharbeutz Burg-Süderhastedt Trappenkamp FLENSBURG -
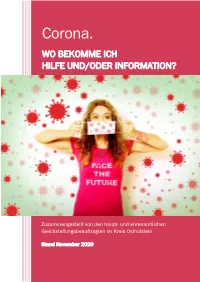
Corona. WO BEKOMME ICH HILFE UND/ODER INFORMATION?
Corona. WO BEKOMME ICH HILFE UND/ODER INFORMATION? Zusammengestellt von den haupt- und ehrenamtlichen Gleichstellungsbeauftragten im Kreis Ostholstein Stand November 2020 UNSERE INFOSAMMLUNG FÜR SIE In unserer Funktion als Gleichstellungsbeauftragte gehört es zu unseren Aufgaben, für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie für Bürgerinnen und Bürger als Ansprechpartnerinnen für verschiedene Themen da zu sein. Als Lotsinnen helfen wir dabei, die gesuchten Informationen oder Beratungsstellen zu finden. In der letzten Zeit drehten sich nahezu alle Anfragen und Beratungsgespräche um das Thema Corona und die Auswirkungen in vielen betroffenen Bereichen. In dieser Zusammenstellung finden Sie Antworten auf Fragen, die uns in der Corona-Zeit häufig gestellt wurden. Zu den verschiedenen Themen haben wir in dieser Broschüre Informationen, Kontakte und Beratungsangebote für Sie zusammengestellt. Sprechen Sie uns an, wenn Sie mehr Informationen benötigen, wir werden gern versuchen, Ihnen weiterzuhelfen. Bleiben Sie gesund, Ihre Gleichstellungsbeauftragten WIR BLEIBEN FÜR SIE AM BALL! Seite | 1 WO FINDE ICH HILFE ZUM THEMA GESUNDHEIT UND PFLEGE? Ärztlicher Bereitschaftsdienst außerhalb der ärztlichen Sprechstunden Rufnummer 116 117 (nur für medizinische Fragen) Corona: Anfragen speziell für Ostholstein per E-Mail an [email protected]. Die telefonische Hotline des Landes Schleswig-Holstein 0431-797 0000 1 Mo-Sa von 8-20 Uhr, So und feiertags 8-16.30 Uhr. Anfragen per Mail [email protected], Bürgertelefon des Bundesgesundheitsministeriums: -

Wenn Amt Die Stadt/ Gemeinde/Das Amt Mit Den Amtsangehörigen Gemeinden/Amtsangehörigen Städten Mit Allen Gemeinden
wenn Amt Die Stadt/ Gemeinde/das Amt mit den amtsangehörigen Gemeinden/amtsangehörigen Städten mit allen Gemeinden Stadt Bad Bramstedt Stadt Bad Segeberg Stadt Barmstedt Stadt Brunsbüttel Stadt Büdelsdorf Stadt Elmshorn Stadt Eutin Stadt Flensburg Stadt Friedrichstadt (Anmeldung über Amt Nordsee-Treene) Stadt Garding (Anmeldung über Amt Eiderstedt) Stadt Geesthacht Stadt Glücksburg (Ostsee) Stadt Glückstadt Stadt Heide Stadt Heiligenhafen Stadt Husum Stadt Itzehoe Stadt Kaltenkirchen Stadt Kappeln Stadt Kiel Stadt Krempe (Anmeldung über Amt Krempermarsch) Stadt Lauenburg/Elbe Stadt Lütjenburg (Anmeldung über Amt Lütjenburg) Stadt Marne (Anmeldung über Marne-Nordsee) Stadt Mölln Stadt Neumünster Stadt Niebüll (Anmeldung über Amt Süd Tondern) Stadt Norderstedt Stadt Nortorf (Anmeldung über Amt Nortorfer Land) Stadt Oldenburg in Holstein Stadt Quickborn Stadt Ratzeburg Stadt Rendsburg Stadt Schleswig Stadt Schwarzenbek Stadt Tönning Stadt Tornesch Stadt Wahlstedt Stadt Wyk auf Föhr (Anmeldung über Amt Föhr-Amrum) Gemeinde Ahrensbök Gemeinde Bäk Gemeinde Barsbüttel Gemeinde Basthorst Gemeinde Braak Gemeinde Brunsmark Gemeinde Buchholz Gemeinde Dahme Gemeinde Ellerau Gemeinde Giesensdorf Gemeinde Grabau (Hzm Lauenburg) Gemeinde Groß Grönau Gemeinde Großhansdorf Gemeinde Grube Gemeinde Halstenbek Gemeinde Handewitt Gemeinde Harrislee Gemeinde Hasloh Gemeinde Henstedt-Ulzburg Gemeinde Hoisdorf Gemeinde Hollenbek Gemeinde Horst Gemeinde Kellenhusen Gemeinde Kollow Gemeinde Kulpin Gemeinde Mustin Gemeinde Mühbrook Gemeinde Oststeinbek Gemeinde -

Wasserwanderkarte Schwentine
Wasserwandern in der Holsteinischen Schweiz Kanuvermieter an der Schwentine: Wasserwanderweg Schwentine „Heiliger Fluß“, so wurde die Schwentine bei den Slaven genannt. Ganz so heilig ist der Fluß nun Eutin: Plön Bosau: Preetz: sicher nicht mehr. Dennoch gibt es viele geschützte und schützenswerte Bereiche auf diesem langsam Boote u. Anhänger Keusen Wassersportzentrum Haus Schwanensee Bootshaus Kanu - Café dahinfließenden Fluß. Auf ihren 55 fahrbaren Kilometern vom äußersten Ende des Großen Eutiner See Verkauf u. Vermietung Segelschule Plön, keine Rückholmöglichkeit und mehr, am Kirchsee bis zur Kieler Förde durchfließt die Schwentine nicht weniger als 17 Seen auf dem direkten Wege. Die Kanuvermietung Eutin Helge Wiederich Sylvia Sacknieß Rüdiger Laas Wegstrecke kann man gut in zwei bis fünf Tagesetappen aufteilen. Es ist sogar möglich die Schwentine Tino Keusen Ascheberger Straße 6 Plöner Straße 15-19 Kahlbrook 25 a auch gegen den Strom zu befahren. Sielbecker Landstraße 17 24306 Plön 23715 Bosau 24211 Preetz Abstecher auf angrenzende Seen sind möglich, jedoch stehen einige unter Naturschutz oder sind 23701 Eutin Tel: 04522-4111 Tel.: 04527-99700 Tel.: 04342-309549 in Privatbesitz wie z.B. der Trammer See in Plön. Er darf nur von Anliegern und deren Gästen Tel.: 04521-4201 [email protected] [email protected] [email protected] www.kanucenter-preetz-ploen.de befahren werden. Auf dem Behler See ist nur die Durchfahrt gestattet. Die naturgeschützten Bereiche [email protected] www.segelschuleploen.de www.schwanensee.com [email protected] der einzelnen Seen sind auf dieser Übersichtskarte hell unterlegt. Sämtliche Inseln im gesamten www.bootekeusen.de www.kanuvermietungploen.de „Naturpark Holsteinische Schweiz“ dürfen nicht betreten werden, hier herrscht ein Sicherheitsabstand Geführte von 75 Metern! Auch die Ufer dürfen nur an den dafür vorgesehenen Ein-/Aussetzstellen, Rast- und Tante Theas Bootsverleih Kiel: Bad Malente- Am Strandweg Kajaktouren, Ruderboot und Campingplätzen angesteuert werden.