ILEK-Endfassung.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
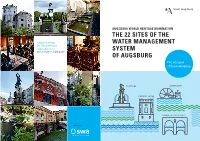
The 22 Sites of the Water Management System Of
bueroecco.com AUGSBURG WORLD HERITAGE NOMINATION THE 22 SITES OF THE Find out all about WATER MANAGEMENT the World Heritage nomination here: wassersystem-augsburg.de SYSTEM OF AUGSBURG The site plan of the nomination FOUNTAINS WATERPOWER DRINKING WATER HYDRAULIC STRUCTURES Sponsored by Discover the 22 sites of Augsburg’s water system 13 14 15 Augustus Fountain 1 Hercules Fountain 2 Mercury Fountain 3 Lower Waterworks 4 The Stadtmetzg 5 The fountain on the Rathausplatz Like the Augustus and the Mercury The bronze sculptures of the foun- The ensemble of the Lower The building (Trade Guild House (City Hall Plaza) was completed in Fountain, the Hercules Fountain, tain were designed by Adriaen de Waterworks with the Liliom for the Butchers) was erected in 1594. It was designed by the Dutch created by Adriaen de Vries, embod- Vries and cast in 1599. A cupid at cinema consists of the Lower 1609 by Elias Holl. Its innovative artist, Hubert Gerhard. In addition to ies Augsburg’s pride in its wealth his feet unties Mercury’s sandal to Watertower, the pumping house use of canal water was a novelty: the city´s founder Caesar Augustus, of water resources. The Kastenturm keep the god of trade in the city and and the water supply lead over The Vorderer Lech canal was bronze sculptures of four river gods at the Red Gate was erected as an to thereby secure its wealth. the cast iron Zirbelnuss canal guided through the basement of the represent the main watercourses additional water tower to supply bridge. This is Augsburgs second Stadtmetzg to keep the meat cool in Augsburg. -

Amtsblatt Nr. 41 Vom 31.12.2020
Amtsblatt des Landratsamtes Ostallgäu herausgegeben vom Landratsamt Ostallgäu Schwabenstraße 11, 87616 Marktoberdorf Sprechzeiten: Öffnungszeiten Bürgerservice: Montag, Mittwoch und Freitag 07.30 – 12.30 Uhr Montag und Dienstag 07.30 – 17.30 Uhr Dienstag 07.30 – 16.00 Uhr Mittwoch und Freitag 07.30 – 12.30 Uhr Donnerstag 07.30 – 17.30 Uhr Donnerstag 07.30 – 19.00 Uhr und nach Terminvereinbarung Jahrgang 75 Donnerstag, 31.12.2020 Nummer 41 Verlängerung der vorläufigen Sicherung des Über- sowie in den betroffenen Gemeinden niedergelegt sind; sie schwemmungsgebietes an der Wertach von Flusskilo- können dort während der Dienststunden eingesehen wer- meter 74.400 (Stadtgrenze Kaufbeuren / Gemeinde- den. Die Unterlagen sind auch auf der Homepage des grenze Biessenhofen) bis Flusskilometer 98.800 (Stadt- Landratsamts Ostallgäu einsehbar unter https://buerger-os- grenze Marktoberdorf / Gemeindegrenze Unterthingau) tallgaeu.de/ueberschwemmungsgebiete. im Bereich der Stadt Marktoberdorf und der Gemeinden Ganz oder teilweise im Überschwemmungsgebiet liegende Ruderatshofen und Biessenhofen Gebäude sind in den Karten farblich hervorgehoben. Verän- BEKANNTMACHUNG derungen der Grenzen oder der Bezeichnungen der im Das Überschwemmungsgebiet an der Wertach von Flusski- Überschwemmungsgebiet gelegenen Grundstücke berüh- lometer 74.400 bis Flusskilometer 98.800 im Bereich der ren die festgesetzten Grenzen des Überschwemmungsge- Stadt Marktoberdorf und der Gemeinden Ruderatshofen biets nicht. und Biessenhofen wurde mit Bekanntmachung vom Hinweis: Soweit die Wertach Grenzgewässer zwischen dem 18.01.2016 im Amtsblatt des Landkreises Ostallgäu vom Landkreis Ostallgäu und der kreisfreien Stadt Kaufbeuren 28.01.2016 vorläufig gesichert. Die vorläufige Sicherung en- ist, wird nur der im Landkreis Ostallgäu befindliche Bereich det, sobald die Rechtsverordnung zur Festsetzung des betrachtet. Überschwemmungsgebiets in Kraft tritt oder das Festset- Weitere Informationen: zungsverfahren eingestellt wird. -
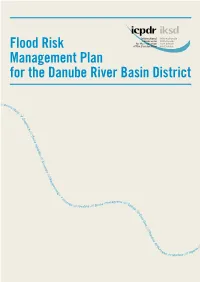
Flood Risk Management Plan for the Danube River Basin District Is Based on Information Received from the ICPDR Contracting Parties by 10 November 2015
/ / / / / / / / / / / / / н ϊ ρ κ Y Flood Risk / / / / a v o Management Plan d l uj //// Crna o pб Gor M // C a //// / // Ro // a mân я / in ia //// ρu for the Danube River Basin District Бълѕѕ v o g e c r e H i a n nd //// Ös s schla terreic o ut h //// B e Č / D esk // // á r / / ep a // ub / lik k / a / s / /// t / a / Sl v / ov r / en / sk H / o / / / /// / M // agyar ija н ors n ϊ zág //// Slove ρ κ Y / / / / a v o d l o M / / / / я u ρ ѕ л ъ Б / / / / a i n â m o R / / / / a r o G a n agyarorsz r /// M ág //// C / S ko lov / s en / n ija / e //// / ov H Sl rva j // tska u // //// б ka Bosn Cp bli a i H //// pu ercegovina re ská / Če h /// rreic / Öste land /// ////// eutsch D Disclaimer This Flood Risk Management Plan for the Danube River Basin District is based on information received from the ICPDR Contracting Parties by 10 November 2015. Sources other than the competent authorities have been clearly identified in the Plan. A more detailed level of information is presented in the national Flood Risk Management Plans. Hence, the Flood Risk Management Plan for the Danube River Basin District should be read and interpreted in conjunction with the national Flood Risk Management Plans. The data in this report has been dealt with, and is presented, to the best of our knowledge. Nevertheless inconsistencies cannot be ruled out. -

Umsetzungskonzept-Wertacher Starzlach
Umsetzungskonzept „Hydromorphologische Maßnahmen“ nach EG-WRRL für den Flusswasserkörper „Wertach bis Einmündung Lobach, Starzlach, Wertacher Starzlach“ (1_F151) – Teil 2 Wertacher Starzlach Stand: 24.05.2017 WWA Kempten Rottachstraße 15 87439 Kempten Umsetzungskonzept „Wertacher Starzlach “ Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis ......................................................................................................................... 2 Anlagen ........................................................................................................................................ 3 Abkürzungen ................................................................................................................................. 3 0. Einführung ............................................................................................................................ 4 1. Detailinformationen/Stammdaten des FWK Wertacher Starzlach ......................................... 5 2. Bewertung und Einstufung des Flusswasserkörpers ............................................................. 6 3. Maßnahmenprogramm (hydromorphologische Maßnahmen) ................................................ 8 4. Gewässerentwicklungskonzepte ........................................................................................... 9 5. Grundsätze für die Maßnahmenvorschläge .......................................................................... 9 6. Abstimmungsprozess Realisierbarkeit: Zusammenfassung der Ergebnisse ........................ 10 7. Maßnahmenvorschläge -

Waters of Augsburg
-Transkript www.bayerisch-schwaben.de/lauschtour Waters of Augsburg The capital of fountains, canals and hydropower stations Audio Point 1: Augustus Fountain You’re listening to the water audio tour in Augsburg. Our starting point is the Town Hall Square, right beside one of Augsburg’s most famous decorative fountains: the Augustus Fountain. In winter you can’t see much of it, it’s covered with planks - but if you visit at other times of the year, you’ll certainly notice what made this fountain so famous all over Europe in its day: water splashing The splashing water! Or, more specifically, the technology behind it! It’s quite normal for us today to see water splashing from a fountain. In the 16th century however, this was something special, a technological sensation. Because to make the water splash, you need water pressure - and Augsburg was one of the first cities to create that pressure by means of an ingenious system of artificial canals, water towers and waterpipes, all of them located both inside and outside the city. You’ll be discovering them on this tour. And after the tour you’ll probably be as astonished as the many tourists who also came here during the Middle Ages to admire the fountains, canals and towers of Augsburg, which were famed throughout Europe. How proud the people of Augsburg have always been of their water is demonstrated by the Augustus Fountain here. It was built in 1594 as a status symbol, demonstrating the city’s sheer abundance of water. On top of the fountain you can see the man who founded Augsburg in around 15 BC – the Emperor Augustus. -

Freizeitführer 2021
Mai 2021 Liebe Freizeittipps Begegnungsländler*innen, im Begegnungsland Lech-Wertach .....................................................Seite seit mehr als einem Jahr hat Bobingen / Burgwalden die Corona-Pandemie un- 1 Inlineskater-Rundweg ..................... 4 ser Leben fest im Griff und 2 Bewegungsparcours ........................ 4 bringt für uns alle erhebliche 3 Historiengalerie u. Backhäusle- Foto: Nik Schölzel Einschränkungen in unseren Museum Burgwalden ......................5 Grundrechten und unserer Lebensführung. Auch die Gestaltung der Freizeit leidet zwangsläufi g darunter, da viele Einrichtungen und Ver- Graben / Lagerlechfeld anstaltungen nicht besucht werden können. 4 Freitzeitsee .................................... 6 5 Freizeitanlage ................................ 6 Wir möchten Ihnen mit dieser Broschüre deshalb eine Begleitung an die Hand geben, die Ihnen Vorschläge machen möchte, wie Sie Ihre Hiltenfi ngen Freizeit in Ihrer Heimatregion, dem Begegnungsland Lech-Wertach, 6 Rad- und Wanderweg .......................7 auch corona-konform gestalten können – natürlich immer mit Ab- 7 Pfarrkirche St. Silvester ................... 7 stand und unter Einhaltung der jeweils geltenden Regelungen. Un- 8 St.-Leonhards-Kapelle ..................... 7 sere Mitgliedsgemeinden haben diese Vorschläge zusammengetragen Kleinaitingen und formuliert, dafür bedanke ich mich herzlich. 9 Grill- und Jugendaktivplatz ...............8 10 Rastplatz Via Claudia ....................... 8 Ich bin mir sicher, dass der eine oder andere Tipp für -
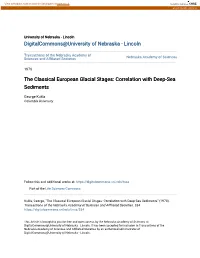
The Classical European Glacial Stages: Correlation with Deep-Sea Sediments
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by UNL | Libraries University of Nebraska - Lincoln DigitalCommons@University of Nebraska - Lincoln Transactions of the Nebraska Academy of Sciences and Affiliated Societies Nebraska Academy of Sciences 1978 The Classical European Glacial Stages: Correlation with Deep-Sea Sediments George Kukla Columbia University Follow this and additional works at: https://digitalcommons.unl.edu/tnas Part of the Life Sciences Commons Kukla, George, "The Classical European Glacial Stages: Correlation with Deep-Sea Sediments" (1978). Transactions of the Nebraska Academy of Sciences and Affiliated Societies. 334. https://digitalcommons.unl.edu/tnas/334 This Article is brought to you for free and open access by the Nebraska Academy of Sciences at DigitalCommons@University of Nebraska - Lincoln. It has been accepted for inclusion in Transactions of the Nebraska Academy of Sciences and Affiliated Societiesy b an authorized administrator of DigitalCommons@University of Nebraska - Lincoln. Transactions of the Nebraska Academy of Sciences- Volume VI, 1978 THE CLASSICAL EUROPEAN GLACIAL STAGES: CORRELATION WITH DEEP-SEA SEDIMENTS GEORGE KUKLA Lamont-Doherty Geological Observatory Of Columbia University Palisades, New York 10964 Four glacials and three interglacials, recognized by classical sea record revealed that this is not the case. In order to learn Alpine and North-European subdivisions of the Pleistocene, were cor the reasons for the discrepancy, we identified the type units related with continuous oxygen-isotope records from the oceans using and their boundaries at the type localities, correlated them loess sections and terraces as a link (Fig. 15). It was found that the Alpine "glacial" stages are represented by sediments formed during with the standard stratigraphic system, and tried to recognize both glacial and interglacial climates, that the classical Alpine "inter their true climatic characteristics. -

Deckblatt Und Heft 1 End 2
Anlage 6.1 Umweltverträglichkeitsstudie August 2016 Vorhaben: Hochwasserschutz und Gewässerentwicklung an der Wertach 4. Realisierungsabschnitt Umweltverträglichkeitsstudie Vorhabensträger: Freistaat Bayern Landkreis: Augsburg-Stadt Gemeinde: Stadt Augsburg Entwurfsverfasser: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth Az. P-4441.2-StA- 11448/2016 Vorhaben: Hochwasserschutz und Gewässerentwicklung an der Wertach 4. Realisierungsabschnitt Umweltverträglichkeitsstudie Vorhabensträger: Freistaat Bayern Landkreis: Augsburg-Stadt Gemeinde: Stadt Augsburg Inhaltsverzeichnis Erläuterungsberichte Heft 1 Allgemeiner Teil Heft 2 Konfliktanalyse und Variantenvergleich Hefte 3 bis 5 Konfliktanalyse und Variantenvergleich 1. bis 3. Realisierungsabschnitt (nicht beigefügt) Heft 6 Anlagen (nicht beigefügt) Anlagen Lageplan Varianten und Konfliktbewertung, 1 : 2.500 Anlage B-1.1 bis B-1.4 1 Lagepläne Bestand, 1 : 2.500 Anlage B-2.1 bis B-2.4 1 Lagepläne, Technische Lagepläne Blatt 1 bis 4 1, : 2.500 Anlage B-3.1 bis B-3.4 1 Lagepläne, Bewertung Arten und Biotope/Konflikte, 1 : 2.500 1 (Projekttitel und Planstempel entsprechen der Umweltverträglichkeitsstudie von Okt. 2004) Anlage 6.1 Vorhaben: Wertach vital II, Planung, 4. Realisierungsabschnitt (B17 bis Ackermannwehr) Umweltverträglichkeitsstudie Vorhabensträger: Freistaat Bayern Landkreis: Augsburg-Stadt Gemeinde: Stadt Augsburg Seiten: G1t 761 000 1007 Vorhabenskennzeichen (BayIFS) 1 - 96 Allgemeiner Teil (Heft 1) Datum, Name Wasserwirtschaftsamt Donauwörth Entwurfsverfasser aufgest. BCE geschr. BCE, Lindenmaier -

From the Northern Ice Shield to the Alpine Glaciations a Quaternary Field Trip Through Germany
DEUQUA excursions Edited by Daniela Sauer From the northern ice shield to the Alpine glaciations A Quaternary field trip through Germany GEOZON From the northern ice shield to the Alpine glaciations Preface Daniela Sauer The 10-day field trip described in this excursion guide was organized by a group of members of DEUQUA (Deutsche Quartärvereinigung = German Quaternary Union), coordinated by DEUQUA president Margot Böse. The tour was offered as a pre-congress field trip of the INQUA Congress in Bern, Switzerland, 21– 27 July 2011. Finally, the excursion got cancelled because not enough participants had registered. Apparently, many people were interested in the excursion but did not book it because of the high costs related to the 10-day trip. Because of the general interest, we decided nevertheless to finish the excursion guide. The route of the field trip follows a section through Germany from North to South, from the area of the Northern gla- ciation, to the Alpine glacial advances. It includes several places of historical importance, where milestones in Quaternary research have been achieved in the past, as well as new interesting sites where results of recent research is presented. The field trip starts at Greifswald in the very North-East of Germany. The first day is devoted to the Pleistocene and Ho- locene Evolution of coastal NE Germany. The Baltic coast with its characteristic cliffs provides excellent exposures showing the Late Pleistocene and Holocene stratigraphy and glaciotectonics. The most spectacular cliffs that are located on the island of Rügen, the largest island of Germany (926 km2) are shown. -

Wertach Uferabbruch Basenreiche Kiefernwälder 4 Gewässerentwicklungskonzept Landkreis Gemeinde Unterallgäu Schwabmünchen Sonstiges Gehölz, Hecke Oder Bauwerke Bzw
Hirschwanggraben Wälder und Gehölze natürliche Gewässerstrukturen 28 Staukraftwerk Au- und Feuchtwald / Kiesbank punktuell/flächig Wasserwirtschaftsamt Schwabmünchen Donauwörth E naturnahes Gehölz, Feucht- und Kiesbank verbuscht Ufergehölz / punktuell/flächig W Landkreis Mischwald Biberburg Augsburg Nadelwald Totholzansammlung/Sturzbäume Wertach Uferabbruch basenreiche Kiefernwälder 4 Gewässerentwicklungskonzept Landkreis Gemeinde Unterallgäu Schwabmünchen sonstiges Gehölz, Hecke oder Bauwerke bzw. Anlagen Gemeinde Wald 3 Hiltenfingen Badeplatz Hirschwang sonstige Biotoptypen Bootsanlegestelle Höfen Feuchtgebietskomplex (mit Gehölzen) 2 Buhne 29 Trockenkomplex (mit Gehölzen) Brücke Ruderalflur 1 Absturz/Wehr Schwabmünchen Gemeinde Magerrasen W Ettringen Wasserkraftanlage Wasserkraftwerk landwirtschaftlich genutzte Fläche Kk Kläranlage kommunal Hiltenfingen Acker E Einleitung Scharlach Intensivgrünland Uferverbau mäßig Extensivgrünland Uferverbau überwiegend W Feldgieß- Deich/ Damm Kartengrundlagen: besiedelter Bereich Luftbilder © Bayerische Vermessungsverwaltung 33 E graben Flächen gemischter Nutzung und Fischaufstieg 32 besonderer funktionaler Prägung Vorhaben: Gewässerentwicklungskonzept Wertach Anlage: Kk 30 Fkm 13,80 - 34,60 Mühlbach Wohnbaufläche E 4 Vorhabensträger: vertreten durch das Industrie- und Gewerbefläche Sonstiges Freistaat Bayern 34 Wasserwirtschaftsamt Donauwörth Verkehrsfläche Planungsgebiet Förgstraße 23, 86609 Donauwörth, Tel.: 0906/7009-0, Fax: 0906/7009-136 Plan-Nr.: Gennach Fischbachmähder- Sport-, Freizeit-, -

Quartärgeologische Karte 1: 25.000 Blatt Nr. 7830 Schwabmünchen Ka F F Hn Hn 244 Bamberger Geographische Schriften, SF 12: 245 - 263 245
Quartärgeologische Karte1:25.000B Bamberger G f eographische Schrif ten, latt Nr S f F 12:243 . 7830Schwabmünchen Hn Ka Hn 244 Bamberger Geographische Schriften, SF 12: 245 - 263 245 Erläuterungen zur quartärgeologischen Karte 1:25.000 der Wertach- und Lechterrassen auf Blatt 7830 Schwabmünchen – Kartierungsergebnisse aus den Jahren 2009 und 2010 Benjamin Gesslein Vorwort Die quartärgeologische Neuaufnahme der Lech- und Wertachterrassen im Bereich des Gradabteilungsblattes 7830 Schwabmünchen wurde in den Jahren 2009 und 2010 durchgeführt. Die hier publizierten Fassungen von Karte und Erläuterungen entspre- chen weitgehend dem Projektabschluss im Januar 2011. Dabei folgt die Gestaltung der Kartenlegende überwiegend der Generallegende für die Geologische Karte von Bayern 1:25 000. Die Finanzierung der Kartierungen erfolgte durch den Geologischen Dienst des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt (LfU) im Rahmen des EU-kofinan- zierten Projektes "Informationsoffensive Oberflächennahe Geothermie 2008-2011". In die Kartenbearbeitung sind die Ergebnisse der Geologischen Karte von Augs- burg und Umgebung 1:50.000 (Schaefer 1957) eingeflossen. Bei der Bearbeitung des Wertachtals stellten neben der bereits erwähnten geologischen Karte von (SCHAEFER 1957) auch verschiedene Veröffentlichungen von Scheuenpflug (1989; ders. 1990) eine hilfreiche Grundlage dar. Für das jungquartäre Lechtal standen großmaßstäbige Kartierungen der Lechterrassen von Brunnacker (1959) und Diez (1964; ders. 1968) zur Verfügung. Von letzterem stammt auch die Geologische Karte 1:25.000, Blatt 7931 Landsberg (Diez 1964). Die Geologische Karte 1:25.000, Blatt 8131 Schongau (Grot- tenthaler 1993) sowie die quartärgeologische Kartierung des Lechtals im Landkreis Landsberg von Gesslein & Schellmann (in diesem Band) stellen die aktuellsten großmaßstäbigen Geländeaufnahmen des Lechtals dar. Die bisher letzte, stark an die Terrassengliederung von Diez (1968; ders. -
E-Bike & Wertach
E-Bike & Wertach Losradeln mit E-Bikes von VWEW-energie. Augsburg Bobingen Schwabmünchen Türkheim Bad Wöreshofen Pforzen VWEW-energie Ladesäule Frankenhofen Kaufbeuren E-Bikes bei VWEW-energie leihen Marktoberdorf Einfach entspannt radeln! Radwanderweg an der Wertach von Marktoberdorf bis Bobingen. In der Kreisstadt des Landkreises Ostallgäu starten Sie Ihre Tour zunächst in Richtung Kaufbeuren (12 km). Einige Kilometer nördlich von Marktoberdorf folgen Sie in der Ortschaft Ebenhofen dann aber der Beschilderung Richtung Biessenhofen über den Wertachuferweg (3,0 km). Am Ortseingang Biessenhofen (Unterquerung B16) berücksichtigen Sie die Beschilderung Richtung Kaufbeuren über Bachtelsee (8,5 km). Über Bachtel- und Bärensee gelangen Sie nach Hirschzell, einem Stadtteil Kaufbeurens. Am Bachtelsee Pause machen und an VWEW-Ladesäule Akku auftanken. Ab Hirschzell folgen Sie zunächst der Beschilderung Richtung Stadtzentrum (2,8 km), ehe Sie am Kreisverkehr weiter der Weg- weisung Richtung Pforzen (7,2 km) folgen. Nachdem Sie die kreisfreie Stadt Kaufbeuren durchquert haben, folgen Sie ab der Ortschaft Leinau dem Wegweiser Richtung Bad Wörishofen (12 km). Ab Schlingen, einem Stadtteil Bad Wörishofens, radeln Sie zunächst Richtung Stockheim (4,0 km), ehe Sie am Frankenhofer Stausee zum Wertachradweg geleitet werden (0,5 km). Auch hier am Stausee gibt es eine VWEW-Ladesäule für Ihr E-Bike. Entlang des Bingstetter Sees gelangen Sie nach Stockheim. An der Wertachbrücke in Stockheim berücksichtigen Sie die Beschilderung Richtung Türkheim über den Wertachradweg (7,0 km). Entlang des Flusses gelangen Sie weiter nach Ettringen (5,2 km). In Ettringen folgen Sie der Beschilderung nach Schwabmünchen über den Wertachradweg (12 km). An der Kapelle am Ortseingang von Hiltenfingen folgen Sie dem Wegweiser Richtung Wertachau (3,4 km).