0948-9975-2008-1.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Exposing Corruption in Progressive Rock: a Semiotic Analysis of Gentle Giant’S the Power and the Glory
University of Kentucky UKnowledge Theses and Dissertations--Music Music 2019 EXPOSING CORRUPTION IN PROGRESSIVE ROCK: A SEMIOTIC ANALYSIS OF GENTLE GIANT’S THE POWER AND THE GLORY Robert Jacob Sivy University of Kentucky, [email protected] Digital Object Identifier: https://doi.org/10.13023/etd.2019.459 Right click to open a feedback form in a new tab to let us know how this document benefits ou.y Recommended Citation Sivy, Robert Jacob, "EXPOSING CORRUPTION IN PROGRESSIVE ROCK: A SEMIOTIC ANALYSIS OF GENTLE GIANT’S THE POWER AND THE GLORY" (2019). Theses and Dissertations--Music. 149. https://uknowledge.uky.edu/music_etds/149 This Doctoral Dissertation is brought to you for free and open access by the Music at UKnowledge. It has been accepted for inclusion in Theses and Dissertations--Music by an authorized administrator of UKnowledge. For more information, please contact [email protected]. STUDENT AGREEMENT: I represent that my thesis or dissertation and abstract are my original work. Proper attribution has been given to all outside sources. I understand that I am solely responsible for obtaining any needed copyright permissions. I have obtained needed written permission statement(s) from the owner(s) of each third-party copyrighted matter to be included in my work, allowing electronic distribution (if such use is not permitted by the fair use doctrine) which will be submitted to UKnowledge as Additional File. I hereby grant to The University of Kentucky and its agents the irrevocable, non-exclusive, and royalty-free license to archive and make accessible my work in whole or in part in all forms of media, now or hereafter known. -

Color” with a Disability
1 O B S E R V E R Thursday, October 2, 1997• Vol. XXXI No. 29 THE INDEPENDENT NEWSPAPER SERVING NOTRE DAME AND SAINT MARY'S STUDENT SENATE Committee tackles bevy of residence life issues By DEREK BETCHER Keeping lunch open until 2 p.m. and Associate News Editor extending breakfast grab-and-go until 11 a.m. were among the senate letter’s The Residence Life Committee proposals that Prentkowski told Szabo reported progress on several fronts — and Tomko he is willing to seriously among them dining times, laundry in examine. men’s dorms, parking and social space “The most significant part of the reclassification — at yesterday’s meeting is that [Prentkowski] is really Student Senate meeting. w illin g to use the senate and come to Most of the news stemmed from an us for input on this issue,” Szabo told earlier meeting between Morrissey the senate. senator Matt Szabo, Knott senator Matt Immediate, tangible improvements Tomko, director of food services David also resulted from the meeting: Szabo Prentkowski and South Dining Hall announced to the senate that Food general manager William Yarbrough. Services agreed to extend Huddle The meeting was in response to a letter hours one hour further into the morn the senators sent recommending ing. adjusted dining times for the dining Beginning Monday, the Huddle will halls. remain open until 2 a.m. on Mondays, “It sounds like he’s very open to Tuesdays and Wednesdays and until 3 The Observer/Liz Lang making some changes,” Tomko said. a.m. on Thursday through Sunday. -

Umoja Damaged by Billiard Balls Early Morning Pelting Under Investigation Seven Billiard Balls Were Sharp Shots, a Lot Like Gunshots
Umoja Damaged by Billiard Balls Early Morning Pelting Under Investigation Seven billiard balls were sharp shots, a lot like gunshots. -By Mark Russell- thrown at the Umoja House at They were about a half second Manag'mg Editor 3:15 am. The balls broke a screen apart. It was so loud that 1 thought and a storm window and damaged that someone was inside the Last Saturday, most of the the siding on the west side of the house." students on campus were cele- house. Bryant then woke up Jean St. brating the end of the year with According to Otis Bryant' 90, Louis '91, who was asleep up- formals and other parties. For one of the residents of Umoja stairs. "We went downstairs and some students, however, Satur- House, he was awake studying at checked every room, because we day night was a night of terror. 3 am when he heard "two very thought that someone was inside the house," said Bryant. "That look about 3 minutes. " PAA Marches Through Classes After finding no one down- stairs, Bryant turned to go back -By Mark Russell- upstairs. "Igothalfwayupthrough Managing Editor the kitchen when I heard a loud Please see Saturday, Page 3. po°l Balls did this damage to the Umoja House. Photo by SueMuik People in Life Science and McCook who thought their 9:30 am class would be boring yesterday were in for quite a surprise. A group of about 25 Black students marched from classroom to classroom, interrupting each lecture to read a prepared statement Sunday Concert Avoids Showers condemning the recent incident at the Umoja House. -

Forma Y Fondo En El Rock Progresivo
Forma y fondo en el rock progresivo Trabajo de fin de grado Alumno: Antonio Guerrero Ortiz Tutor: Juan Carlos Fernández Serrato Grado en Periodismo Facultad de Comunicación Universidad de Sevilla CULTURAS POP Índice Resumen 3 Palabras clave 3 1. Introducción. Justificación del trabajo. Importancia del objeto de investigación 4 1.1. Introducción 4 1.2. Justificación del trabajo 6 1.3. Importancia del objeto de investigación 8 2. Objetivos, enfoque metodológico e hipótesis de partida del trabajo 11 2.1. Objetivos generales y específicos 11 2.1.1. Objetivos generales 11 2.1.2. Objetivos específicos 11 2.2. Enfoque metodológico 11 2.3. Hipótesis de partida 11 3. El rock progresivo como tendencia estética dentro de la música rock 13 3.1. La música rock como denostado fenómeno de masas 13 3.2. Hacia una nueva calidad estética 16 3.3. Los orígenes del rock progresivo 19 3.4. La difícil definición (intensiva) del rock progresivo 25 3.5. Hacia una definición extensiva: las principales bandas de rock progresivo 27 3.6. Las principales escenas del rock progresivo 30 3.7. Evoluciones ulteriores 32 3.8. El rock progresivo hoy en día 37 3.9. Algunos nombres propios 38 3.10. Discusión y análisis final 40 4. Conclusiones 42 5. Bibliografía 44 5.1. De carácter teórico-metodológico (fuentes secundarias) 44 5.2. General: textos sobre pop y rock 45 5.3. Específica: rock progresivo 47 ANEXO I. Relación de documentos audiovisuales de interés 50 ANEXO II. PROGROCKSAMPLER 105 2 Resumen Este trabajo, que constituye un ejercicio de periodismo cultural, en el que se han puesto en práctica conocimientos diversos adquiridos en distintas asignaturas del Grado de Periodismo, trata de definir el concepto de rock progresivo desde dos perspectivas complementarias: una interna y otra externa. -

Cmj Defines Music Business
MUSIC CMJ DEFINES THE ALTERNATIVE MARATNON°. MUSIC BUSINESS. CM & MUSICFEST BE THERE! September 4-7, 1996 Avery Fisher Hall Alice Tully Hall The Walter Reade Theater Lincoln Center New York City (Broadway & 65th St.) CALL 516-466-6000 EXT. 150 NOW OR REGISTER AT THE DOOR THE GLUES PANEL 10:00 AM - 4:00 PM Management) (Electronic Arts) 1.30 PM - 3:45 PM Y FISHER HALL)) MODERATOR: Michael Caplan (Sony 550/Okeh Records) AVERY FISHIER HALL HELENHUIT.ETRDttAVi MODEM MUSIC: ONLINE DELIVERY OF RECORDED MUSIC VIDEOS 'I. HUNTINGTON HULL ROOM (AVERY FISHER HALL) COLLEGE DAY '96 SPACE NE LONE SOLAR: FAN WORSHIP IN CYBERSPACE THE COLOR OF MONET: LOW BUDGET MODERATOR: McVey Stemthal (CDnow) -3:45 PM MODERATOR: Nikko Slight (Atlantic Records) PANELISTS: Russell Bates LOTIS Prod.), Amy Finnerty PANELISTS Ted Cohen (Philips Media) Brian MCNehs 2:30 PM ALICE HILLY HALL BUILT FOR SPEER: DECONSTRUCTING THE ARTIST DEVELOPMENT PANELISTS: Gayle Rolemen (Unofficial ley Buckley Web IMTI) Records), Scott Moskowitz (The DICE 10.30 AM -1130 AM (Cleopatra PROCESS Site), Julia King Online) xH.wenIVATER GRADUATION!: MAl1ING THE TRANSITION FROM COLLEGE RADIO (MN Company) PANELISTS: David Hall (William Morns Agency) .C.1: -RILEY LOBBY (ALICE HILLY HAIL)AIL) 1130 AM -12:45 PM CJ B DANA LOUNGE (AVERY FISHER INTO THE MUSIC INDUSTRY H.) AVERY FISHER HALL THE MINCE FORMERLY KNOWN AS ARTIST: ROLL OVER EmNVEJI: MODERATOR: Chuck Arnold (The Want Adds) ME CANINO FACE OF RETAIL II: CHAIN REACTION MUSICWNS WHOYE BECOME INDUSTRY INSIDERS 21ST CENTURY CLASSICAL MUSIC PANELISTS. -

Dark German Romanticism and the Postpunk Ethos of Joy Division, the Cure and Smashing Pumpkins
University of South Carolina Scholar Commons Theses and Dissertations Fall 2020 Dark German Romanticism and the Postpunk Ethos of Joy Division, The Cure and Smashing Pumpkins Logan Jansen Hunter Follow this and additional works at: https://scholarcommons.sc.edu/etd Part of the German Language and Literature Commons Recommended Citation Hunter, L. J.(2020). Dark German Romanticism and the Postpunk Ethos of Joy Division, The Cure and Smashing Pumpkins. (Master's thesis). Retrieved from https://scholarcommons.sc.edu/etd/6182 This Open Access Thesis is brought to you by Scholar Commons. It has been accepted for inclusion in Theses and Dissertations by an authorized administrator of Scholar Commons. For more information, please contact [email protected]. DARK GERMAN ROMANTICISM AND THE POSTPUNK ETHOS OF JOY DIVISION, THE CURE AND SMASHING PUMPKINS by Logan Jansen Hunter Bachelors in Arts University of South Carolina, 2017 Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements For the Degree of Masters in German College of Arts and Sciences University of South Carolina 2020 Accepted by: Nicholas Vazsonyi, Director of Thesis Yvonne Ivory, Reader Cheryl L. Addy, Vice Provost and Dean of the Graduate School © Copyright by Logan Jansen Hunter, 2020 All Rights Reserved. ii DEDICATION To my Opa, who helped me to appreciate the complexities of music, understand the significance of history and inspire to learn the German language. Without him, this thesis would not have been possible. iii ACKNOWLEDGEMENTS I would like to express my gratitude to Dr. Nicholas Vazsonyi for his willingness to direct my thesis. I would also like to thank Will Whisenant, Ross and James Haynes, Max Gindorf, and C.J. -

United States Court of Appeals Second Circuit
Case 14-1068, Document 48, 10/22/2014, 1351678, Page 1 of 83 14-1048-cv(L), 14-1049-cv(CON), 14-1067-cv(XAP), 14-1068-cv(XAP) United States Court of Appeals for the Second Circuit CAPITOL RECORDS, LLC, a Delaware Limited Liability company, CAROLINE RECORDS, INC., a New York Corporation, VIRGIN RECORDS AMERICA, INC., a California Corporation, EMI BLACKWOOD MUSIC, INC., a Connecticut Corporation, EMI APRIL MUSIC, INC., a Connecticut Corporation, EMI VIRGIN MUSIC, INC., a New York Corporation, COLGEMS- EMI MUSIC, INC., a Delaware Corporation, EMI VIRGIN SONGS, INC., a New York Corporation, EMI GOLD HORIZON MUSIC CORP., a New York Corporation, EMI UNART CATALOG INC., a New York Corporation, STONE DIAMOND MUSIC CORPORATION, a Michigan Corporation, EMI U CATALOG, INC., a New York Corporation, JOBETE MUSIC CO., INC., a Michigan Corporation, Plaintiffs-Appellees-Cross-Appellants, – v. – VIMEO, LLC, a Delaware Limited Liability company, aka Vimeo.com, CONNECTED VENTURES, LLC, a Delaware Limited Liability company, Defendants-Appellants-Cross-Appellees, DOES, 1–20 inclusive, Defendant. ___________________________ ON APPEAL FROM THE UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK PAGE PROOF BRIEF FOR PLAINTIFFS-APPELLEES-CROSS-APPELLANTS RUSSELL J. FRACKMAN CONSTANTINE L. TRELA, JR. (Admission Pending) MARC E. MAYER SIDLEY AUSTIN LLP MITCHELL SILBERBERG & KNUPP LLP One South Dearborn 11377 West Olympic Boulevard Chicago, Illinois 60603 Los Angeles, California 90064 (312) 853-7000 (310) 312-3119 – and – – and – KWAKU A. AKOWUAH (Admission Pending) CHRISTINE LEPERA 1501 K Street, NW JEFFREY M. MOVIT Washington, DC 20005 12 East 49th Street, 30th Floor (202) 736-8000 New York, New York 10017 (212) 509-3900 Attorneys for Plaintiffs-Appellees-Cross-Appellants Case 14-1068, Document 48, 10/22/2014, 1351678, Page 2 of 83 CORPORATE DISCLOSURE STATEMENT Plaintiffs-Appellees-Cross-Appellants Caroline Records, Inc. -
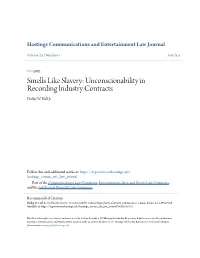
Unconscionability in Recording Industry Contracts Phillip W
Hastings Communications and Entertainment Law Journal Volume 25 | Number 1 Article 5 1-1-2002 Smells Like Slavery: Unconscionability in Recording Industry Contracts Phillip W. Hall Jr. Follow this and additional works at: https://repository.uchastings.edu/ hastings_comm_ent_law_journal Part of the Communications Law Commons, Entertainment, Arts, and Sports Law Commons, and the Intellectual Property Law Commons Recommended Citation Phillip W. Hall Jr., Smells Like Slavery: Unconscionability in Recording Industry Contracts, 25 Hastings Comm. & Ent. L.J. 189 (2002). Available at: https://repository.uchastings.edu/hastings_comm_ent_law_journal/vol25/iss1/5 This Note is brought to you for free and open access by the Law Journals at UC Hastings Scholarship Repository. It has been accepted for inclusion in Hastings Communications and Entertainment Law Journal by an authorized editor of UC Hastings Scholarship Repository. For more information, please contact [email protected]. Smells Like Slavery: Unconscionability in Recording Industry Contracts by ∗ PHILLIP W. HALL JR. I Introduction..........................................................................................190 II Background .........................................................................................192 A. The Development of the Doctrine of Unconscionability .......192 B. Substantive Unconscionability Defined....................................195 C. Procedural Unconscionability Defined.....................................195 D. The Differences in the Level -

Inside the Best Belgian Record Sleeves Voorwoord
inside the best belgian record sleeves voorwoord Ik heb even met het idee gespeeld om hier als edito een FAQ neer te pennen – De jaren 90 waren een ander paar mouwen: redelijk wat straffe platen, maar ook redelijk wat dingen die nooit op ervan uitgaande dat ik de Frequently Asked Questions wel kan raden. vinyl zijn verschenen. Het is vandaag moeilijk te geloven, maar in de jaren 90 waren vinylplaten op een bepaald moment even passé als Donkey Kong, Corey Haim en – ik heb nooit beweerd dat de jaren 80 perfect waren – witte 1. Geen hoes van Vaya Con Dios, quoi? sokken. Op een bepaald moment was er ook echt ver niemand meer om ze aan te slijten. Hipsters zaten nog in hun 2. Precies nooit van Adamo gehoord, hé? puberteit – sommige droegen nog luiers – en zelfs de bomma had voor haar verjaardag intussen een cd-speler cadeau 3. Jij houdt van elektronische muziek, zeker? gekregen. In recordtempo werden platenspelers én vinylcollecties, waar vandaag een klein fortuin voor zou worden 4. Het is wel erg Vlaams, nee? neergeteld, bij het huisvuil gezet, met uitzondering van de platen van Rod Stewart, Paul Young en Chris Rea. Die gingen naar de rommelmarkt. In het kort: nee, toch wel, onder meer en #tousensemble. Toegegeven, elektronische muziek zorgde ervoor dat de vinylpersen bleven draaien, maar eerlijk gezegd: wie in die De langere antwoorden op die en andere vragen klonken in mijn hoofd echter veelal identiek: tijdens ons maanden- periode één maxi zag, had ze gelijk allemaal gezien. De vinylpersen draaiden nog wel, de drukpersen joegen er niet lange speurwerk in platencollecties, muziekarchieven en op – wil iemand de oprichter ervan een Nobelprijs geven – bepaald veel inkt door. -
40 Jahre Offizielle Deutsche Charts
40 JAHRE OFFIZIELLE DEUTSCHE CHARTS Die Offiziellen Deutschen Charts werden im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie e.V. von GfK Entertainment ermittelt. MEILENSTEINE Musik-Charts werden erstmals im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie e.V. Single-Charts auf ermittelt Top 100 erweitert Umstellung des Musikvideos (VHS, VÖ-Tages der Charts Single-Charts Airplay zählt zu den Start der DVD) fließen in von Montag auf Top 50 wöchentlich Single-Charts Klassik-Charts Chartbewertung ein Freitag 1977 1978 1989 1992 1994 2001 2002 2004 2005 Album-Charts Album-Charts auf Airplay wird nicht Downloads zählen wöchentlich Top 100 erweitert mehr in Single-Charts für Single-Charts gewertet Start der Compilation-Charts Mit Amazon fließt E-Commerce mit in die Charts ein Start der Schlager-Charts und Musikvideo-Charts MEILENSTEINE Relaunch der Marke Offizielle Deutsche Charts Musik-Charts erschei- nen Freitag nach Erhebungszeitraum Start der Midweek-Charts, Download-Onlys HipHop-Charts, zählen für die Charts Vinyl-Charts, Dance-Charts, Die Offiziellen Deut- Umstellung auf Downloads zählen Schlager-Charts (wö- schen Charts feiern Werte-Charts für Album-Charts chentl.) ihr 40. Jubiläum 2006 2007 2008 2009 2014 2015 2016 2017 Start der Start der Premium-Streams Premium-Streams Jazz-Charts Newcomer-Charts zählen für Single- zählen für Album- und Comedy-Charts Charts Charts Start der Einführung des Streaming-Charts #1 Awards der Offiziellen Deutschen Charts HIGHLIGHTS Die Neue Deutsche Welle erreicht ihren Andrea Bergs „Best Höhepunkt Boybands wie -

Komplette Ausgabe Als
LETHAL AGGRESSION - LIFE IS HARD... BUT THAT'S NO EXCUSE AT ALL I BRÖ ....................$PV 1 0021 BENELUX . DUREECO 1 5321 • ENGLAND______ REVOLVER . „ 10004- SWEDEN . , LOLLIPOP (06) 31 4865 FRANCE________BUNKER (76)v. 42 ........... 6877 ...........DENMARK............. .....KRONE MUSIK (Ò2) 48 6222 AUSTRIA.............. EMP. (02§4)0»*‘ 2 2273 ITALY--------------FLYING RECORDS (81) 565 1664 IFUNHOUSE RECORDS B POSTFACH 2069B D-3000 HANNOVER SWITZERLAND.... DISCTRADE (0124) 2 2273 USA .....................TRY DUTCH EAST, IMPORTANT FUNHOUSE RECORDS POSTFACH 20690 D-3000 HANNOVER 1 ØWEST-GERMANY An den erhabenen "Schwanzträ“ Eines möchten wir dir noch sa- Wort zu den EMMA-Leserinnen, ger Bob Black"! gen,"Bob Black",bevor du noch die sich ständig begafft und einmal so einen Schrott verfas So,du großer Frauenkenner! mißbraucht(Werbung)fühlens st,solltest du dich vorher mal Du hast diese Story wunderschön 1 .ist es schiere eitle Einbil- mit Frauen und Männern an ein— dung,daß alle Männer gaffen(so verpackt-genauso wie es die Po- en Tisch setzen und dieses litiker verstehen mit ihrem schön seid ihr niçht) und 2 0 "Thema" objektiv durchdisku- die,die am meisten gaffen und pseudointelektuellen Gelaber tieren.Falls du dazu nicht be- den Lesern bzw. den Zuhörern von Sex reden,haben am wenig» reit sein solltest,raten wir etwas zu vermitteln,das sie sten Gelegenheit dazu und wer- selbst nicht verstehen und das dir deine Schreibuntensilien den auch von niemand ernst ge- noch heute im Mississippi zu andere soundso nicht verstehen nommen. versenken.Und die "Moral von sollen.Durch das gekonnte Ver- Zum Schluß möchte ich allen der Geschieht"-wehrt euch alle Mädchen und Jungen wünschen, wenden von Fremdwörtern sind gegen diesen Mist! Es haben wir sehr beeinduckt!!! Wir ra- daß sie kein AIDS kriegen. -

Concerns About “Technical Deficiencies and Concerns About Their Constitutionality,” As Well As the Competing Economic Interests of Affected Groups
No. 16- IN THE Supreme Court of the United States ___________ CAPITOL RECORDS, LLC, CAROLINE RECORDS, INC., VIR- GIN RECORDS AMERICA, INC., EMI BLACKWOOD MUSIC, INC., EMI APRIL MUSIC, INC., EMI VIRGIN MUSIC, INC., COLGEMS-EMI MUSIC, INC., EMI VIRGIN SONGS, INC., EMI GOLD HORIZON MUSIC CORP., EMI UNART CATA- LOG, INC., STONE DIAMOND MUSIC CORPORATION, EMI U CATALOG, INC., JOBETE MUSIC CO., INC., Petitioners, v. VIMEO, LLC, CONNECTED VENTURES, LLC, DOES, 1-20 INCLUSIVE, Respondents. ___________ On Petition for a Writ of Certiorari to the United States Court of Appeals for the Second Circuit ___________ PETITION FOR A WRIT OF CERTIORARI ___________ RUSSELL J. FRACKMAN CARTER G. PHILLIPS * MARC E. MAYER KWAKU A. AKOWUAH MITCHELL SILBERBERG & REBECCA S. LEVENSON KNUPP LLP SIDLEY AUSTIN LLP 11377 West Olympic 1501 K Street, N.W. Boulevard Washington, D.C. 20005 Los Angeles, CA 90064 (202) 736-8000 (310) 312-2000 [email protected] CONSTANTINE L. TRELA, JR. SIDLEY AUSTIN LLP One South Dearborn Chicago, IL 60603 (312) 853-7000 Counsel for Petitioners December 14, 2016 * Counsel of Record QUESTION PRESENTED Section 301(c) of the Copyright Act states that “[w]ith respect to sound recordings fixed before Feb- ruary 15, 1972, any rights or remedies under the common law or statutes of any State shall not be an- nulled or limited [by the Copyright Act] until Febru- ary 15, 2067.” The question presented is whether the Second Cir- cuit erred in holding, contrary to the considered view of the United States Copyright Office and in conflict with New York