Leseprobe-14004.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Reflections on Wagner Dream) Comment Je Compose - Réflexions Sur Wagner Dream Jonathan Harvey
Document généré le 29 sept. 2021 06:11 Circuit Musiques contemporaines How do I compose? (Reflections on Wagner Dream) Comment je compose - Réflexions sur Wagner Dream Jonathan Harvey La fabrique des oeuvres Résumé de l'article Volume 18, numéro 1, 2008 Dans ce texte écrit en mai 2007, Jonathan Harvey s’interroge sur sa manière de composer, à la faveur d’un retour rétrospectif sur la genèse de son opéra URI : https://id.erudit.org/iderudit/017907ar Wagner Dream. Il aborde notamment : les évocations personnelles associées à DOI : https://doi.org/10.7202/017907ar la première note jouée par le cor ; la logique de conception des deux espaces harmoniques principaux ; l’incidence d’une forte tempête qui s’est produite Aller au sommaire du numéro sur l’un des lieux de la composition ; ce qu’il a tiré de la pensée et l’oeuvre de Wagner pour son opéra. Éditeur(s) Les Presses de l'Université de Montréal ISSN 1183-1693 (imprimé) 1488-9692 (numérique) Découvrir la revue Citer cet article Harvey, J. (2008). How do I compose? (Reflections on Wagner Dream). Circuit, 18(1), 38–43. https://doi.org/10.7202/017907ar Tous droits réservés © Les Presses de l’Université de Montréal, 2008 Ce document est protégé par la loi sur le droit d’auteur. L’utilisation des services d’Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique d’utilisation que vous pouvez consulter en ligne. https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/ Cet article est diffusé et préservé par Érudit. Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de l’Université de Montréal, l’Université Laval et l’Université du Québec à Montréal. -
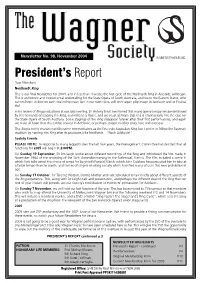
Wagner Oct 04.Indd
Wagner Society in NSW Inc. Newsletter No. 98, November 2004 IN NEW SOUTH WALES INC. President’s Report Dear Members Neidhardt Ring This is our final Newsletter for 2004, and in less than 4 weeks the first cycle of the Neidhardt Ring in Adelaide will begin. This is an historic and monumental undertaking for the State Opera of South Australia, and we in the Eastern States, who cannot hope to dine on such exalted operatic fare in our own cities, will once again pilgrimage to Adelaide and its Festival Hall. In his review of Ring productions at our July meeting, Dr Antony Ernst mentioned that many opera companies are destroyed by the demands of staging the Ring, as moths to a flame, and we must all hope that this is emphatically not the case for the State Opera of South Australia. Some stagings of the Ring disappear forever after their first performances, and again we must all hope that this can be revived in Adelaide, or perhaps staged in other cities here and overseas. This Ring is being characterised by some commentators as the first truly Australian Ring, but I prefer to follow the Bayreuth tradition by naming this Ring after its producer, Elke Neidhardt. “Nach Adelaide!” Society Events PLEASE NOTE: In response to many requests over the last few years, the Management Committee has decided that all functions for 2005 will begin at 2:00PM. On Sunday 19 September, Dr Jim Leigh spoke about different recordings of the Ring and introduced the film made in November 1964 of the recording of the Solti Gotterdammerung in the Sofiensaal, Vienna. -

Wagner Quarterly 157 June 2020
WAGNER SOCIETY nsw ISSUE NO 30 CELEBRATING THE MUSIC OF RICHARD WAGNER WAGNER QUARTERLY 157 JUNE 2020 Ca’ Vendramin Calergi, Venice in 1870. Photograph by Carlo Naya inscribed to Marie-Caroline de Bourbon-Sicile, duchess de Berry (1798-1870), its former owner. Wagner died here on 13 February 1883 SOCIETY’S OBJECTIVES To promote the music of Richard Wagner and his contemporaries and to encourage a wider understanding of their work. To support the training of young Wagnerian or potential Wagnerian performers from NSW. The Wagner Society In New South Wales Inc. Registered Office75 Birtley Towers, Birtley Place, Elizabeth Bay NSW 2011 Print Post Approved PP100005174 June Newsletter Issue 30 / 157 1 WAGNER IN ITALY REFER TO PETER BASSETT’S ARTICLE ON PAGES 5-10 Teatro di San Carlo, Naples Wagner by Pierre Auguste Renoir Palatine Chapel, Palermo 2 June Newsletter Issue 30 / 157 PRESIDENT’S REPORT PRESIDENT’S REPORT 2020 has been a difficult year so far, with some unexpected Thanks to the sterling efforts of Lis Bergmann, with input and unfortunate interruptions to our program. from Leona Geeves and Marie Leech, the Wagner Society in NSW now posts material on YouTube. It includes lists of We had planned a number of events but were frustrated by artists supported by the Society, videos taken by individual Covid-19 regulations preventing the Society from holding members and information on recordings and performances meetings. We have missed out on a talk by Tabatha McFadyen of particular interest to anyone interested in Wagner’s and on presentations by Antony Ernst and Peter Bassett, two compositions. -

Bibliographic Essay for Alex Ross's Wagnerism: Art and Politics in The
Bibliographic Essay for Alex Ross’s Wagnerism: Art and Politics in the Shadow of Music The notes in the printed text of Wagnerism give sources for material quoted in the book and cite the important primary and secondary literature on which I drew. From those notes, I have assembled an alphabetized bibliography of works cited. However, my reading and research went well beyond the literature catalogued in the notes, and in the following essay I hope to give as complete an accounting of my research as I can manage. Perhaps the document will be of use to scholars doing further work on the phenomenon of Wagnerism. As I indicate in my introduction and acknowledgments, I am tremendously grateful to those who have gone before me; a not inconsiderable number of them volunteered personal assistance as I worked. Wagner has been the subject of thousands of books—although the often-quoted claim that more has been written about him than anyone except Christ or Napoleon is one of many indestructible Wagner myths. (Barry Millington, long established one of the leading Wagner commentators in English, disposes of it briskly in an essay on “Myths and Legends” in his Wagner Compendium, published by Schirmer in 1992.) Nonetheless, the literature is vast, and since Wagner himself is not the central focus of my book I won’t attempt any sort of broad survey here. I will, however, indicate the major works that guided me in assembling the piecemeal portrait of Wagner that emerges in my book. The most extensive biography, though by no means the most trustworthy, is the six- volume, thirty-one-hundred-page life by the Wagner idolater Carl Friedrich Glasenapp (Breitkopf und Härtel, 1894–1911). -

Redalyc.System Analysis As Text Analysis. Richard Wagner Viewed
methaodos.revista de ciencias sociales E-ISSN: 2340-8413 [email protected] Universidad Rey Juan Carlos España Kaden, Christian System analysis as text analysis. Richard Wagner viewed from Cosima Wagner´s Diaries methaodos.revista de ciencias sociales, vol. 4, núm. 1, mayo, 2016, pp. 10-20 Universidad Rey Juan Carlos Madrid, España Available in: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=441545394002 How to cite Complete issue Scientific Information System More information about this article Network of Scientific Journals from Latin America, the Caribbean, Spain and Portugal Journal's homepage in redalyc.org Non-profit academic project, developed under the open access initiative methaodos.revista de ciencias sociales, 2016, 4 (1): 10-20 Christian Kaden ISSN: 2340-8413 | http://dx.doi.org/10.17502/m.rcs.v4i1.100 System analysis as text analysis. Richard Wagner viewed from Cosima Wagner´s Diaries Análisis de sistemas como análisis de textos. Richard Wagner visto desde los Diarios de Cosima Wagner Christian Kaden Humboldt-Universität zu Berlin, Alemania. In memoriam Recibido: 15-08-2015 Aceptado: 12-09-2015 Abstract Cosima Wagner, Franz Liszt’s illegitimate daughter, went down in history as the second wife of the great German composer Richard Wagner and as a leading advocate of his work after the death of the musician. Traditionally, Cosima has been regarded as a fundamental source of inspiration for some of the musical works of the artist, but perhaps her influence on Wagners personality went far beyond. The aim of this research is to propose a particular vision of the influence that Cosima had on the thought of the composer and his works through a sociometric analysis performed from a content analysis of several texts extracted from her personal diaries. -

"How Do I Compose? (Reflections on Wagner Dream) "
Article "How do I compose? (Reflections on Wagner Dream) " Jonathan Harvey Circuit : musiques contemporaines, vol. 18, n° 1, 2008, p. 38-43. Pour citer cet article, utiliser l'information suivante : URI: http://id.erudit.org/iderudit/017907ar DOI: 10.7202/017907ar Note : les règles d'écriture des références bibliographiques peuvent varier selon les différents domaines du savoir. Ce document est protégé par la loi sur le droit d'auteur. L'utilisation des services d'Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique d'utilisation que vous pouvez consulter à l'URI https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/ Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de l'Université de Montréal, l'Université Laval et l'Université du Québec à Montréal. Il a pour mission la promotion et la valorisation de la recherche. Érudit offre des services d'édition numérique de documents scientifiques depuis 1998. Pour communiquer avec les responsables d'Érudit : [email protected] Document téléchargé le 10 février 2017 03:25 et l’unicité du métier, à la fois sur le plan administratif et sur 5. Modalys est un logiciel de synthèse par modèles physiques celui de la formation universitaire (voir notamment http :// conçu et développé par l’équipe de recherche Acoustique rim2007.ircam.fr/). instrumentale à l’Ircam. 2. Master d’« Acoustique, Traitement du signal, Informatique, 6. Vienna Symphonic Library (base de donnée d’échantillons de Appliqués à la Musique » délivré par l’Université Pierre et Marie sons instrumentaux), http ://www.vsl.co.at/ Curie (Paris-6) et coordonné par l’Ircam, en collaboration avec 7. -

PDF Van Tekst
De Vlaamsche Kunstbode. Jaargang 12 bron De Vlaamsche Kunstbode. Jaargang 12. Jul. Vuylsteke, Ad. Hoste, Gent / De Seyn-Verhougstraete, Roeselare / J. Noordendorp, Amsterdam 1882 Zie voor verantwoording: https://www.dbnl.org/tekst/_vla023188201_01/colofon.php Let op: werken die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen auteursrechtelijk beschermd zijn. 5 Een schoone jongen Door Teirlinck-Stijns. I. De winter was nog niet voorbij: Gisteren had het den ganschen dag gesneeuwd. Doch heden hing de morgenzon glansend aan den hemel, en deed het sneeuwwater in kleine stroompjes over de moddernatte wegen en voedpaden loopen. Ginder lag het dorp Heilaart: het rood der daken kroop van onder den smeltenden sneeuw en de schaliën van kerkromp en- toren glommen in den zonneschijn. Hier liep de beek tusschen het dichte, bladerlooze elzenhout, waarachter Pol en Grietje stonden. Hij was eene slanke zwartharige kerel, met blozend gelaat, donkere, levendige oogen en een kneveltje, dat op de krullende bovenlip begon door te schemeren. Hij droeg den Vlaanderschen blauwen kiel en, op éen oor, de zwarte zijden muts. 't Was Schoone Pol - zooals de meisjes hem dikwijls noemden - een vroolijke jongen, die overal aangetrokken werd en duivels veel van kermisjes hield, waar iedereen hem verkoos als een echt haantje-vooruit. Zij was kleiner dan hij, juist lang genoeg om haar hoofd op zijne borst te leggen. Ze scheen zelfs teeder en half ziekelijk, met haar bleek voorhoofd en lichtende oogappels. Heel schoon kon ze niet genoemd worden, neen; maar haar blik was toch zoo zacht; ze had zulke dikke, bruine haarvlechten en zulk lief blosje op de wangbeenderen, dat ze op het eerste zicht bekoorde. -

Capítulo 1. Wagner Vida Y Obra (Archivo Pdf, 99
Capítulo I RICHARD WAGNER Vida. Wilhelm Richard Wagner nació en Leipzig Alemania, el 22 de mayo 1813 en una familia de escuelas de maestros y cantantes. Su padre, Friedrich Wagner murió el año en que el nació. Al año siguiente su madre Johanna Rosine Wagner se casó de nuevo, con el pintor, actor y escritor Ludwig Geyer. En los primeros catorce años de su vida Richard era conocido como Richard Geyer y considerado como su hijo, (más tarde Richard sospechó que Geyer era su verdadero padre.) En 1820 Wagner fue inscrito en la “Escuela Wetzel”, donde comenzó sus estudios de piano. Geyer murió en 1821, su madre vivía en Dresde y fue ahí donde Richard continuó sus clases de piano impartidas por Humann. Wagner estuvo en contacto con tres compositores importantes de la ópera alemana, Carl María von Weber (1786-1826), Louis Spohr (1784- 1859) y Heinrich August Marschner (1795-1861) quienes vivían también en Dresde y contribuyeron en su orientación hacia la ópera. En 1827 Wagner y su madre se mudaron a Leipzig donde su hermana Luise Constanze obtuvo un papel para el teatro, lo cual les permitió seguir en esa ciudad, así, Wagner recibió su primera clase de composición con Christian Gottlieb Müller (1828 a 31) y compuso varias sonatas para piano y oberturas. En 1831 se inscribió como estudiante de la Thomasschule donde estudió contrapunto y composición con el director de Thomaskirche Christian Theodor Weiling, quien le inculcó a Mozart como ejemplo. Weiling estaba muy impresionado por el talento de Wagner, así que se negó a recibir los pagos y 12 lo ayudó a publicar su sonata en Sib por Breitkopf & Härtel como opus 1. -
Gender, Sexuality and Love in Wagner: an Electronic Roundtable Moderator: Nicholas Vazsonyi Participants: Barry Emslie Sanna Pederson Eva Rieger
The Wagner Journal, 9, 2, 4–18 Gender, Sexuality and Love in Wagner: An Electronic Roundtable Moderator: Nicholas Vazsonyi Participants: Barry Emslie Sanna Pederson Eva Rieger The idea for this roundtable emerged from the happy coincidence that at least three important books on the topics of gender, sexuality and love have appeared in the last few years. These are Barry Emslie, Richard Wagner and the Centrality of Love (Boydell & Brewer, 2010); Eva Rieger, Richard Wagner’s Women, trans. Chris Walton (Boydell & Brewer, 2011); and Laurence Dreyfus, Wagner and the Erotic Impulse (Harvard University Press, 2012). Add to that, Sanna Pederson has been writing and speaking about Wagner and masculinity, especially in the composer’s essays and letters written around 1850, for a couple of years, and has an article forthcoming.1 So I wanted to invite these eminent Wagner scholars to talk a little bit about this complex of issues, to see how their thoughts resonate in active exchange with one another. Larry Dreyfus was invited to participate in this roundtable, but he declined. VAZSONYI: Barry Emslie, Sanna Pederson, Eva Rieger, welcome to this e-roundtable on ‘Gender, Sexuality and Love’ and thank you for agreeing to participate in my little experiment. The idea for this conversation came to me because all three of you have recently been working on aspects of this topic area, but your focus and your findings have been so different from each other. In this respect, it is not at all like the recent debate about anti- Semitism, which has circled around essentially one question. -

Richard Wagner Und Die Deutschen Eine Geschichte Von Hass Und Hingabe
Unverkäufliche Leseprobe Sven Oliver Müller Richard Wagner und die Deutschen Eine Geschichte von Hass und Hingabe 351 Seiten, Gebunden ISBN: 978-3-406-64455-9 Weitere Informationen finden Sie hier: http://www.chbeck.de/11209859 © Verlag C.H.Beck oHG, München OUVERTÜRE IM FEBRUAR 1883 Der Tod in Venedig und die Geburt eines Genies Der Tod in Venedig undOuvertüre die Geburt im Februar eines Genies 1883 Den unerforschlich tief geheimnisvollen Grund, wer macht der Welt ihn kund? Tristan und Isolde Am Morgen des 13. Februar 1883 stritten sich Richard Wagner und seine Ehefrau Cosima. Der Anlass war Cosimas Unmut über den geplanten Besuch der Sängerin Carrie Pringle bei ihnen im Palazzo Vendramin-Calergi in Venedig. Sie fürchtete, vielleicht nicht zu Unrecht, Richards Untreue. Daraufhin zog sich der Meister in sein Arbeitszimmer zurück und ließ die Familie gegen 14 Uhr wissen, dass er nicht am Mittagessen teilnehmen wolle. Unabhängig von diesem Streit plagten ihn gesundheitliche Sorgen. Seit Monaten klagte er immer wieder über Brustkrämpfe, die ihm Schmerzen be- reiteten und seine Bewegungsfähigkeit einschränkten. An diesem Tag nun saß Wagner an seinem Schreibtisch und ver- fasste einen Aufsatz mit dem wundersamen Titel Über das Weibliche im Menschen. Der wichtigste Satz in diesem Traktat ist der letzte: «Gleichwohl geht der Prozess der Emanzipation des Weibes nur unter ekstatischen Zuckungen vor sich. Liebe – Tragik.» Bei diesen Worten entglitt ihm die Feder. Richard Wagner traf ein Herz- infarkt, wahrscheinlich ein Reinfarkt der rechten Herzkammer. Von Krämpfen geschüttelt, läutete er und bat das Hausmädchen, seine Frau und den Doktor zu rufen. Cosima eilte vom Mittagstisch her- bei und fand ihn stöhnend und zusammengesunken auf dem kleinen Sofa im Ankleidezimmer. -

Wagner and Philosophy Pdf, Epub, Ebook
WAGNER AND PHILOSOPHY PDF, EPUB, EBOOK Bryan Magee | 432 pages | 06 Sep 2001 | Penguin Books Ltd | 9780140295191 | English | London, United Kingdom Wagner and Philosophy PDF Book Parsifal is an enigma to many, as Scruton points out, with critics divided as to how to interpret the operatic story. They spent quite a lot of time together, but there is some strain in the relationship. In the superb volume under review he combines his two enthusiasms in another beautifully and lucidly written book. It also profoundly influenced The Ring, which tells the story of Siegfried's quest for freedom and individuality, and his final self-betrayal when he enslaves the one he loves and trades her for a substitute. In his world view, the artist was the prophet and embodiment of the future. The four main branches of study are: metaphysics, What is the ultimate nature of reality? Skip to Content. This returns us to the problem of eros and sin permeating this opera. Help Learn to edit Community portal Recent changes Upload file. The world that we know is a world of appearances, ordered by the law of cause and effect. Early in his life, Wagner was an enthusiastic supporter of the nationalist and socialist revolutions that erupted across Europe in In the Virgin Mary, in Christ and in God the Father Christians idealize aspects of the human condition, endowing them with a fictitious life. Ironically, at the same time Wagner did have considerable contact with Meyerbeer, who loaned him money, and used his influence to arrange for the premiere of Rienzi , Wagner's first successful opera, in Dresden in ; Meyerbeer later expressed hurt and bewilderment over Wagner's written abuse of him, his works, and his faith. -

'Alienated from His Own Being': Nietzsche, Bayreuth and the Problem of Identity Author(S): Christopher Morris Source: Journal of the Royal Musical Association, Vol
'Alienated from His Own Being': Nietzsche, Bayreuth and the Problem of Identity Author(s): Christopher Morris Source: Journal of the Royal Musical Association, Vol. 127, No. 1 (2002), pp. 44-71 Published by: Taylor & Francis, Ltd. on behalf of the Royal Musical Association Stable URL: https://www.jstor.org/stable/3840479 Accessed: 26-05-2020 12:40 UTC REFERENCES Linked references are available on JSTOR for this article: https://www.jstor.org/stable/3840479?seq=1&cid=pdf-reference#references_tab_contents You may need to log in to JSTOR to access the linked references. JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at https://about.jstor.org/terms Taylor & Francis, Ltd., Royal Musical Association are collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Journal of the Royal Musical Association This content downloaded from 78.18.65.11 on Tue, 26 May 2020 12:40:09 UTC All use subject to https://about.jstor.org/terms Journai of the Royal Musical Association, 127 (2002) ? Royal Musical Association 'Alienated from his Own Being': Nietzsche, Bayreuth and the Problem of Identity CHRISTOPHER MORRIS Few critics have confronted Richard Wagner and the cultural phenom- enon of 'Wagnerism' with Nietzsche's insight and severity.