Fischerei 2000
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Download (9MB)
Beiträge zur Hydrologie der Schweiz Nr. 39 Herausgegeben von der Schweizerischen Gesellschaft für Hydrologie und Limnologie (SGHL) und der Schweizerischen Hydrologischen Kommission (CHy) Daniel Viviroli und Rolf Weingartner Prozessbasierte Hochwasserabschätzung für mesoskalige Einzugsgebiete Grundlagen und Interpretationshilfe zum Verfahren PREVAH-regHQ | downloaded: 23.9.2021 Bern, Juni 2012 https://doi.org/10.48350/39262 source: Hintergrund Dieser Bericht fasst die Ergebnisse des Projektes „Ein prozessorientiertes Modellsystem zur Ermitt- lung seltener Hochwasserabflüsse für beliebige Einzugsgebiete der Schweiz – Grundlagenbereit- stellung für die Hochwasserabschätzung“ zusammen, welches im Auftrag des Bundesamtes für Um- welt (BAFU) am Geographischen Institut der Universität Bern (GIUB) ausgearbeitet wurde. Das Pro- jekt wurde auf Seiten des BAFU von Prof. Dr. Manfred Spreafico und Dr. Dominique Bérod begleitet. Für die Bereitstellung umfangreicher Messdaten danken wir dem BAFU, den zuständigen Ämtern der Kantone sowie dem Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie (MeteoSchweiz). Daten Die im Bericht beschriebenen Daten und Resultate können unter der folgenden Adresse bezogen werden: http://www.hydrologie.unibe.ch/projekte/PREVAHregHQ.html. Weitere Informationen erhält man bei [email protected]. Druck Publikation Digital AG Bezug des Bandes Hydrologische Kommission (CHy) der Akademie der Naturwissenschaften Schweiz (scnat) c/o Geographisches Institut der Universität Bern Hallerstrasse 12, 3012 Bern http://chy.scnatweb.ch Zitiervorschlag -
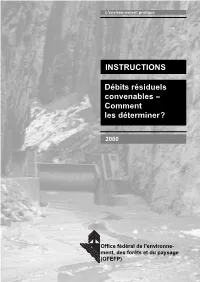
Débits Résiduels Convenables -- Comment Les Déterminer?
L'environnement pratique INSTRUCTIONS Débits résiduels convenables -- Comment les déterminer? 2000 Office fédéral de l'environne- ment, des forêts et du paysage (OFEFP) L'environnement pratique INSTRUCTIONS Débits résiduels convenables -- Comment les déterminer? 2000 Publié par l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) Auteurs R. Estoppey, OFEFP, Berne Dr. B. Kiefer, Kiefer & Partners AG, Zurich M. Kummer, OFEFP, Berne S. Lagger, OFEFP, Berne H. Aschwanden, SHGN, Berne (chap. 7) Traduction B. Bressoud, Ardon Commande Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage Documentation 3003 Berne Fax + 41 (0)31 324 02 16 E-mail: [email protected] Internet: http://www.admin.ch/buwal/publikat/f/ Numéro de commande VU-2701-F © OFEFP 2000 Table des matières 3 TABLE DES MATIÈRES $9$17352326 ,1752'8&7,21 1.1 GÉNÉRALITÉS..................................................................................................................................7 1.2 OBJECTIF ET PRINCIPES DE LA FIXATION DE DÉBITS RÉSIDUELS CONVENABLES ......8 1.3 BASES LÉGALES..............................................................................................................................8 1.4 LE SYSTÈME DES DISPOSITIONS DE LA LEAUX SUR LES DÉBITS RÉSIDUELS................10 /¶$8725,6$7,21'(35e/Ê9(0(17'¶($8 2.1 PRÉLÈVEMENTS D’EAU SOUMIS À AUTORISATION ............................................................13 2.2 CONDITIONS POUR L’OCTROI DE L’AUTORISATION ...........................................................19 -

Dischmatal: Dürrboden – Davos-Dorf (Jakobsweg)
Dischmatal: Dürrboden – Davos-Dorf (Jakobsweg) Wegbeschrieb mittel 3 h 12.8 km 88 Hm 533 Hm Dürrboden Rest. Teufi Jun – Okt | | | | | Ausgangspunkt der Wanderung ist die Bushaltestelle Davos Dischma, Dürrboden. Gleich bei der Bushaltestelle findet man eine Einkehr- und Übernachtungsmöglichkeit im Berggast- Wanderung im Dischma Hochtal, dem längsten Davoser Seitental. Von Dürrboden geht es haus Dürrboden (+41 81 416 34 14). Das Berggasthaus ist in der Stromversorgung durch eine auf dem Jakobsweg durch das romantische Dischmatal mit vereinzelten Stallungen und eigene Wasserturbine weitgehend autark. Im Gastraum wird mit einem kanadischen Holz- typischen Walserhäusern nach Davos Dorf. ofen, einem sogenannten «Bullerjan», eingeheizt. Das benötigte Trink- und Brauchwasser Früher ein wichtiger Saumweg über den Scalettapass ins Engadin, wo gerne Wein aus liefert eine geprüfte hauseigene Quelle. Wer hier einkehrt, geniesst eine herrliche Aussicht dem Veltlin importiert wurde. So hört man heute nur das Rauschen des Dischmabaches. über Alpenrosenwiesen hinauf zum Scalettagletscher. Ein Traum für Ruhesuchende. Die Alp Dürrboden liegt in der gebirgigen Abgeschiedenheit des Dischmatales am Tal- schluss des geschichtsträchtigen Scalettapasses und am Übergang zum Fuorcla da Gria- Ausgangspunkt: Dürrboden – Bushaltestelle letsch. Der Scalettapass war im Spätmittelalter und in der Frühneuzeit für den Weinimport Endpunkt: Davos Dorf – Bahnhof aus dem Veltlin nach Davos von Bedeutung. Zudem wurde das lebensnotwendige Salz aus Einkehr: Unterkunft -

Hydrologic Similarity of River Basins Through Regime Stability
DIPARTIMENTO DI IDRAULICA, TRASPORTI ED INFRASTRUTTURE CIVILI POLITECNICO DI TORINO Chiara Barberis1, Peter Molnar2, Pierluigi Claps1, Paolo Burlando2 (1) Politecnico di Torino [ [email protected] ] [ [email protected] ] (2) ETH Zurich [ [email protected] ] [ [email protected] ] HYDROLOGIC SIMILARITY OF RIVER BASINS THROUGH REGIME STABILITY Working Paper 2003 - 03 Ottobre 2003 Abstract The seasonality of streamflow can vary widely from river to river and is influenced mostly by the local seasonal cycles of precipitation and evaporation demand, by the timing of snowmelt (if any), as well as by travel times of the groundwater component of runoff. Traditionally, streamflow regimes have been analyzed from a static point of view to produce classifications useful to a prior general understanding of the similarità and differences of different rivers across wide regions. Methods for systematic clas-sification have been proposed in the recent years but rarely quantitative values have been provided to characterise numerically specific features of the seasonal evolution of streamflows. The aim is twofold: (1) to select some quantitative indices able to objectively distinguish slightly or greatly different average seasonal streamflow pat-terns, and (2) to use some of the above indices to detect possible changes in the seasonality of streamflows over the last 30 years, which may be the result of a natural or anthropogenic non- stationarity. Indices used to investigate task (1) are essentially obtained through Fourier analysis, moments and the Informational Entropy Concept. Similar indices have been adapted to the 12-months runoff sequence over the data record length and used to investigate task (2). The analysis has been carried out on 53 basins in Switzerland, on data records related to the period 1971-2000, showing that the envisaged seasonal indices have a good capability of discrimination of rivers with different climatic and physiographic characteristics, which makes the work in-teresting for validation of hydrological mapping studies. -

02B Allg Bestimmungenwildsch.Indd
AMTLICHE PUBLIKATIONEN ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN ÜBER DIE WILDSCHUTZGEBIETE Gestützt auf Art. 28 Abs. 2 und Art. 38 des kantonalen Jagdgesetzes von der Regierung erlassen am 18. Mai 2010 I. Bezeichnung, Beschrieb und Kennzeichnung Allgemeine Bezeichnung Die Wildschutzgebiete im Kanton Graubünden werden wie folgt un- der Wildschutzgebiete terschieden: A. Schweizerischer Nationalpark; B. Eidgenössische Jagdbanngebiete; C. Kantonale Wildschutzgebiete. Bezeichnung der kanto- Die kantonalen Wildschutzgebiete werden in allgemeine und be- nalen Wildschutzgebiete sondere Wildschutzgebiete unterteilt. Bezeichnung der beson- Den besonderen Wildschutzgebieten werden folgende Wildasyle zu- deren Wildschutzgebiete geordnet: a) Hochjagdasyle; b) Rehasyle; c) Murmeltierasyle; d) Niederjagdasyle; e) Hasenasyle; f) Federwildasyle; g) Wasserflugwildasyle. Beschrieb Für die Grenzen des Schweizerischen Nationalparkes ist die nachgeführte und jeweils aktuelle Landeskarte 1:25'000 massgebend. Die eidgenössischen Jagdbanngebiete und die kantonalen Wildschutz- gebiete sowie deren Grenzverlauf sind im Anhang nach Jagdbezirken auf- geführt. Der Grenzverlauf wird im Uhrzeigersinn nach den Landeskarten 1:25'000 beschrieben. Soweit erforderlich, werden zusätzlich lokale Orts- bezeichnungen verwendet. Grenzen von Wasserflugwildasylen, die durch einen bestimmten Abstand zum Gewässer (z.B. Uferstreifen von 100 m) definiert sind, werden im Ge- lände nicht markiert. Kennzeichnung Die Grenze des Schweizerischen Nationalparkes ist mit gelber Farbe mar- kiert. Die Grenzen -

Topografische Flussanalysen Im Quellgebiet Des Rheins Bericht
Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport VBS armasuisse Bundesamt für Landestopografie swisstopo Bereich Topografie Topografische Flussanalysen im Quellgebiet des Rheins Bericht Berechnungen, Grafik Guillaume Condé Topografie TGMM Cédric Métraux Topografie TGMM Koordination und Text Martin Rickenbacher Topografie TGA Schlussversion vom 15. September 2011 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung............................................................................................................................................ 3 2 Zur Rolle von swisstopo im Fragenkontext ........................................................................................ 3 3 Definitionen ........................................................................................................................................ 4 3.1 Bezugspunkt.......................................................................................................................... 4 3.2 Einzugsgebiete ...................................................................................................................... 5 4 Quellen und Längen........................................................................................................................... 6 4.1 Vorderrhein............................................................................................................................ 6 4.2 Rein da Maighels................................................................................................................... 7 4.3 -

Jagd- Und Fischereiinspektorat Des Kantons Graubünden
Anhang/Appendice: Wildschutzgebiete im Kanton Graubünden Zone di protezione della selvaggina nel Cantone dei Grigioni A. SCHWEIZERISCHER NATIONALPARK / PARC NAZIUNAL SVIZZER / PARCO NAZIONA- LE SVIZZERO (SNP/PNS) Die Grenzen des Nationalparkes (SNP) sind in der Landeskarte 1:25’000 eingezeichnet. Allfällige Änderun- gen sind in den Jagdbetriebsvorschriften aufgeführt. I confini del Parco Nazionale Svizzero (PNS) sono indicati nella carta topografica 1 : 25’000. Eventuali modifiche sono elencate nelle prescrizioni per l’esercizio della caccia. B. EIDGENÖSSISCHE JAGDBANNGEBIETE / BANDITE FEDERALI Jagdbezirke I und II / Districts da catscha I e II 100. Pez Vial-Greina GR: Camona da Medel (CAS), tabla – marcau – tabla – marcau – fil – Pez Casch- leglia – fil – Denter Corns – fil – Pez Santeri – marcau – Fuorcla da Stavelatsch – tabla – marcau – Pez Stavelatsch – fil – Pez Rentiert – marcau – tablas – marcau – Cuolmet – marcau – Muota la Tieua – tablas – marcau – Rein da Vigliuts – marcau – punt da Vigliuts, tabla – marcau – tabla – marcau – punt dils Clavaus – marcau – tabla – marcau – trutg dalla Camona da Terri – marcau – Crest la Greina – tablas – marcau – fil – Pez Miezdi – Pez da Stiarls – Pez Greina – cunfin da vischnaunca Sum- vitg/Vrin – Pt. 2652 – Pt. 2265 – tabla – Muot la Greina – Pt. 2194 – tabla – marcau – Camona – trutg Pass Diesrut – marcau – Pt. 2356 – marcau – Pass Diesrut – tabla – marcau – Pez Stgir – Pez Zamuor – fil – Pez Canal – Pt. 2822 – marcau – Fuorcla da Blengias – tabla – Pt. 2862 – Pez Terri – cunfin dil cantun Grischun/Tessin – Pt. 2898 – Pez Güida – Pez Ner – Crap la Crusch – tabla – marcau – Pt. 2439 – Pez Coroi – Pt. 2735 – marcau – Pass dalla Greina (Pass Crap) – tabla – Pt. 2604 – Pez Gagli- anera – Pez Valdraus – tabla – Fuorcla Sura da Lavaz – Pez Medel – Refugi da Camutschs – marcau – Denter Auas – marcau – Rein da Plattas – marcau – trutg dalla Camona da Medel – tabla – marcau – Fuorcla da Lavaz – tabla – marcau – Pt. -

Bericht Gesunde Fliessgewässer
INTERNATIONALE REGIERUNGSKOMMISSION ALPENRHEIN Gesunde Fliessgewässer durch Revitalisierung 1997 1998 1999 Anleitung zu Revitalisierungsmassnahmen an Alpenrheinzuflüssen und Bächen im Rheintal Impressum Mitglieder der Arbeitsgruppe: Amt für Umweltschutz, Fürstentum Liechtenstein, FL; T. Kindle, St. Hassler Jagd- und Fischereiinspektorat, Kt.Graubünden, CH; G. Ackermann Amt für Jagd und Fischerei des Kt. St. Gallen, CH; C. Ruhlé, Planungsamt Kt. St. Gallen, Abt. Natur- u. Landschaftsschutz; A. Brülisauer Amt der Vorarlberger Landesregierung, A; B. Wagner Landeswasserbauhof Vorarlberg, A; M. Weiss Autoren und Layout: P. Rey, J. Ortlepp, Büro HYDRA, Konstanz, D Ergänzende Unterlagen lieferten: Universität für Bodenkultur Wien, A: J. Eberstaller, E. Schager Fotonachweis: G.Ackermann; A. Brülisauer; St. Hassler; T.Kindle; P.Pitsch; P.Rey; O.Sohm; H.Wildhaber; AfU FL; H.Jenny; Planungsamt SG. Fischzeichnungen: B. Gysin Die Fische und Krebse der Schweiz Bezugsquelle: Die Broschüre ist bei den zuständigen Ämtern (Adressen im Anhang) gegen eine Schutzgebühr von CHF 10.- (ATS 90.-) zu beziehen © Internationale Regierungskommission Alpenrhein März 2000 Titelbild: Revitalisierung des Koblacher Kanals (Vorarlberg, Österreich). 2 INTERNATIONALE REGIERUNGSKOMMISSION ALPENRHEIN Gesunde Fliessgewässer durch Revitalisierung Anleitung zu Revitalisierungsmassnahmen an Alpenrheinzuflüssen und Bächen im Rheintal Das Alpenrheintal vor 180 Jahren - romantische Erinnerung oder Referenz für zukünftige Revitalisierungsmass- nahmen? 3 Information Inhalt Impressum