NET.WORX 54 | Phraseologismen Im Spielfilm. Eine Theoretische
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

James Bond in Our Sights: a Close Look at 'A View to a Kill
James Bond in Our Sights: A Close Look at 'a View to a Kill' - Andrew Mcness - 2011 - 124 pages - Author Solutions, 2011 - 9781465382399 DailyMail.com tracked down the 81-year-old's home to a quiet community just outside the coastal city of Arecibo on Puerto Rico's north coast. Blue tarps are seen atop her grandmother's home, which appears to still sustain damage since the passing of Hurricane Maria and Hurricane Irma. A woman who identified herself as AOC's aunt told us, 'We are private people, we don't talk about our family. We don't speak for the community'. Her aunt said: 'In this area people need a lot of help. Largely seen by fans and critics alike as the overly-formulaic orphan child of the 1970’s smash Bond hits, A View To A Kill (1985), the 14th instalment of the modern cinematic classic, is the film in question in Andrew McNess’s "James Bond In Our Sights". McNess puts up an exuberant display of a film critic’s sharp, trenchant observations and a complete fan’s reverence for the condign qualities of Ian Fleming’s cool and womanising spy-hero. The film marked Roger Moore’s final performance as Agent 007. However, in the author’s superbly well-reasoned contention, A View to a Kill's intriguing, ev But a closer look at character motivation, development, relationships, and some plot structure shows that the film actually goes out of it's way to try something new, on a rather epic canvas. I found this aspect of the book fascinating and it made me re-watch the movie with a new sense of appreciation. I am already a huge supporter of the underrated A View to a Kill and was quite delighted to find this book. -

Things Are Not Enough Bond, Stiegler, and Technics
Things Are Not Enough Bond, Stiegler, and Technics CLAUS-ULRICH VIOL Discussions of Bond’s relationship with technology frequently centre around the objects he uses, the things he has at his disposal: what make is the car, what products have been placed in the flm, are the flm’s technical inventions realistic, visionary even !his can be observed in cinema foyers, fan circles, the media, as well as academia. #$en these discussions take an admiring turn, with commentators daz%led by the technological foresight of the flmic ideas; ' quite ofen too, especially in academic circles, views tend to be critical, connecting Bond’s technological overkill to some compensatory need in the character, seeing the technological objects as (props) that would and should not have to be ' *ee, for instance, publications like The Science of James Bond by Gresh and ,einberg -.//01, who set out to provide an “informative look at the real2world achievements and brilliant imaginations) behind the Bond gadgets, asking how realistic or “fant2 astic) the adventures and the equipment are and promising to thus probe into (the limits of science, the laws of nature and the future of technology” -back cover1" 3arker’s similar Death Rays, Jet Packs, Stunts and Supercars -.//41 includes discussions of the physics behind the action scenes -like stunts and chases1, but there remains a heavy preponderance of (ama%ing devices), (gadgets and gi%mos), “incredible cars), (reactors) and (guns) -v2vi1" ,eb pages and articles about (Bond Gadgets that 5ave Become 6eal), “Bond Gadgets 7ou 8an 9ctually Buy”, “Bond Gadgets that 8ould ,ork in 6eal :ife) and the like are legion. -

The 007Th Minute Ebook Edition
“What a load of crap. Next time, mate, keep your drug tripping private.” JACQUES A person on Facebook. STEWART “What utter drivel” Another person on Facebook. “I may be in the minority here, but I find these editorial pieces to be completely unreadable garbage.” Guess where that one came from. “No, you’re not. Honestly, I think of this the same Bond thinks of his obituary by M.” Chap above’s made a chum. This might be what Facebook is for. That’s rather lovely. Isn’t the internet super? “I don’t get it either and I don’t have the guts to say it because I fear their rhetoric or they’d might just ignore me. After reading one of these I feel like I’ve walked in on a Specter round table meeting of which I do not belong. I suppose I’m less a Bond fan because I haven’t read all the novels. I just figured these were for the fans who’ve read all the novels including the continuation ones, fan’s of literary Bond instead of the films. They leave me wondering if I can even read or if I even have a grasp of the language itself.” No comment. This ebook is not for sale but only available as a free download at Commanderbond.net. If you downloaded this ebook and want to give something in return, please make a donation to UNICEF, or any other cause of your personal choice. BOOK Trespassers will be masticated. Fnarr. BOOK a commanderbond.net ebook COMMANDERBOND.NET BROUGHT TO YOU BY COMMANDERBOND.NET a commanderbond.net book Jacques I. -

Bakalářská Práce
TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LIBEREC 2011 LUCIE MICHALCOVÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BOND GIRLS BOND GIRLS LIBEREC 2011 LUCIE MICHALCOVÁ Poděkování Děkuji vedoucí bakalářské práce Mgr. Art Zuzaně Veselé za odborné rady a konzultace. Dále bych chtěla poděkovat Bc. Jakubovi Viktorovi za nafocení celé kolekce a modelkám Dominice a Katce. Děkuji také prodejně MIXER za zapůjčení obuvi. www.mixershoes.com Anotace Bakalářská práce se zabývá tématikou filmů o Jamesi Bondovi, konkrétně o Bond girls. V teoretické části je vypsaná chronologie všech filmů a hlavních hereckých představitelů Jamese Bonda. Dále je popsán stručný děj vybraných filmů a úlohy hlavních hrdinek. Je zde sledováno hlavně jejich odívání a kostýmy. U kaţdého filmu je zmíněn kostýmní výtvarník nebo designér, který modely vytvářel. Praktická část zahrnuje kolekci osmi modelů, určených pro budoucí Bond girls. Klíčová slova: filmy, James Bond, Bond girls, móda, kostýmy Annotation This project concerns about the theme of James Bond’s films, concretely about Bond girls. Theory part deals with chronology of all films and principal actors of James Bond. There is a jot description of selected films and roles of main female creatress. Their fashion and costumes is observed there. In every film there is a forenamed costumes artist or designer who created models. Practical part includes collection of eight models designate for future bond girls. Keywords: films, James Bond, Bond girls, fashion, costumes OBSAH 1 ÚVOD....................................................................................................................... -
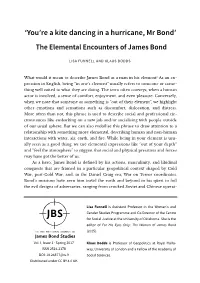
Re a Kite Dancing in a Hurricane, Mr Bond’ the Elemental Encounters of James Bond
‘You’re a kite dancing in a hurricane, Mr Bond’ The Elemental Encounters of James Bond LISA FUNNELL AND KLAUS DODDS What would it mean to describe James Bond as a man in his element? As an ex- pression in English, being “in one’s element” usuall refers to someone or some- thing well suited to what the are doing. #he term often con%e s, when a human actor is in%ol%ed, a sense of comfort, en&o ment, and e%en pleasure. 'on%ersel , when we note that someone or something is “out of their element”, we highlight other emotions and sensations such as discomfort, dislocation, and distress. (ore often than not, this phrase is used to describe social and professional cir- cumstances li)e embar)ing on a new &ob and*or socialising with people outside of our usual sphere. But we can also mobilise this phrase to draw attention to a relationship with something more elemental, describing human and non-human interactions with water, air, earth, and +re. While being in our element is usu- all seen as a good thing, we use elemental expressions li)e “out of our depth” and “!eel the atmosphere” to suggest that social and ph sical pressures and !orces ma ha%e got the better of us. As a hero, James Bond is defined b his actions, masculinit , and libidinal con,uests that are !ramed in a particular geopolitical context shaped b 'old War, post-Cold War, and, in the -aniel 'raig era, War on #error coordinates. Bond’s missions ha%e seen him tra%el the earth and be ond in his ,uest to !oil the e%il designs of ad%ersaries, ranging !rom crooked So%iet and 'hinese operat- Lisa Funnell is Assistant Professor in the Women’s and Gender Studies Programme and Co-Director of the Centre for Social Justice at the University of Oklahoma. -

2017 James Bond Archives
2017 James Bond Archives - Final Edition Checklist Base Cards # Card Title [ ] 01 Die Another Day [ ] 02 Die Another Day [ ] 03 Die Another Day [ ] 04 Die Another Day [ ] 05 Die Another Day [ ] 06 Die Another Day [ ] 07 Die Another Day [ ] 08 Die Another Day [ ] 09 Die Another Day [ ] 10 Die Another Day [ ] 11 Die Another Day [ ] 12 Die Another Day [ ] 13 Die Another Day [ ] 14 Die Another Day [ ] 15 Die Another Day [ ] 16 Die Another Day [ ] 17 Die Another Day [ ] 18 Die Another Day [ ] 19 Die Another Day [ ] 20 Die Another Day [ ] 21 Die Another Day [ ] 22 Die Another Day [ ] 23 Die Another Day [ ] 24 Die Another Day [ ] 25 Die Another Day [ ] 26 Die Another Day [ ] 27 Die Another Day [ ] 28 Die Another Day [ ] 29 Die Another Day [ ] 30 Die Another Day [ ] 31 Die Another Day [ ] 32 Die Another Day [ ] 33 Die Another Day [ ] 34 Die Another Day [ ] 35 Die Another Day [ ] 36 Die Another Day [ ] 37 Die Another Day [ ] 38 Die Another Day [ ] 39 Die Another Day [ ] 40 Die Another Day [ ] 41 Die Another Day [ ] 42 Die Another Day [ ] 43 Die Another Day [ ] 44 Die Another Day [ ] 45 Die Another Day [ ] 46 Die Another Day [ ] 47 Die Another Day [ ] 48 Die Another Day [ ] 49 Die Another Day [ ] 50 Die Another Day [ ] 51 Die Another Day [ ] 52 Die Another Day [ ] 53 Die Another Day [ ] 54 Die Another Day [ ] 55 Die Another Day [ ] 56 Die Another Day [ ] 57 Die Another Day [ ] 58 Die Another Day [ ] 59 Die Another Day [ ] 60 Die Another Day [ ] 61 Die Another Day [ ] 62 Die Another Day [ ] 63 Die Another Day [ ] 64 Die Another Day [ ] 65 Die Another -

Bakalářská Práce
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA Bakalářská práce Olomouc 2014 Pavlína Rupová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA Katedra divadelních, filmových a mediálních studií VÝVOJ A PROMĚNY ZOBRAZOVÁNÍ BOND GIRL VE FILMOVÉ SÉRII O JAMESI BONDOVI Bakalářská práce Autor: Pavlína Rupová Vedoucí práce: Mgr. Luboš Ptáček, Ph.D. Olomouc 2014 Prohlášení Místopřísežně prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma: „Vývoj a proměny zobrazování Bond girl ve filmové sérii o Jamesi Bondovi“ vypracovala samostatně pod odborným dohledem vedoucího práce a uvedla jsem všechny použité podklady a literaturu. V Olomouci dne Podpis Mé poděkování patří Mgr. Luboši Ptáčkovi, Ph.D. za odborné vedení, trpělivost a ochotu, kterou mi v průběhu zpracování bakalářské práce věnoval. Dále děkuji svému otci za to, že mě seznámil s bondovkami. .......................................................... podpis NÁZEV: Vývoj a proměny zobrazování Bond girl ve filmové sérii o Jamesi Bondovi AUTOR: Pavlína Rupová KATEDRA: Katedra divadelních, filmových a mediálních studií VEDOUCÍ PRÁCE: Mgr. Luboš Ptáček, Ph.D. ABSTRAKT: Bakalářská práce se zabývá proměnou zobrazování a vývojem Bond girl (Bondovy dívky) ve filmové sérii o Jamesi Bondovi a definuje pojem Bond girl. Zároveň vymezuje specifické postavení dalších ženských hrdinek Moneypenny a ženské představitelky 'M'. Práce analyzuje vybrané hlavní Bond girls ve vztahu k Jamesi Bondovi a jejich měnící se úlohu v sérii i s ohledem na měnící se postavení žen ve společnosti. Tyto proměny jsou zachyceny ve třech historických obdobích Bond girls, které reflektují společenské změny dané doby. Metodologicky práce vychází z feministických filmových teorií. Bond girls v průběhu více než pěti dekád prošly řadou změn, které se nejvíce odrazily ve vztahu Bond girl-Bond a také v úloze, kterou ve filmech mají – ženské postavy jsou více emancipované a samostatné. -

The Quantum of Missus Guide to the James Bond Films
THE QUANTUM OF MISSUS GUIDE TO THE JAMES BOND FILMS Bond : Barry Nelson as CIA agent “card sense” Jimmy Bond Villains : Le Chiffre (Peter Lorre) Allies : Valerie Mathis Clarence Leiter Locations: France Villain’s Plot: Le Chiffre intends to win at baccarat in order to make money for the USSR The one with: black and white TV show Bond : Sean Connery Villains : Dr. No Allies : Honey Ryder (Ursula Andress) Felix Leiter (Jack Lord) M (Bernard Lee) Miss Moneypenny (Lois Maxwell) Sylvia Trench Gadgets: Geiger counter Locations: Jamaica Villain’s Plot: Jamming US and Soviet rocket controls and communications on behalf of SPECTRE and to get revenge for his seeking employment with both superpowers being declined. Theme song : James Bond Theme, Three Blind Mice, Under The Mango Tree The one with: the woman in the white bikini coming out of the sea; Bond being a “very nerrr-vus passin-jurr” Bond : Sean Connery Villains : Ernst Stavro Blofeld (unseen) Rosa Klebb “Red” Grant Allies: Tatiana Romanova Kerim Bey M Major Boothroyd/Q (Desmond Llewelyn) Miss Moneypenny Gadgets: Briefcase containing gold sovereigns, knife, exploding capabilities, compact rifle and ammunition Locations: Istanbul, Venice Villain’s plot: Recently defected SMERSH agent Rosa Klebb is charged by Blofeld, head of SPECTRE, with carrying out a plot to embarrass the Russians and the British by (a) stealing a coding machine from the Russians and (b) filming Bond having sex with the Russian cipher clerk who, believing she is working under Moscow’s orders, will entice him to Istanbul -

Scientists in the Bond Film Franchise Claire Hines, Solent University
Scientists in the Bond film franchise Claire Hines, Solent University Abstract The James Bond film franchise (1962–ongoing) has always relied on science and technology for topicality and spectacle. Over the years, the scientist figure has also made regular appearances in the Bond films, most often within the confines of some of the established character types and functions defined by the formula aspects of the series – the villain, the Bond girl and the Quatermaster, better known as Q. This article uses Bond scholarship to consider key examples of each of these depictions of the scientist in relation to the heroic masculinity of James Bond, and in the broader context of research examining images of scientists in popular fiction. In so doing the article contributes to ongoing debates about the representational politics of Bond and scientist stereotypes in popular culture. Keywords James Bond Bond girl Quatermaster scientist stereotypes Bond films mad scientist 1 The James Bond film franchise began with the release of Dr No (Young 1962), a film of many notable firsts for the long-running and highly formulaic series. These important firsts include the introduction of Sean Connery as James Bond, the introduction of the criminal organization SPECTRE and the first major Bond villain, the first of the Bond girls and a number of key recurring characters. Even though some changes were made to the novel written by Ian Fleming and published in 1958, the film nevertheless follows the same storyline: Bond is sent by the British Secret Service to Jamaica, where he uncovers an evil plot headed by a scientific mastermind. -
Les Noms Entre Parenthèses Sont Les Interprètes Des James Bond Girls Et Des Ennemis Titre Français Titre Original Année Réalisateur 007 Méchant Alliés
Titre français Titre original Année Réalisateur 007 Méchant Alliés James Bond 007 contre Dr. No Dr. No 1962 Terence Young Sean Connery Julius No (Joseph Wiseman) Honeychile Ryder (Ursula Andress) - Félix Leiter - Quarrel From Russia with Bons baisers de Russie 1963 Terence Young Sean Connery Rosa Klebb (Lotte Lenya) Tatiana « Tania » Romanova (Daniela Bianchi) - Ali Kerim Bey, Love Pussy Galore (Honor Blackman) - Jill Masterson (Shirley Eaton) - Tilly Goldfinger Goldfinger 1964 Guy Hamilton Sean Connery Auric Goldfinger (Gert Fröbe) Masterson - Félix Leiter Domino Vitali-Derval (Claudine Auger) - Félix Leiter - Paula Caplan Opération Tonnerre Thunderball 1965 Terence Young Sean Connery Emilio Largo (Adolfo Celi) On ne vit que deux fois You Only Live Twice 1967 Lewis Gilbert Sean Connery Ernst Stavro Blofeld (Donald Pleasence) Aki (Akiko Wakabayashi) - Tigre Tanaka - Kissy Suzuki ( Mie Hama) On Her Majesty's Comtesse Teresa « Tracy » di Vincenzo (Diana Rigg) - Marc-Ange Au service secret de Sa Majesté 1969 Peter Roger Hunt George Lazenby Ernst Stavro Blofeld (Telly Savalas) Secret Service Draco - Shaun Campbell Diamonds are Les diamants sont éternels 1971 Guy Hamilton Sean Connery Ernst Stavro Blofeld (Charles Gray) Tiffany Case (Jill St John ) - Félix Leiter forever Vivre et laisser mourir Live and Let Die 1973 Guy Hamilton Roger Moore Dr Kananga (Yaphet Kotto) Solitaire (Jane Seymour) - Félix Leiter - Quarrel Fils The Man with the Andrea Anders (Maud Adams) - Lieutenant Hip - Mary Bonne-Nuit L'Homme au pistolet d'or 1974 Guy Hamilton Roger Moore Francisco Scaramanga (Christopher Lee) Golden Gun (Britt Ekland) The Spy Who Loved L'Espion qui m'aimait 1977 Lewis Gilbert Roger Moore Karl Stromberg (Curd Jürgens ) Major Anya Amasova / Triple-X (Barbara Bach) - Cheikh Hosein Me Dr. -

James Bond Et Le Dirigeant : « Presque 007 » Points Communs
James Bond et le Dirigeant : « presque 007 » points communs Sans être un dirigeant lui-même1, James Bond 007, le plus célèbre2 des agents secrets, a des points communs avec ce métier. Il a un objectif clairement identifié (sauver le monde). Il est soumis à une très forte pression (temps limité pour réussir, avec un minimum d’informations), dans un contexte hostile (ennemis intelligents, voire hyper-intelligents, pervers, puissants, excessivement bien organisés avec des équipements modernes et innovants). Il est seul. Son succès depuis près de 60 ans et, bientôt, 25 missions3, peut-il être une source d’inspiration pour le dirigeant ? A travers une revue de tous les films interprétés par Sean Connery4, Georges Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan et Daniel Craig, nous allons identifier des comportements, actions et scènes qui semblent répondre positivement à cette question. Nous verrons que 007 n’a pas l’exclusivité des inspirations pour l’action, mais que les méchants, parce qu’aussi dirigeants, peuvent nous inspirer, même si souvent c’est pour illustrer les actions et comportements à éviter, parfois le film lui-même, de par son histoire, peut être source d’enseignements. 1 Notamment, il n’a pas vraiment d’équipe à manager 2 ce qui est une incohérence : un agent secret, par définition, doit « être secret » donc inconnu ; James Bond est connu de tous ses ennemis, y compris ses faiblesses, voire ses vices. 3 Nous n’avons retenu ni la version parodique Casino Royale de 1967 où 007 est interprété par David Niven et le méchant par Woody Allen, car la loufoquerie lui a retiré tout caractère d’exemplarité, au sens de respect des codes fondamentaux, ni Jamais plus jamais de 1983 où Sean Connery a réendossé le smoking, 12 ans après sa dernière interprétation, avec un « recul » peu respectueux des codes de la saga officielle, à la limite de la parodie. -

Sean Connery Bond Girl: Ursula Andress
1. James Bond: Dr. No (1962) 5. James Bond: You Only Live Twice 007 played by: Sean Connery (1967) Bond Girl: Ursula Andress (Honey Rider) 007 played by: Sean Connery Bond Girl: Akiko Wakabayashi (Aki) 2. James Bond: From Russia With Love (1963) 6. James Bond: On Her Majesty’s Secret 007 played by: Sean Connery Service (1969) Bond Girl: Daniela Bianchi (Tatiana 007 played by: George Lazenby Romanova) Bond Girl: Dianna Rigg (Tracy di Vicenzo) 3. James Bond: Goldfinger (1964) 7. James Bond: Diamonds Are Forever 007 played by: Sean Connery (1971) Bond Girl: Honor Blackman (Pussy Galore) 007 played by: Sean Connery Bond Girl: Jill St. John (Tiffany Case) 8. James Bond: Live And Let Die (1973) 4. James Bond: Thunderball (1965) 007 played by: Roger Moore 007 played by: Sean Connery Bond Girl: Jane Seymour (Solitaire) Bond Girl: Claudine Auger (Domino) 9. James Bond: The Man With The Golden 13. James Bond: Octopussy (1983) Gun (1974) 007 played by: Roger Moore 007 played by: Roger Moore Not really a Bond Girl: Maud Adams Bond Girl: Britt Ekland (Mary Goodnight) (Octopussy) 10. James Bond: The Spy Who Loved Me (1977) 007 played by: Roger Moore 13,5. James Bond: Never Say Never Again Bond Girl: Barbara Bach (Major Anya (1983) Amasova) 007 played by: Sean Connery Bond Girl: Barbara Carrera (Fatima Blush) 11. James Bond: Moonraker (1979) 007 played by: Roger Moore 14. James Bond: A View To A Kill (1985) Bond Girl: Lois Chiles (Dr. Holly 007 played by: Roger Moore Goodhead) Bond Girl: Tanya Roberts (Stacey Sutton) 12.