Jahrbuch Des Historischen Kollegs 1998
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Unique Cultural & Innnovative Twelfty 1820
Chekhov reading The Seagull to the Moscow Art Theatre Group, Stanislavski, Olga Knipper THE UNIQUE CULTURAL & INNNOVATIVE TWELFTY 1820-1939, by JACQUES CORY 2 TABLE OF CONTENTS No. of Page INSPIRATION 5 INTRODUCTION 6 THE METHODOLOGY OF THE BOOK 8 CULTURE IN EUROPEAN LANGUAGES IN THE “CENTURY”/TWELFTY 1820-1939 14 LITERATURE 16 NOBEL PRIZES IN LITERATURE 16 CORY'S LIST OF BEST AUTHORS IN 1820-1939, WITH COMMENTS AND LISTS OF BOOKS 37 CORY'S LIST OF BEST AUTHORS IN TWELFTY 1820-1939 39 THE 3 MOST SIGNIFICANT LITERATURES – FRENCH, ENGLISH, GERMAN 39 THE 3 MORE SIGNIFICANT LITERATURES – SPANISH, RUSSIAN, ITALIAN 46 THE 10 SIGNIFICANT LITERATURES – PORTUGUESE, BRAZILIAN, DUTCH, CZECH, GREEK, POLISH, SWEDISH, NORWEGIAN, DANISH, FINNISH 50 12 OTHER EUROPEAN LITERATURES – ROMANIAN, TURKISH, HUNGARIAN, SERBIAN, CROATIAN, UKRAINIAN (20 EACH), AND IRISH GAELIC, BULGARIAN, ALBANIAN, ARMENIAN, GEORGIAN, LITHUANIAN (10 EACH) 56 TOTAL OF NOS. OF AUTHORS IN EUROPEAN LANGUAGES BY CLUSTERS 59 JEWISH LANGUAGES LITERATURES 60 LITERATURES IN NON-EUROPEAN LANGUAGES 74 CORY'S LIST OF THE BEST BOOKS IN LITERATURE IN 1860-1899 78 3 SURVEY ON THE MOST/MORE/SIGNIFICANT LITERATURE/ART/MUSIC IN THE ROMANTICISM/REALISM/MODERNISM ERAS 113 ROMANTICISM IN LITERATURE, ART AND MUSIC 113 Analysis of the Results of the Romantic Era 125 REALISM IN LITERATURE, ART AND MUSIC 128 Analysis of the Results of the Realism/Naturalism Era 150 MODERNISM IN LITERATURE, ART AND MUSIC 153 Analysis of the Results of the Modernism Era 168 Analysis of the Results of the Total Period of 1820-1939 -

Ausgewählte Literatur
Ausgewählte Literatur Adolf Eichmann Anton Weber _ Angerer, Christian/Maria Ecker: Nationalsozialismus in Oberösterreich. Opfer – _ Bailer-Galanda, Brigitte/Eva Blimlinger/Susanne Kowarc: „Arisierung“ und Täter – Gegner. Innsbruck 2014. Rückstellung von Wohnungen in Wien. Die Vertreibung der jüdischen Mieter und _ Höss, Dagmar/Monika Sommer/Heidemarie Uhl: 1914 – 1933, Bischofstraße 3. Mieterinnen aus ihren Wohnungen und das verhinderte Wohnungsrück- In: In Situ. Zeitgeschichte findet Stadt: Linz im Nationalsozialismus. Linz 2009. stellungsgesetz. Wien 2000. Online verfügbar unter: http://www.insitu-linz09.at/de/orte/21-orte-bischof _ Hoffer, Gerda/Judith Hübner: Zwei Wege ein Ziel – Zwei Frauenschicksale strasse-3.html zwischen Wien und Jerusalem. Hg. von Evelyn Adunka und Konstantin Kaiser. _ Stiftung Deutsches Historisches Museum (Hg.): Adolf Eichmann 1906-1962. Wien 2011. In: LeMO – Lebendiges Museum Online. Online verfügbar unter: _ Walzer, Tina: Unser Wien. „Arisierung“ auf österreichisch. In: David – Jüdische https://www.dhm.de/lemo/biografie/adolf-eichmann Kulturzeitschrift. Heft Nr. 51, Ebenfurth 2001. Online verfügbar unter: http://www.david.juden.at/kulturzeitschrift/50-54/Main%20frame_Artikel51_ Walzer.htm Adolf Hitler _ Bauer, Kurt: Nationalsozialismus. Wien 2008. _ Sandkühler, Thomas: Adolf H. Lebensweg eines Diktators. München 2015. Baldur von Schirach _ Knopp, Guido: Hitlers Helfer. Täter und Vollstrecker. München 1998. _ Schirach, Richard von: Der Schatten meines Vaters. München 2005. Anonym _ Wortmann, Michael: Baldur von Schirach. Hitlers Jugendführer. Böhlau 1982. _ Bailer-Galanda, Brigitte/Eva Blimlinger/Susanne Kowarc: „Arisierung“ und Rückstellung von Wohnungen in Wien. Die Vertreibung der jüdischen Mieter und Mieterinnen aus ihren Wohnungen und das verhinderte Wohnungsrück- Deutsche Frauen im Osten stellungsgesetz. Wien 2000. _ Harvey, Elisabeth: „Der Osten braucht dich!“ Frauen und nationalsozialistische _ Exenberger, Herbert/Johann Koß/Brigitte Ungar-Klein: Kündigungsgrund Germanisierungspolitik. -

17 Small Historic Towns in Austria
17 SMALL 2021/2022 HISTORIC TOWNS IN AUSTRIA SEE EXPERIENCE ENJOY SMALL HISTORIC TOWNS www.khs.info SMALL HISTORIC TOWNS WHAT MAKES US STAND OUT: Well-preserved historic townscapes Heritage buildings and landmarks Spectacular surrounding landscapes Scheduled tours with qualified guides Varied, high-quality events and shows Traditional weekly markets Traditional crafts in that you can experience first-hand Tourist attractions and experiences Lively cultural programmes Refined cuisine Unique shopping Medieval town charters Populations of less than 45,000 SMALL HISTORIC TOWNS IN AUSTRIA Stadtplatz 27 | 4402 Steyr | Austria Tel. +43 72 52 522 90 [email protected] | www.khs.info EXPLORE EACH TOWN IN 48 HOURS ... SEE EXPERIENCE ENJOY EDITORIAL / MAP 4 – 5 1 BADEN bei WIEN The furnished garden 6 – 13 2 BAD ISCHL Tradition and modernity 14 – 21 3 BAD RADKERSBURG Walking and cycling 22 – 29 4 BLUDENZ A wealth of possibilities 30 – 37 5 BRAUNAU am INN Charm and comfort on the Inn river 38 – 45 6 BRUCK a. d. MUR Nature and culture combined 46 – 53 7 FREISTADT A Varied History 54 – 61 8 GMUNDEN A stylish town of leisure 62 – 69 9 HALLEIN A multifacted insider tip 70 – 77 10 HARTBERG The garden town 78 – 85 11 JUDENBURG Flying high 86 – 93 12 KUFSTEIN Cobblestones meet modern urban flair 94 – 101 13 LEOBEN Attractive town with great views 102 – 109 14 RADSTADT A break with a view 110 – 117 15 SCHÄRDING Baroque treasure trove 118 – 125 16 STEYR When culture’s your fancy 126 – 133 17 WOLFSBERG Castles, mountains and wolves 134 – 141 AUSTRIA CLASSIC TOUR 142 – 143 3 Markus Deisenberger, freelance journalist; lives and works in Salzburg and Vienna Dear travellers, connoisseurs and friends of the SMALL HISTORIC TOWNS of Austria, A5 It typically takes about two days for visitors and tourists to Freistadt Wien get to know a town. -

The Reception of Katherine Mansfield in Germany
Open Research Online The Open University’s repository of research publications and other research outputs The Reception of Katherine Mansfield in Germany Thesis How to cite: Sobotta, Monika (2020). The Reception of Katherine Mansfield in Germany. PhD thesis The Open University. For guidance on citations see FAQs. c 2019 The Author https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ Version: Redacted Version of Record Link(s) to article on publisher’s website: http://dx.doi.org/doi:10.21954/ou.ro.00010f4f Copyright and Moral Rights for the articles on this site are retained by the individual authors and/or other copyright owners. For more information on Open Research Online’s data policy on reuse of materials please consult the policies page. oro.open.ac.uk The Reception of Katherine Mansfield in Germany Monika Sobotta MA The Open University 2012 Thesis submitted for the qualification of PhD in English Literature, June 2019 The Open University Candidate Declaration I confirm that no part of this thesis has previously been submitted for a degree or other qualification at any university or institution. None of the material has been published. All translations are mine except where otherwise stated. I submit this copy of my thesis for examination. Monika Sobotta June 2019 i Abstract This thesis is the first full-length study to explore the reception of Katherine Mansfield’s works in Germany and provides substantial previously un-researched materials. It investigates the reception processes manifested in the selection and translation of Mansfield’s writings into German, the attention given to them by publishers, reviewers, and academics, the reactions of her German readership, the inclusion of her works in literary histories and curricula of grammar schools and universities in Germany. -

Mitteilungen Der Alfred Klahr Gesellschaft, Helmut Rizy: Das
Beiträge 27 Die Last des jüngst Vergangenen (I) Das Ende des Zweiten Weltkriegs in der österreichischen Literatur Helmut Rizy as ist der schönste Sommer mei - scheiden: Gutes Geschäft – oder gutes Verdienste um die Republik Österreich nes Lebens, und wenn ich hun - Gewissen? Ich bin für das zweite – auf je - ausgezeichnet. Dass man sie 1984 bis Ddert Jahre alt werde – das wird de Gefahr hin, selbst auf die einer Emi - 1985 in die Jury beim Ingeborg-Bach - der schönste Frühling und Sommer blei - gration, falls der braune Zauber auch bei mann-Preis berief, ist als Beleidigung der ben“, schrieb im Juni 1945 die damals uns einmal Fuß fassen sollte!“ 2 namensgebenden Autorin zu werten. 18-jährige Ingeborg Bachmann in ihr Einer der Genannten wollte hingegen Tagebuch, das sie während des Kriegs Propagandisten das Ende des Dritten Reichs gar nicht er - begonnen hatte. „Vom Frieden merkt des „Anschlusses“ leben. Josef Weinheber, NSDAP- man nicht viel, sagen alle, aber für mich Die große Mehrzahl der AutorInnen, Mitglied seit 1931, verübte am 8. April ist Frieden, Frieden! Die Leute sind alle die 1933 aus Protest den österreichischen 1945, als die Befreiung Wiens durch die so entsetzlich dumm, haben sie denn PEN verlassen hatten, waren zu jener Rote Armee schon begonnen hatte, erwartet, dass nach einer solchen Kata - Zeit jedoch bereits Mitglieder (etwa die Selbstmord mittels einer Überdosis Mor - strophe das Schlaraffenland von einem Hälfte) oder Sympathisanten der phium. Einen Monat später schrieb Tag zum andern ausbricht! […] Ich wer - NSDAP gewesen. Sie gründeten 1936 Theodor Kramer im englischen Exil sein de studieren, arbeiten, schreiben! Ich den Bund deutscher Schriftsteller Öster - an den toten Weinheber gerichtetes lebe ja, ich lebe. -
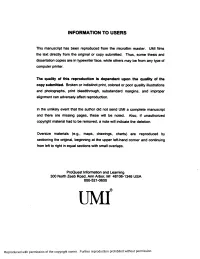
Information to Users
INFORMATION TO USERS This manuscript has been reproduced from the microfilm master. UMI films the text directly from the original or copy submitted. Thus, some thesis and dissertation copies are in typewriter face, while others may be from any type of computer printer. The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. Broken or indistinct print, colored or poor quality illustrations and photographs, print bleedthrough, substandard margins, and improper alignment can adversely affect reproduction. In the unlikely event that the author did not send UMI a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if unauthorized copyright material had to be removed, a note will indicate the deletion. Oversize materials (e.g., maps, drawings, charts) are reproduced by sectioning the original, beginning at the upper left-hand comer and continuing from left to right in equal sections with small overlaps. ProQuest Information and Learning 300 North Zeeb Road, Ann Arbor, Ml 48106-1346 USA 800-521-0600 Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission. Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission. WHO CARES WHODUNIT? ANTI-DETECTION IN WEST GERMAN CINEMA DISSERTATION Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy in the Graduate School of The Ohio State University By Yogini Joglekar, M.A. ***** The Ohio State University 2002 Dissertation Committee: Approved by Professor John Davidson, Adviser Professor Anna Grotans Adviser Professor Linda Mizejewski ic Languages and Literatures Graduate Program Reproduced with permission of the copyright owner. -

2. Der Österreichische Literaturbetrieb Nach 1945
Open-Access-Publikation im Sinne der CC-Lizenz BY 4.0 Open-Access-Publikation im Sinne der CC-Lizenz BY 4.0 Literaturgeschichte in Studien und Quellen Band 30 Herausgegeben von Werner Michler Norbert Christian Wolf Open-Access-Publikation im Sinne der CC-Lizenz BY 4.0 Open-Access-Publikation im Sinne der CC-Lizenz BY 4.0 Stefan Maurer Wolfgang Kraus und der österreichische Literaturbetrieb nach 1945 BÖHLAU VERLAG WIEN KÖLN WEIMAR Open-Access-Publikation im Sinne der CC-Lizenz BY 4.0 Open-Access-Publikation im Sinne der CC-Lizenz BY 4.0 Veröffentlicht mit Unterstützung des Austrian Science Fund ( FWF ): PUB 601-G28 Open Access: Wo nicht anders festgehalten, ist diese Publikation lizenziert unter der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung 4.0; siehe http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Die Publikation wurde einem anonymen, internationalen Peer-Review-Verfahren unterzogen. Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://portal.dnb.de abrufbar. © 2020 by Böhlau Verlag GmbH & Co. KG, Zeltgasse 1, A-1080 Wien Umschlagabbildung: Otto Breicha © Imagno. Korrektorat: Vera M. Schirl Umschlaggestaltung: Michael Haderer, Wien Satz und Layout: Bettina Waringer, Wien Druck und Bindung: Hubert & Co., Göttingen Vandenhoeck & Ruprecht Verlage | www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com ISBN (Print) 978-3-205-23311-4 ISBN (OpenAccess) 978-3-205-23312-1 INHALT 1. EINLEITUNG: WOLFGANG KRAUS, EIN „KANTENLOSER HOMME DE LETTRES“? ...................................................... 9 1.1 Forschungsstand, Quellen und theoretische Ansätze ...................................... 9 1.2 Biographische Einführung ......................................................................................22 2. DER ÖSTERREICHISCHE LITERATURBETRIEB NACH 1945 ............................ 43 2.1 Entwicklung(en) des Literaturbetriebs nach 1945 ......................................... -

Central and Eastern Europe
Central and Eastern Europe Federal Republic of Germany National Affairs VJERMANY IN 1993 EXPERIENCED economic decline, political scandal, and labor and ethnic unrest. By December four million Germans were unemployed: the jobless rate was 8.8 percent in western Germany and 17 percent in the east. In January Minister of Economics Jiirgen Mollemann resigned over charges of nepo- tism. The interior minister of Mecklenburg-Vorpommern, Christian Democrat Lo- thar Kupfer, was dismissed in February for failing to marshal police to protect 100 Vietnamese against rioting crowds in Rostock in August 1992 (see AJYB 1994, p. 310). Germany played an increasingly active role in international affairs this year. One of the most important new developments was Germany's expanded military role, which took German soldiers beyond their national borders for the first time since the founding of the Federal Republic. In April the cabinet decided to dispatch units of the German air force to participate in supervising the NATO flight ban over Bosnia-Herzegovina and in the U.S. humanitarian airdrop over Bosnia. The use of German troops — albeit as support personnel rather than as combatants — for purposes other than national defense provoked considerable debate throughout Germany. The Free Democrats (FDP) appealed to the Federal Court to block the mission, but lost. In May, 1,640 German troops were sent to Somalia; although it was a purely humanitarian mission, it was protested by the Social Democrats (SPD). Responding to critics, Foreign Minister Klaus Kinkel said that the fall of the iron curtain had brought to an end the German concept of a military whose only purpose was defense. -

Between Austria and Germany, Heimat and Zuhause: German-Speaking Refugees and the Politics of Memory in Austria
BETWEEN AUSTRIA AND GERMANY, HEIMAT AND ZUHAUSE: GERMAN-SPEAKING REFUGEES AND THE POLITICS OF MEMORY IN AUSTRIA A Dissertation submitted to the Faculty of the Graduate School of Arts and Sciences of Georgetown University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in German By Joshua Alexander Seale, M.A. Washington, D.C. August 14, 2020 Copyright 2020 by Joshua Alexander Seale All Rights Reserved ii BETWEEN AUSTRIA AND GERMANY, HEIMAT AND ZUHAUSE: GERMAN-SPEAKING REFUGEES AND THE POLITICS OF MEMORY IN AUSTRIA Joshua Alexander Seale, M.A. Dissertation Advisor: Friederike Ursula Eigler, Ph.D. ABSTRACT This dissertation explores the memory of postwar German-speaking refugees in Austria through an analysis of diverse media, cultural practices, and their reception. Part I of the dissertation examines postwar memorials and their reception in newspapers, as well as the role of pilgrimage, religious ritual, and public responses of defacement. Part II focuses on post-Waldheim literature and its reception, specifically examining the literary genres of novels and travelogues describing German-speaking refugees’ trips to their former homes. In examining these memorials and literature as well as their reception, I show how static and marginalized the memory of German- speaking refugees has remained throughout the history of the Second Republic, even after the fragmentation of Austrian memory in the wake of the Waldheim affair. While Chapter 1 posits four reasons for this marginalization, the continuance of this marginalization into the present can be summed up by drawing on Oliver Marchart’s concept of historical-political memory and by pointing to the politicization and tabooization of the memory as a far-right discourse. -

Nicht Die Letzten?« Der »Fall Beer« Und Die Vorarlberger Kulturpolitik
Harald Walser »... nicht die Letzten?« Der »Fall Beer« und die Vorarlberger Kulturpolitik Erschienen in: Allmende. Eine alemannische Zeitschrift, Heft 9, 1984, S. 169-174 Es muß schon einiges passieren, bis es in Vorarlberg zu Auseinandersetzungen und Diskussionen über Literatur bzw. Literaten kommt, bis sich die Öffentlichkeit – vom »Mann auf der Straße« über die Medien bis zum Landtag – in hitzigen Wortgefechten über die »heimische Szene« ereifert. Letzthin war es der Fall. Mit Gertrud Fussenegger, Eugen Andergassen und Natalie Beer wurden drei Schrift- steller mit der erstmals verliehenen »Franz Michael Felder-Medaille« ausgezeichnet, deren politische Vergangenheit der radikaldemokratischen Einstellung eines Franz Michael Felder wohl kaum gerecht wird. Dies hätte außer einer kleinen Minderheit jedoch wohl kaum jemanden im Lande gestört, zumal politische Lernprozesse auch Dichtern zuzubilligen sind. Gertrud Fussenegger, einst mit Hitler- Panegyrik beschäftigt und illegal für die NSDAP tätig, hat beispielsweise Ehrungen durch die reaktio- näre Konrad-Adenauer-Stiftung abgelehnt. Doch bei Natalie Beer trifft das genaue Gegenteil zu: »Wir sind nicht die Letzten von gestern, sondern die Ersten von morgen«, so das Motto der rechtsextremistischen Kommentare. Keine Lektüre für Bon- zen und Parasiten. Am 2. Juli 1983 sendete der Österreichische Rundfunk ein Interview mit der Vor- arlberger Schriftstellerin. Das darin ausgesprochene Bekenntnis Beers zum nationalsozialistischen Gedankengut im allgemeinen und zu Adolf Hitler im besonderen, die Abschwächung und teilweise Leugnung der Judenverfolgung bzw. -Vernichtung, die Behauptung, Österreich sei keine wirkliche Demokratie, diese und andere Aussagen der Achtzigjährigen sorgten für einen Skandal. Denn Natalie Beer ist nicht irgendwer, sie ist die höchstausgezeichnete Schriftstellerin des Landes, sie ist die ein- zige Schriftstellerin, die monatlich von der öffentlichen Hand ohne irgendwelche Bedingungen einen stattlichen Betrag erhält, und sie ist Trägerin hoher Auszeichnungen. -
OÖ. Heimatblätter; 2007 Heft
KULTUR OÖ. HEIMATBLÄTTER 2007 HEFT 1/2 Beiträge zur Oö. Landeskunde I 61. Jahrgang I www.land-oberoesterreich.gv.at 2007 HEFT 1/2 I OÖ. HEIMATBLÄTTER OÖ. 61. Jahrgang 2007 Heft 1/2 Herausgegeben von der Landeskulturdirektion OÖ. KÜNSTLERJUBILÄEN. ANALYSE – DOKUMENTATION – REFLEXION Franz Zamazal: Wilhelm Kienzl und Oberösterreich (Teil I) 3 Ingrid Radauer-Helm: Hebert Ploberger (1902–1977) Eine Spurensuche an Österreichs Bühnen 35 Josef Demmelbauer: Geistesverwandt über Zeiten und Räume Gertrud Fussenegger zum Geburtstag 99 ZEITGESCHICHTE Ernst Kollros: Objekt rechtspolitischer Willkür – Der einmalige Fall des Luxushotels Weinzinger 106 THEMEN AUS DER LANDESKUNDE Klaus Petermayr: Kinderspruch und Kinderlied Zur Überlieferung in Oberösterreich und Salzburg 113 Franz Gillesberger: Eine alte Liederhandschrift im Ebenseer Heimatmuseum 124 Josef Moser: Das Gnadenbild in der Pfarrkirche Ohlsdorf – und Varianten eines Grundmotivs 128 Walter Rieder: Produkt mit einst „tragender Rolle“: Zur Erinnerung an den letzten Holzschuhmacher des Salzkammerguts 133 BUCHBESPRECHUNGEN 139 1 Medieninhaber: Land Oberösterreich Mitarbeiter: Herausgeber: Landeskulturdirektion Dr. Franz Zamazal Zuschriften (Manuskripte, Besprechungsexem- Knabenseminarstraße 33, 4040 Linz plare) und Bestellungen sind zu richten an den Schriftleiter der OÖ. Heimatblätter: Mag. Ingrid Radauer-Helm Camillo Gamnitzer, Landeskulturdirektion, Pro- Uhlplatz 5/33, 1080 Wien menade 37, 4021 Linz, Tel. 0 73 2 / 77 20-1 54 77 HR Dr. Josef Demmelbauer Jahresabonnement (2 Doppelnummern) E 12,– Parkgasse 1, 4910 Ried i. I. (inkl. 10 % MwSt.) HR Dr. Ernst Kollros Hersteller: Druckerei Rudolf Trauner GesmbH & Unterer Markt 5, 4292 Kefermarkt Co KG, Köglstraße 14, 4021 Linz Mag. Dr. Klaus Petermayr Grafische Gestaltung: Mag. art. Herwig Berger, Oö. Volksliedwerk Steingasse 23 a, 4020 Linz Landeskulturzentrum Ursulinenhof Landstraße 31, 4020 Linz Für den Inhalt der einzelnen Beiträge zeichnet der jeweilige Verfasser verantwortlich Dr. -

Heimat in the Cold War: West Germany’S Multimedial Easts, 1949-1989
HEIMAT IN THE COLD WAR: WEST GERMANY’S MULTIMEDIAL EASTS, 1949-1989 A Dissertation Presented to the Faculty of the Graduate School of Cornell University In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy by Yuliya H. Komska January 2009 © 2009 Yuliya H. Komska HEIMAT IN THE COLD WAR: WEST GERMANY’S MULTIMEDIAL EASTS, 1945-1989 Yuliya H. Komska, Ph. D. Cornell University 2009 As a result of two world wars, decolonization, and labor migration in the twentieth century the notion of belonging underwent a radical transformation. This dissertation examines how the German concept of Heimat, an arguably untranslatable term that connotes localized belonging, was politically and culturally affected by the Cold War. The dissertation focuses on the role of Sudeten Germans, ethnic Germans expelled from postwar Czechoslovakia, in forging a link between Heimat, border tropes, and the physical landscape of the Iron Curtain between West Germany and Czechoslovakia. It interrogates this linkage, which allowed the expellees to fashion Heimat into an intermedial site of Cold War aesthetics, a linchpin between the postwar era and the Cold War, and an idiom of international law. Chapter One reframes current public and academic discussions of ‘Germans as victims.’ It moves beyond a German-Jewish dyad to consider how Sudeten Germans engaged Palestine’s political, cultural, and religious meanings in order to re- imagine Palestine as a quintessential homeland. Chapter Two reconsiders the role of nostalgia in processes of sensory and, above all, visual contact with Heimat as documented in Sudeten German borderland photography, travel reports, and poetry published during the Cold War.