E I C H S F E
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
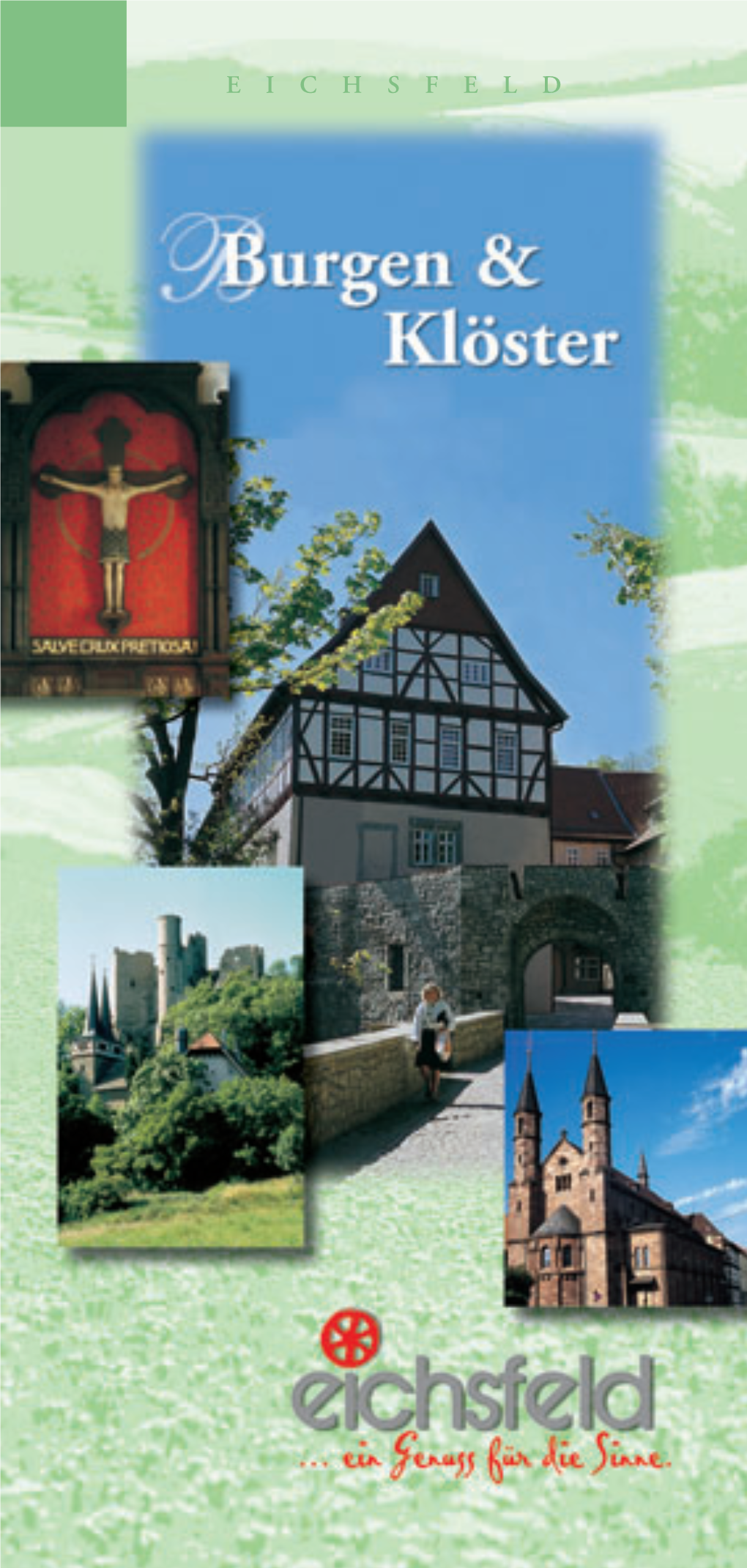
Load more
Recommended publications
-

142-17 Eichsfeldwerke Gmbh Ab
inkl. Anmeldekarte für Sperrmüll und Elektroaltgeräte zum Heraustrennen Abfallfibel 2018 Infobroschüre zur Abfallentsorgung im Landkreis Eichsfeld Digital und mobil informiert: die „EW Abfallinfo“ Mit der „EW Abfallinfo“ können Sie jederzeit die Abfuhrtage für Restabfall, Gelbe Säcke etc. auf Ihrem Smartphone oder Tablet einsehen. Die Tonne pünktlich herausstellen – Inhalt daran erinnert Sie die App künftig auf Wunsch. Neben der Möglichkeit, sich zu den Standorten der Annahmestellen oder des Schadstoffmobils navigieren zu lassen, gibt es auch zahlreiche Umweltgerechte Abfallentsorgung 4 Abfallgebühren weiterführende Infos. Die App der EW Entsorgung ist im App Store beginnt mit Abfallvermeidung. und im Play Store verfügbar. 6 Allgemeine Informationen Helfen Sie mit und tragen Sie aktiv zum Umweltschutz bei. 7 Restabfall Zum Download einfach Hier lässt sich mehr tun, als viele denken: QR-Code scannen: 8 Leichtverpackungen – auf gering verpackte Produkte achten – Produkte aus Recyclingmaterial bevorzugen 9 Altglas – Langlebigkeit berücksichtigen – Mehrwegsysteme und Nachfüllpacks verwenden 10 Altpapier – Stofftaschen oder Körbe zum Warentransport nutzen – auf Möglichkeiten der Wiederverwendung achten (z. B. Möbelbörsen etc.) 11 Sperrmüll und Elektroaltgeräte/Altmetall Einen weiteren wichtigen Beitrag leisten Sie bereits mit der richtigen Abfalltrennung zu Hause. 12 Gefährliche Abfälle 13 Bio-Abfälle 14 Sonstige Abfälle 16 Tourenpläne – Schadstoffmobil 18 Adressen 20 Ansprechpartner 22 Antrag zur An-, Abmeldung und Änderung 23 Impressum Anmeldekarte für Sperrmüll und Elektroaltgeräte/Altmetall (zum Heraustrennen) 03 Abfallgebühren Entsorgungsrhythmus/Abrechnung nach Verbrauch Behältergrößen Es besteht grundsätzlich die Möglichkeit, bei Bedarf die Für die Entsorgung von Restabfällen sind im Landkreis Tonne 14-täglich entleeren zu lassen. Die Abfuhrtermine Eichsfeld ausschließlich folgende Behältnisse finden Sie in den Abfallkalendern 2018 oder unter zugelassen: mehr zu den www.eichsfeldwerke.de/entsorgung. -

Official Journal L 338 Volume 35 of the European Communities 23 November 1992
ISSN 0378 - 6978 Official Journal L 338 Volume 35 of the European Communities 23 November 1992 English edition Legislation Contents I Acts whose publication is obligatory II Acts whose publication is not obligatory Council Council Directive 92 /92/ EEC of 9 November 1992 amending Directive 86/ 465 / EEC concerning the Community list of less-favoured farming areas within the meaning of Directive 75 / 268 / EEC (Federal Republic of Germany) 'New Lander* 1 Council Directive 92 /93 / EEC of 9 November 1992 amending Directive 75 /275 / EEC concerning the Community list of less-favoured farming areas within the meaning of Directive 75 / 268/ EEC (Netherlands) 40 Council Directive 92 / 94/ EEC of 9 November 1992 amending Directive 75 / 273 /EEC concerning the Community list of less-favoured farming areas within the meaning of Directive 75 / 268/ EEC (Italy) 42 2 Acts whose titles are printed in light type are those relating to day-to-day management of agricultural matters, and are generally valid for a limited period . The titles of all other Acts are printed in bold type and preceded by an asterisk. 23 . 11 . 92 Official Journal of the European Communities No L 338 / 1 II (Acts whose publication is not obligatory) COUNCIL COUNCIL DIRECTIVE 92/92/ EEC of 9 November 1992 amending Directive 86 /465 / EEC concerning the Community list of less-favoured farming areas within the meaning of Directive 75 /268 / EEC (Federal Republic of Germany ) 'New Lander' THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES , Commission of the areas considered eligible for inclusion -

Martinfelder Burschenkirmes
LINUS WITTICH Medien KG Südeichsfeld Bote Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Ershausen/Geismar mit öffentlichen Bekanntmachungen der Mitgliedsgemeinden Bernterode, Dieterode, Geismar, Kella, Krombach, Pfaffschwende, Schimberg, Schwobfeld, Sickerode, Volkerode, Wiesenfeld Jahrgang 21 Mittwoch, den 17. Oktober 2018 Nummer 10 Martinfelder Hier steckt unsereBurschenkirmes Heimat drin! vom 20. - 22. Oktober 2018 mehr Informationen zum Program auf Seite 2 Südeichsfeld-Bote - 2 - Nr. 10/2018 VG „Ershausen/Geismar“ informiert Die Martinfelder Burschenkirmes Notruf 112 Kinder- und Jugendtelefon 08 00 / 0 08 00 80 Auch in diesem Jahr wollen wir wieder unsere alljährliche Landratsamt Eichsfeld Burschenkirmes feiern. Leider sind die Renovierungsarbei- Zentrale 0 36 06 / 6 50 -0 ten in unserem Gemeindesaal noch nicht abgeschlossen, e-mail: [email protected] was dazu führt, dass wir die Kirchweih nochmal in einem Zelt Verwaltungsgemeinschaft „Ershausen/Geismar“ in der Wiesenstraße feiern. Dies soll aber die Feierlichkeiten Kreisstraße 4, 37308 Schimberg OT Ershausen nicht weiter stören, denn durch Tische, gepolsterte Stühle Tel.: 036082 / 441-0 und eine große Heizung wird für eine angenehme „saalähn- Fax: 036082 / 441-33 liche“ Atmosphäre gesorgt. e-mail: [email protected] Für das leibliche Wohl und die musikalische Unterhaltung web: www.ershausen-geismar.de ist bestens gesorgt, wie man aus dem folgenden Programm entnehmen kann. Sprechzeiten der Verwaltungsgemeinschaft „Ershausen/Geismar“ Samstag: Montag 09.00 - 12.00 Uhr 19:00 -

Naturparkplan Für Den Naturpark Eichsfeld-Hainich-Werratal
LANGFASSUNG Naturparkplan für den Naturpark Eichsfeld-Hainich-Werratal Impressum Auftraggeber: Freistaat Thüringen - Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz vertreten durch Naturparkverwaltung Eichsfeld-Hainich-Werratal Dorfstraße 40 37318 Fürstenhagen www.naturpark-ehw.de Auftragnehmer: IPU – Ingenieurbüro für Planung und Umwelt Erfurt Breite Gasse 4/5 99084 Erfurt Bearbeitung: Uta Röhl, Dipl.-Ing., MBA Regionalmanagement Melanie Tulke, M.Sc. Standort- und Regionalmanagement Juliane Kerst, M.Sc. Stadt- und Raumplanung Stand: Band 1 - September 2015 Band 2 - April 2015 Band 3 – April 2016 Grußwort der Ministerin Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter für unseren Naturpark, ich freue mich, Ihnen den Plan für den Naturpark Eichsfeld-Hainich-Werratal übergeben zu können. Naturparke stehen für ein harmonisches Miteinander von Mensch und Natur: So steht es im Leitbild, wie es die Dachorganisation der Nationalen Naturlandschaften, EUROPARC Deutschland, für die deutschen Naturparke formuliert hat. Noch deutlicher sagen wir in Thüringen: „Mensch und Natur gehören zusammen“. Wir wollen damit im Naturschutz den Menschen ganz bewusst in den Fokus setzen. Ebenso wollen wir Natur und Landschaft bei allen Maßnahmen der Regionalentwicklung im Auge behalten. Man kann daher Naturparke auch als „Entwicklungskonzept mit Naturschutzkomponente“ bezeichnen. Thüringer Naturparke stehen für eine zukunftsweisende Umweltpolitik und Regionalentwicklung. Deshalb ist es wichtig, dass die Naturparke direkt dem Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz angegliedert sind. Die Geburtsstunde des Naturparks liegt bereits 25 Jahre zurück. Damals hat sich das Land Thüringen verpflichtet, diesen Naturpark einzurichten und zu entwickeln. Wir haben uns der Aufgabe gestellt und können mit dem Ergebnis zufrieden sein. Warum ein Naturparkplan? Naturparkpläne sind Meilensteine der Naturparkentwicklung. Sie messen die zurückgelegte Wegstrecke und weisen unserer Arbeit in den nächsten 10 Jahren die Richtung. -

Veh-Leitfaden-Ortschronisten.Pdf
Mathias Degenhardt, Anne Hey Leitfaden für Eichsfelder Ortschronisten „Die erste und heiligste Pflicht des Geschichtsschreibers ist, so zu schreiben, wie die Sachen an sich sind, nicht wie sie einige sich einbilden oder wünschen.“ Johann Wolf In: Politische Geschichte des Eichsfeldes mit Urkunden erläutert. Erster Band. Göttingen 1792, S. XXVII. Impressum Herausgeber: Verein für Eichsfeldische Heimatkunde e. V. Stadtarchiv Heilbad Heiligenstadt Redaktion und Layout: Josef Keppler Erscheinungsort und -jahr: Heilbad Heiligenstadt 2018 Druck: Landkreis Eichsfeld Friedensplatz 8 Heilbad Heiligenstadt 2 Zum Geleit Bald nach der Neugründung des Vereins für Eichsfeldische Heimatkun- de (VEH) im Jahr 1991 sah es der Vorstand als wichtig an, die von der Abteilung Kultur im vormaligen Rat des Kreises Heiligenstadt organi- sierten Ortschronistenkonferenzen wieder aufzugreifen und interessierte Heimatforscher zu sammeln und zusammenzuführen. Das war auch eine besondere Herzensangelegenheit des damaligen Lei- ters des Heiligenstädter Stadtarchivs, Thomas T. Müller. Die Zusam- menarbeit mit dem Stadtarchiv Heilbad Heiligenstadt hat sich bis in die Gegenwart erhalten. Die vom Landkreis Eichsfeld übertragenen Aufgaben als Kreisheimat- pfleger und die damit verbundene Betreuung und Anleitung der ehren- amtlich tätigen Ortschronisten nehmen der Vorstand sowie engagierte Mitglieder des Vereins für Eichsfeldische Heimatkunde, des mit ca. 500 Mitgliedern größten Geschichtsverein Thüringens, gern wahr. In der jährlich stattfindenden Ortschronistenkonferenz -

Catholic and Protestant Faith Communities in Thuringia After the Second World War, 1945-1948
Catholic and Protestant faith communities in Thuringia after the Second World War, 1945-1948 A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Master of Arts in History in the University of Canterbury By Luke Fenwick University of Canterbury 2007 Table of contents Abstract 1 Acknowledgements 2 List of abbreviations 4 List of figures and maps 5 Introduction 6 Chapter 1: The end of the war, the occupiers and the churches 28 Chapter 2: The churches and the secular authorities, 1945-1948 51 Chapter 3: Church efforts in pastoral and material care, 1945-1948 77 Chapter 4: Church popularity and stagnation, 1945-1948 100 Chapter 5: The social influence of the churches: native Thuringians and refugees 127 Chapter 6: The churches, the Nazi past and denazification 144 Chapter 7: Church conceptions of guilt and community attitudes to the Nazi past 166 Conclusion: The position and influence of the churches 183 Maps 191 Bibliography 197 II Abstract In 1945, many parts of Germany lay in rubble and there was a Zeitgeist of exhaustion, apathy, frustration and, in places, shame. German society was disorientated and the Catholic and Protestant churches were the only surviving mass institutions that remained relatively independent from the former Nazi State. Allowed a general religious freedom by the occupying forces, the churches provided the German population with important spiritual and material support that established their vital post-war role in society. The churches enjoyed widespread popular support and, in October 1946, over 90 percent of the population in the Soviet zone (SBZ) claimed membership in either confession. -

10.02.2016 Drucksache 6/1747 6. Wahlperiode Aufhebung Von
THÜRINGER LANDTAG Drucksache 6/1747 6. Wahlperiode 10.02.2016 Kleine Anfrage der Abgeordneten Dr. Scheringer-Wright (DIE LINKE) und Antwort des Thüringer Ministeriums für Umwelt, Energie und Naturschutz Aufhebung von Wasserschutzgebieten in den Gemeinden Geismar, Hohengandern, Kella und Pfaffschwende Die Kleine Anfrage 747 vom 28. Dezember 2015 hat folgenden Wortlaut: Im Thüringer Staatsanzeiger Nr. 50/2015 wurde veröffentlicht, dass Wasserschutzgebiete in der Gemar- kung Großtöpfer der Gemeinde Geismar, in der Gemarkung Hohengandern der Gemeinde Hohengandern, in der Gemarkung Kella der Gemeinde Kella und in der Gemarkung Pfaffschwende der Gemeinde Pfaff- schwende im Landkreis Eichsfeld aufgehoben wurden. Ich frage die Landesregierung: 1. Aus welchen Gründen wurden diese Wasserschutzgebiete aufgehoben (Beantwortung bitte bezogen auf die einzelnen Gemarkungen und Gemeinden)? 2. Aus welchen Wasserschutzgebieten beziehungsweise Quellen wird gegenwärtig Trinkwasser in den Gemeinden beziehungsweise für die Gemeinden gewonnen? 3. Wie ist die Qualität des Trinkwassers in den eingangs genannten Gemeinden, gemessen an den in der Trinkwasserverordnung festgelegten Indikatorparametern (bitte Werte für die einzelnen Trinkwasserdar- gebote auflisten)? Das Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz hat die Kleine Anfrage namens der Lan desre gierung mit Schreiben vom 8. Februar 2016 wie folgt beantwortet: Zu 1.: Durch die Thüringer Verordnung zur Aufhebung von Wasserschutzgebieten in den Gemeinden Geismar, Hohengandern, Kella und Pfaffschwende -

Amtsblatt Für Den
Amtsblatt für den Landkreis Eichsfeld Jahrgang 2009 Heilbad Heiligenstadt, den 12.05.2009 Nr. 17 Inhalt Seite A Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge und Listenverbindungen für die … 138 Wahl der Kreistagsmitglieder am 7. Juni 2009 Bekanntmachung der Genehmigung zur Zweckvereinbarung zwischen den Gemeinden … 148 Büttstedt, Effelder, Großbartloff, Küllstedt und Wachstedt und der Verwaltungsgemein- schaft „Westerwald-Obereichsfeld“ zur Übertragung von Aufgaben nach dem Thüringer Schiedsstellengesetz Zweckvereinbarung zur Übertragung von Aufgaben nach dem Thüringer Schiedsstellen- ... 148 gesetz Öffentliche Ausschreibungen gemäß VOB/A Sanierung Sporthalle Grundschule Siemerode ... 151 Sanierung Sporthalle Grundschule Bodenrode ... 154 Sanierung Sporthalle Grundschule Geismar ... 157 Sanierung Sporthalle Grundschule Pfaffschwende ... 160 Einbau einer Brandmeldeanlage im Verwaltungsgebäude Haus 6 in Heiligenstadt ... 163 B Veröffentlichungen sonstiger Stellen - keine - HHHerausgeber: Landkreis Eichsfeld Bezugsmöglichkeiten : Das Amtsblatt kann beim Landkreis Eichsfeld/Hauptamt/Kreistagsbüro und Pressestelle, Friedensplatz 8, 37308 Heilbad Heiligenstadt, als Abonnement, Einzelausgabe oder blattweise bezogen werden. Tel. : (03606) 650 -1240 / 1241 / 1242; Preis je Doppelseite 0,10 € zuzüglich Versandkosten. Erscheinungsweise : in der Regel dienstags, auch unter der Internetadresse www.kreis-eic.de (Aktuelles, Amtsblatt) - 137 - Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld -

Südeichsfeld-Bote 11/2020
LINUS WITTICH Medien KG Südeichsfeld Bote Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Ershausen/Geismar mit öffentlichen Bekanntmachungen der Mitgliedsgemeinden Dieterode, Geismar, Kella, Krombach, Pfaffschwende, Schimberg, Schwobfeld, Sickerode, Volkerode, Wiesenfeld Jahrgang 23 Mittwoch, den 18. November 2020 Nummer 11 Dämmershopping - EntspanntHier einkaufensteckt unsere im HeimatSt. Johannesstift drin! Leider kann in diesem Jahr aus gegebenem Anlass kein Lich- termarkt stattfinden. Um un- seren Kundinnen und Kunden trotzdem die Möglichkeit zu geben, Produkte aus unserer Herstellung zu erwerben, bie- ten wir Ihnen Aktionstage an. Wir öffnen an drei Tagen mit verlängerten Öffnungszeiten. Der Keramikladen, die Fleisch- manufaktur und die Gärtnerei haben für Sie geöffnet vom Mittwoch, den 25.11. bis Frei- tag, den 27.11. jeweils von 10:00 bis 19:00 Uhr. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir Sie als Gast bei uns Dämmershopping Mi, 25.11. 10:00 –19:00 Uhr begrüßen dürfen. Bitte beach- Entspannt einkaufen Do, 26.11. 10:00 –19:00 Uhr ten Sie die aktuellen Hygiene- zu verlängerten Öffnungszeiten Fr, 27.11. 10:00 –19:00 Uhr regeln. Mit Abstand sind Sie die beste Kundschaft. Keramikladen Fleischmanufaktur Gärtnerei geöffnet geöffnet geöffnet Die Beschäftigten und Mitarbeiter des St. Johannesstiftes Es gelten die aktuellen Hygienevorschriften. Südeichsfeld-Bote - 2 - Nr. 11/2020 VG „Ershausen/Geismar“ informiert Notruf 112 Kinder- und Jugendtelefon 08 00 / 0 08 00 80 Landratsamt Eichsfeld Zentrale 0 36 06 / 6 50 -0 e-mail: [email protected] Verwaltungsgemeinschaft „Ershausen/Geismar“ Kreisstraße 4, 37308 Schimberg OT Ershausen Tel.: 036082 / 441-0 Gemeinde Dieterode Fax: 036082 / 441-33 e-mail: [email protected] web: www.ershausen-geismar.de Bekanntmachungs- und Auslegungsvermerk Sprechzeiten der Verwaltungsgemeinschaft 1. -

Official Journal C 251 Volume 35 of the European Communities 28 September 1992
ISSN 0378 - 6986 Official Journal C 251 Volume 35 of the European Communities 28 September 1992 Information and Notices English edition Notice No Contents Page I Information II Preparatory Acts Commission 92 / C 251 / 01 Proposal for a Council Directive amending Directive 86 /465 / EEC concerning the Community list of less-favoured farming areas within the meaning of Directive 75 / 268 / EEC ( Federal Republic of Germany ) 1 92 / C 251 / 02 Amended proposal for a Council Directive relating to the medical devices 40 92 / C 251 / 03 Proposal for a Council Regulation amending Regulation ( EEC ) No 1408 / 71 on the application of social security schemes to employed persons, to self-employed persons and to members of their families moving within the Community and Regulation ( EEC ) No 574 / 72 laying down the procedure for implementing Regulation ( EEC ) No 1408 / 71 51 92 / C 251 / 04 Proposal for a Council Regulation on special measures for farmers affected by the 1991 / 1992 drought in Portugal 57 2 28 . 9 . 92 Official Journal of the European Communities No C 251 / 1 II f Preparatory Acts) COMMISSION Proposal for a Council Directive amending Directive 86 / 465 / EEC concerning the Community list of less-favoured farming areas within the meaning of Directive 75 / 268 / EEC ( Federal Republic of Germany ) New Lander ( 92 / C 251 / 01 ) COM (92) 351 final (Submitted by the Commission on 28 July 1992) THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES , that the Community list of areas annexed to Directive 86 / 465 / EEC be amended as indicated in the -
Wanderweg 280 Km
Weitere Anregungen und Informationen erhalten Anfahrtskarte Sie hier: Tourist-Information Heiligenstadt Bürgerbüro Worbis Hamburg Marktplatz 15 Rossmarkt 2 A7 37308 Heilbad Heiligenstadt 37339 Leinefelde-Worbis Tel.: 0 36 06 / 677-141/142 Tel: 03 60 74 / 200-300 Fax: 0 36 06 / 677-140 Fax: 03 60 74 / 200-399 Dortmund Hannover Email: [email protected] E-Mail: [email protected] A2 Braunschweig Berlin HVE Eichsfeld Touristik e.V. Touristinfo Grenzlandmuseum A2 Conrad-Hentrich-Platz 1 Duderstädter Straße 7-9 Hildesheim 37327 Leinefelde-Worbis 37339 Teistungen A39 Magdeburg Tel: 0 36 05 / 2 00 67 60 Tel: 03 60 71 / 9 71 12 Goslar E-Mail: [email protected] E-Mail: [email protected] B243 Harz Quedlinburg Stadt Leinefelde-Worbis Stadt Duderstadt Solling B27 Bahnhofstraße 43 Gästeinformation Herzberg 37327 Leinefelde-Worbis Marktstraße 66 Göttingen Weser- B27 B80 Telefon: 0 36 05 / 20 00 37115 Duderstadt berg- Halle Fax: 0 36 05 / 20 01 99 Tel: 0 55 27 / 84 12 00 land A7 E-Mail: [email protected] E-Mail: [email protected] B80 A38 Galerie Göttinger Land A44 Stadt Dingelstädt Kassel Geschwister-Scholl-Straße 28 Reinhäuser Landstraße 4 Dortmund B27 B247 37351 Dingelstädt 37083 Göttingen Eichsfeld- Weimar Tel: 03 60 75 / 340 Tel.: 05 51 / 5 25 24 70 Eisenach E-Mail: [email protected] E-Mail: [email protected] A4 wanderweg Gotha Dresden Pilgerinformationszentrum Etzelsbach Gemeinde Katlenburg-Lindau Erfurt A5 Thüringer Wald Dorfstraße 26 Bahnhofstraße 6 Frankfurt A7 37308 Steinbach 37191 Katlenburg-Lindau München Tel: 03 60 85 / 4 03 55 Telefon: 0 55 52 / 99 37-0 Stuttgart E-Mail: gemeindeverwaltung@ Fa x:0 5 5 52 / 9 9 37- 5 0 280 km steinbach-etzelsbach.de E-Mail: [email protected] in 13 Etappen Impressum Herausgegeben: HVE Eichsfeld Touristik e.V., Leinefelde Conrad-Hentrich-Platz 1, 37327 Leinefelde-Worbis, www.eichsfeld.de Redaktion: Alexander Baum, Jürgen Tegtmeier, Bernhard Elsler, HVE Eichsfeld Touristik e.V. -

Wassermühlen Im Thüringischen Eichsfeld
Wassermühlen im thüringischen Eichsfeld R h Nebenkarte u m Heiligenstadt-Zentrum e e um Mühlenstandorte Rh H a h le r Weilröder Elle Weilrode Silkerode Dorfmühle ) Herrnmühle e (Fronmühle) s Bockelnhagen F s Lindenallee ronmü a El e hle g ler n- k in c Bockelnhagener Mühle gass G e e ie (Neue Mühle) L e i G Kalkmühle s Untermühle . l e m Ratsmühle d Zwinge e e h e Obermühle ( e e Teichmühle ß e Papiermühle/Fabrik a h r d e H c t l a s a b S i l Gieckmühle e r h o r G l o o e S e Schlagmühle T (Schreimühle)/ gass r Leinemühle/Fabrik g - röde (Stockmühle) e Ge r Eller n Stromerzeugung i d e Ölmühle t Paterhofmühle z Stöckey t t Untere Kaufmannmühle Ratsgasse laus e Schlagg. Klausmühle Redemannmühle l ü ö Obere Kaufmannmühle/Neue Mühle J K s Wilhelmst i L r. G r. Weißenborn- e Wilhelmst e Schneppemühle i Alte Mühle n G e h e t Kleine Mühle g a -Lüderode He N lm a e s Dorfmühle Wolfmühle s Weißenborn (Heidmühle) e Jützenbach Schreckenmühle se Oberste GeröderMühle Mühle Windische Gas r Win Gerode Neue Klostermühle To dische Gasse Kapsmühle DUDERSTADT ler Alte Klostermühle Kasse m Graben) (ehem. A Epschenrode Robert-Koch-Str. e Ecklingerode th H a N a Werningerode ebühl h l e e Dorfmühle Bodemühle Lies tristraß Isekemühle e Pe (Untermühle) Bod (Dorfmühle) 0 50 100 150 200 250 m Kamm-Mühle Maßstab 1 : 5 000 Haasemühle Bischofferode Bruchmühle Brehme Brehme Holungen Butter- Apelsmühle mühle Schmidtmühle (Ölmühle) Glahnmühle Petrimühle (Bonifazmühle) (Dorfmühle) Bo Garte Wehnde Hauröden de Untere Obermühle Teichmühle Klostermühle Teistungenburg