Bewirtschaftungsplan
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Der Ursprung Des Eichelbachs Und Sein Weg in Die Nidda Der
Der Ursprung des Eichelbachs und sein Weg in die Nidda Der Eichelbach ist ein ganz unspektakulärer Bach im Vogelsberg. Doch was wären wir ohne ihn. In der freien Enzyklopädie wird er als gut 18km langer linker bzw. südöstlicher Zufluss der Nidda beschrieben. Der Eichelbach entspringt im Vogelsberg nördlich des Hoherodskopfes und östlich von Schotten Breungeshain, so liest man dort. Er mündet bei Nidda-Eichelsdorf in die Nidda. So kurz, in nur zwei Sätzen, handelt die Enzyklopädie unseren Eichelbach ab. Doch wenn man interessiert ist, kann man daraus mehr ableiten. Bei dem Hinweis auf die Quelle „nördlich und östlich“ erkennt der aufmerksame Leser, dass der Eichelbach sich aus zwei Quellbächen bilden muss. Tatsächlich entspringt der bekanntere der beiden Quellbäche nördlich vom Hoherodskopf in der Breungeshainer Heide unterhalb des Taufsteins. Im Bruchgebiet zwischen dem bekannten Restaurant „Taufsteinhütte“ und der Jugendherberge sind die Ursprünge des Baches zu finden. Nicht eingefasst, noch nicht einmal mit einem kleinen Hinweisschild versehen, gluckert hier das erste Eichelbachwasser aus der Erde. Auch in der Grundschule meines Heimatdorfes Eichelsachsen lernten wir, dass hier die Quelle des Eichelbaches sei. Wir waren oft mit unseren Lehrern und der Schulklasse im Landschulheim auf dem Hoherodskopf, um die die gesunde Luft und den Blick auf die Landschaft zu genießen. Was war einfacher für den Lehrer als zu erklären, dass direkt dort unterhalb der Jugendherberge der Eichelbach, der durch unseren Wohnort fließt, entspringt. Ein kleines Rohr direkt am Straßenrand fasst das Quellwasser zusammen. Es lässt schon eine ganze Menge Wasser fließen, genügend um sogleich den Feuerlöschteich für das Haus der Jugend ausreichend zu füllen. -

Viertage-Wanderung 2016 Montag 13
Viertage-Wanderung 2016 Montag 13. – Donnerstag 16.Juni 2016 Das gab es noch nie, dass wir ein zweites Mal und unmittelbar im Jahr darauf im selben Quartier unsere Viertage-Wanderung veranstalteten. Doch das gute Essen und die Betreuung durch die Familie Straub im Landgasthof „Kupferschmiede“ in Schotten-Rainrod sowie die abwechs- lungsreiche Vogelsberger Landschaft mit ihren hervorragend gestalteten Premiumwegen fand unser aller Zustimmung. Für unsere 14 Teilnehmer hat es sich mehr als gelohnt, vom 13-16.Juni wieder dabei gewesen zu sein. Und trotz der ungünstigen Wetterprognose hielten sich die Regenwolken zurück, ließen es woanders regnen und machten uns den Himmel frei für hinreichend Sonnenschein. 1.Tag Ziel ist die oberhessische Kleinstadt Homberg an der Ohm. Weil die Schächerbach-Tour dort für uns zu kurz ist, habe ich für den Vormittag die Geotour Felsenmeer in unser Tagesprogramm eingebaut. Sie soll uns über die Höhe des Hohe Bergs mit weiten Ausblicken rund um führen, von denen der auf Amöneburg der wohl eindrucksvollste sein wird. Weil wir etwas oberhalb des Ein- gangsportals los- wandern, habe ich Orientierungspro- bleme. Als wir dann beim Insek- tenhotel ankom- men, entscheide ich mich, die Tour in der umgekehr- ten Richtung an- zugehen. Beim Insektenhotel Das zahlte sich dann auch aus, obwohl wir eigentlich auf dem richtigen weg waren. Ich bin dann doch erleichtert, als wir das Logo für unsere Tour an einem Pflock entdecken. Nach Überschreiten des lang gezogenen Bergkammes durchwandern wir das in einem Kerbtal liegende Felsenmeer und freuen uns über die Schutzhütte am Naturdenkmal „Dicke Steine“. Denn dort rasten wir erst einmal und lassen nach der etwa 80 km langen Anfahrt nun die Seele so richtig baumeln. -

WANDERWELT Tourenvorschläge
WANDERWELT Tourenvorschläge JETZT: mit NEUEN Premiumwegen! VOGELSBERG Hessen www.vogelsberg-touristik.de 02|03 VULKANREGION VOGELSBERG … auf neuen Wegen INHALTSVERZEICHNIS 04 | 11 Vulkanring Vogelsberg 12 | 17 Wander-Gastgeber und Pauschalen 18 Premiumwege ExtraTouren Vogelsberg 19 Höhenrundweg Hoherodskopf 20 | 21 Bergmähwiesenpfad 22 | 23 Drei-SeenTour Freiensteinau 24 | 25 SchächerbachTour Homberg (Ohm) 26 | 27 StauseeTour Eschenrod 28 | 29 NaturTour Nidda 30 | 31 BachTour Lauterbach 32 | 33 GipfelTour Schotten 34 | 35 FelsenTour Herbstein 36 | 37 WeitblickTour Ulrichstein 38 | 39 HeinzemannTour Gemünden 40 | 41 WiesenTour Lauterbach Geotouren Vogelsberg 42 Geführte Geotouren 43 Geopark Vulkanregion Vogelsberg 44 Amanaburch-Tour 45 Geotour Felsenmeer 46 Zeitpfad Wartenberg 47 Erzweg Süd 48 | 49 Eisenpfad Gedern 50 Spur der Natur mit geol. Baumhecke 51 Erlebnispfad: Geopfad Themenwege Naturerlebnis Marburg Homberg/ Alsfeld Wandern auf dem Vulkan Ohm Fulda 52 | 53 Erlebnispfade ab Hoherodskopf Schlitz 54 | 55 Schäfer- und Magerrasenroute Lauterbach Lahn REGION Der Vogelsberg ist ein Vulkangebirge, genau genommen ein Vulkanfeld mit ungemeiner Mächtigkeit Gießen Grünberg Ulrichstein 56 Auf Schäfers Spuren und 60 km Durchmesser. Immer wieder ergossen sich Lavamassen aus Schloten und Spalten über die Herbstein Fulda 57 Bismarcksteinrunde Schotten Erde. Das war in der Zeit vor 15 bis 18 Millionen Jahren. Laubach 58 | 59 Berchtaweg Hungen Grebenhain Regionale Touren Viele Schichten sind bereits verwittert. Erosion und Wasser formten das Mittelgebirge, auf dem sich Wetter Nidda Freiensteinau Gedern VOGELSBERG 60 Zum Kirchlein Fraurombach die Natur so herrlich breit machen konnte. Der waldreiche Hohe Vogelsberg mit Gipfeln über 700 Friedberg Büdingen Birstein 61 Y-Tour Büdingen Meter ist umgeben von einer parkartigen Landschaft mit Hecken, Lesesteinwällen, Weiden und Seen, Nidda Wächtersbach 62 Antrifttal Rundweg sodass auf den Wanderwegen immer wieder Weitsichten begeistern. -

Friedrichsdorfer Woche Abstrakte Malerei Und Collagen Montags 6 Uhr Sowie Ab Donnerstag, 5
Wollen Sie verkaufen? Wir suchen für unsere Kunden: HÄUSER / VILLEN WOHNUNGEN GRUNDSTÜCKE mit gesicherten Finanzierungen. Friedrichsdorfer Jetzt verkaufen und noch bis zu Friedrichsdorfer 1 Jahr wohnen bleiben! Wöchentlich erscheinende unabhängige Lokalzeitung für die Stadt Friedrichsdorf Anruf genügt! Wir beraten Sie mit den Stadtteilen Friedrichsdorf, Burgholzhausen, Köppern und Seulberg gerne – kostenfrei für Verkäufer sowie die Stadt Bad Homburg mit den Stadtteilen Dornholzhausen, Gonzenheim, Tipp-Prämie bis 1000 € Kirdorf, Ober-Eschbach und Ober-Erlenbach. Auflage: 38.600 Exemplare Woche adler-immobilien.de 06171. 58 400 Herausgegeben vom Hochtaunus Verlag GmbH · Vorstadt 20 · 61440Woche Oberursel · Telefon 06171/6288-0 · Telefax 06171/6288-19 17. Jahrgang Donnerstag, 29. März 2012 Kalenderwoche 13 Österlicher Bummel im Heimatmuseum Seulberg (jas). Gefräst, gekratzt und gebatikt, bemalt, bestickt oder beklebt, in kräftigen Frühlingsfarben oder zarten Pastelltönen: Wer staunen wollte, was aus einfachen weißen Hühner- oder Gänseeiern für Kunstwerke werden können, der war auf dem Ostermarkt im Heimatmuseum Seulberg genau richtig. www.stadtwerke-bad-homburg.de Bereits zum 25. Mal hatten Organisatorin Ute Desch und ihr engagiertes Museumsteam zum österlichen Bummel eingeladen. Und schon kurz nach Öffnung des Marktes strömten die Besucher bei herrlichem Frühlingswetter ins Sauna & Museum, um an den Ständen der 38 Aussteller Infrarotkabinen zu schauen, zu staunen und natürlich auch al- lerlei Österliches zu kaufen. Und die Vielfalt war -

(Main) – Friedberg – Beienheim – Nidda Baubedingte Fahr
Baubedingte Fahrplanänderungen Regionalverkehr Herausgeber Kommunikation Infrastruktur der Deutschen Bahn AG Stand 01.09.2021 KBS 632 Frankfurt (Main) – Friedberg – Beienheim – Nidda gültig bis Freitag, 10. Dezember, jeweils montags bis freitags, 5.45 – 18.00 Uhr Zugausfall Frankfurt (Main) Hbf UV Friedberg (Hess) RB 15352 und 15354 (planmäßig 16.44 Uhr und 17.16 Uhr ab Frankfurt (Main) Hbf) fallen von Frankfurt (Main) Hbf bis Friedberg (Hess) aus. RB 15353 und 15355 (planmäßige Ankunft 6.32 Uhr und 7.54 Uhr in Frankfurt (Main) Hbf) fallen von Friedberg (Hess) bis Frankfurt (Main) Hbf aus. Nutzen Sie in diesem Abschnitt alternativ die Züge der Linien RE 30, RB 40/41 und RE 98/99. Grund Bahnsteigarbeiten in Friedberg (Hess) Kontaktdaten https://bauinfos.deutschebahn.com/kontaktdaten/SBahnRheinMain Diese Fahrplandaten werden ständig aktualisiert. Bitte informieren Sie sich kurz vor Ihrer Fahrt über zusätzliche Änderungen. Bestellen Sie sich unseren kostenlosen Newsletter und erhalten Sie alle baubedingten Fahrplanänderungen per E-Mail Xhttps://bauinfos.deutschebahn.com/newsletter Fakten und Hintergründe zu Bauprojekten in Ihrer Region finden Sie auf https://bauprojekte.deutschebahn.com Seite 1 Bauarbeiten in Friedberg (Hess) RB 48 Nidda ► Beienheim ► Friedberg (Hess) (► Frankfurt (Main) Hbf) Teilausfälle zwischen Friedberg (Hess) und Frankfurt (Main) Hbf Verlängert bis 10. Dezember 2021 (jeweils Montag-Freitag) Seit dem 10. Mai kommt es aufgrund von Bahnsteigarbeiten in Friedberg (Hess) zu Abweichungen im Zugverkehr zwischen Nidda, Friedberg und Frankfurt (RB 48). Bitte beachten Sie, dass sich die Bauarbeiten mit den entsprechenden Auswirkungen bis zum 10. Dezember 2021 verlängern werden. Die Züge der Linie RB 48 fallen auf dem Abschnitt Friedberg (Hess) – Frankfurt (Main) Hbf aus. -

202.1017 Fld Riwa River Without
VISION FOR THE FUTURE THE QUALITY OF DRINKING WATER IN EUROPE MORE INFORMATION: How far are we? REQUIRES PREVENTIVE PROTECTION OF THE WATER Cooperation is the key word in the activities RESOURCES: of the Association of River Waterworks The Rhine (RIWA) and the International Association The most important of Waterworks in the Rhine Catchment aim of water pollution (IAWR). control is to enable the Cooperation is necessary to achieve waterworks in the structural, lasting solutions. Rhine river basin to Cooperation forges links between produce quality people and cultures. drinking water at any river time. Strong together without And that is one of the primary merits of this association of waterworks. Respect for the insights and efforts of the RIWA Associations of River other parties in this association is growing Waterworks borders because of the cooperation. This is a good basis for successful The high standards for IAWR International Association activities in coming years. the drinking water of Waterworks in the Rhine quality in Europe catchment area Some common activities of the associations ask for preventive of waterworks: protection of the water • a homgeneous international monitoring resources. Phone: +31 (0) 30 600 90 30 network in the Rhine basin, from the Alps Fax: +31 (0) 30 600 90 39 to the North Sea, • scientific studies on substance and parasites Priority must be given E-mail: [email protected] which are relevant for to protecting water [email protected] drinking water production, resources against publication of monitoring pollutants that can The prevention of Internet: www.riwa.org • results and scientific studie get into the drinking water pollution www.iawr.org in annual reports and other water supply. -

The Self-Perception of Chronic Physical Incapacity Among the Labouring Poor
THE SELF-PERCEPTION OF CHRONIC PHYSICAL INCAPACITY AMONG THE LABOURING POOR. PAUPER NARRATIVES AND TERRITORIAL HOSPITALS IN EARLY MODERN RURAL GERMANY. BY LOUISE MARSHA GRAY A thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy at the University of London. University College, London 2001 * 1W ) 2 ABSTRACT This thesis examines the experiences of the labouring poor who were suffering from chronic physical illnesses in the early modern period. Despite the popularity of institutional history among medical historians, the experiences of the sick poor themselves have hitherto been sorely neglected. Research into the motivation of the sick poor to petition for a place in a hospital to date has stemmed from a reliance upon administrative or statistical sources, such as patient lists. An over-reliance upon such documentation omits an awareness of the 'voice of the poor', and of their experiences of the realities of living with a chronic ailment. Research focusing upon the early modern period has been largely silent with regards to the specific ways in which a prospective patient viewed a hospital, and to the point in a sick person's life in which they would apply for admission into such an institution. This thesis hopes to rectif,r such a bias. Research for this thesis has centred on surviving pauper petitions, written by and on behalf of the rural labouring poor who sought admission into two territorial hospitals in Hesse, Germany. This study will examine the establishment of these hospitals at the onset of the Reformation, and will chart their history throughout the early modern period. Bureaucratic and administrative documentation will be contrasted to the pauper petitions to gain a wider and more nuanced view of the place of these hospitals within society. -

ZUR GESCHICHTE UND RENATURIERUNG DER NIDDA Von Gottfried Lehr
ZUR GESCHICHTE UND RENATURIERUNG DER NIDDA Von Gottfried Lehr Einleitung Die Nidda ist der größte Fluss der Wetterau. Sie ist ca. 90 km lang. Der Fluss entspringt im Vogelsberg, nahe dem Hoherodskopf, durchfließt die Wetterau, um bei Frankfurt Höchst in den Main zu münden. Die Nidda ist der letzte große Seitenfluss des Mains vor dessen Mün- dung in den Rhein. Das Schicksal der Nidda ist stellvertretend für viele andere Flüsse Europas. Aufstau, Begra- digung und Gewässerverschmutzung sorgten in der Vergangenheit dafür, dass das „Ökosy- stem Fluss“ nachhaltig beeinträchtigt wurde. Mit Übernahme der Bachpatenschaft durch den ASV Bad Vilbel setzte man sich zum Ziel, zumindest einen Teil dieser negativen Entwicklung wieder rückgängig zu machen. Einiges zur Flusshistorik/ Von der Eiszeit bis zur Begradigung Seit der letzten Eiszeit hat die Nidda gewaltige Veränderungen erfahren. Zur Eiszeit war die Nidda ein Fluss mit enormer Dynamik. Bei jedem Hochwasser verlagerte Sie Ihr Bett und verzweigte sich mehrfach. Sie gehörte zum Typ „ Furkationsfluss“ , ähnlich wie alpine Flüsse (z.B.Isar/ Lech ). Mit der nacheiszeitlichen Klimaerwärmung legte sich die Nidda zusehends auf eine Rinne fest. Nachdem der Mensch vom Nomadentum zum Ackerbau überging und sesshaft wurde, wur- den die Wälder für Ackerbau großflächig gerodet. Hierdurch begann allmählich eine ver- stärkte Bodenerosion, der erodierte Boden setzte sich entlang der Nidda als Auelehm wieder ab. Die Aue begann nunmehr aufzulanden. Während der letzten 2000 Jahre beträgt diese Auflandung mehrere Meter. Überflutungen wurden daher seltener. Bereits zu Zeiten der römischen Besatzung wurden entlang der Nidda „Treidelpfade“ errich- tet. Lasten konnten so entlang des Flusses auf Kähnen gezogen werden. In etwa ab dem Mittelalter wurden die ersten Wehre errichtet. -

Paternal Ancestors of Sarah Mann Dodder 1835-1916
Paternal Ancestors of Sarah Mann Dodder 1835-1916 by Mary Ann Schaefer May 23, 2014 Boulder, Colorado Page 1 of 29 Acknowledgements Thanks to Janice L. McCarty. You're the best research buddy and third cousin ever. None of the discoveries described here could have found the light of day without the help of your curiosity, intelligence, and wit. Thanks to Herr Herbert Meyer, the author of Die Familen – Chronik Södel. His work helped us to find our way home. Notice This article may be copied for private use in related family histories. If you have questions or corrections or you want to request permission to use this article for any other purpose, contact me at [email protected]. Page 2 of 29 Introduction The maternal side of my great-grandmother's Michigan family descends from Jacob Struble Dodder (1830-1903) and his wife Sarah Mann (1835-1916), both of whom were born in Sussex County, New Jersey, and died in Argentine, Genesee, Michigan. A good deal of information was handed down to me about the Dodder family1, but nothing whatsoever was recorded about the Mann family. So began a research journey that has resulted in discovering five previous generations of the Mann family, all of which were previously unknown to us up to this point. This, then, is the story of a German family's journey to pre-Revolution America, how they arrived first in Philadelphia, which was then part of the British colony of Pennsylvania. As the American Revolution unfolded, the family moved up the Delaware River to Sussex County, New Jersey where they provided supplies to the Continental Army of George Washington. -

Lithospheric Mantle Beneath Northern Phyllite Zone – Nidda Case Study (Vogelsberg, Central Germany)
Geophysical Research Abstracts Vol. 21, EGU2019-5164-2, 2019 EGU General Assembly 2019 © Author(s) 2019. CC Attribution 4.0 license. Lithospheric mantle beneath Northern Phyllite Zone – Nidda case study (Vogelsberg, Central Germany) Małgorzata Ziobro (1), Jacek Puziewicz (1), Theodoros Ntaflos (2), Michel Grégoire (3), and Magdalena Matusiak-Małek (1) (1) University of Wroclaw, Institute of Geological Sciences, Wroclaw, Poland ([email protected]), (2) Univeristy of Vienna, Department of Lithospheric Research, Vienna, Austria, (3) Géosciences Environnement Toulouse, Midi-Pyrénées Observatory, Toulouse, France The Cenozoic Vogelsberg volcanic field (Central Germany), part of the CEVP, is situated at the northern end of the Upper Rhine Graben. The NW, central and SE Vogelsberg are underlain by Rheno-Hercynian Variscan basement, the Northern Phyllite Zone and the Mid-German Crystalline High, respectively. Here, we describe peridotite xenoliths from the Nidda basanite in the SW and compare them with those from Dreihausen in the north [3], with the aim to estimate spatial variability of lithospheric mantle beneath different Variscan basement units. The Nidda xenoliths are clinopyroxene (cpx)-poor in part strongly foliated spinel lherzolites and spinel harzburgites with dominantly porphyroclastic texture [2] and chemically homogeneous minerals. Forsterite content in olivine defines two xenoliths groups: A (Fo 90.4-91.7%) and B (Fo ∼89.5%), the latter characterised by more Al-rich orthopyroxene (opx) and cpx. Trace element compositions show no correlation with major element compositions or textures. Two main groups of peridotites can be distinguished in terms of REE: (1) cpx with relatively flat, spoon-shaped patterns with enrichment in La-Ce and opx with relatively steeply decreasing abundances from HREE to LREE, also partly spoon-like; (2) cpx with LREE-enrichment relative to HREE and opx with moderate depletion in LREE relative to HREE. -

Saints in Armor ~ Playbook General Information: All Scenarios Throughout This Playbook Use the Following In- Formation
Tilly’s Battles in the early Thirty Years War PLAYBOOK Musket and Pike Battle Series, Volume VI White Mountain 1620 • Wimpfen 1622 • Höchst 1622, Fleurus 1622 • Stadtlohn 1623 • Lutter am Barenberge 1626 Table of Contents Introduction ..................................................................... 2 Lutter am Barenberge...................................................... 35 White Mountain .............................................................. 6 Historical Notes .............................................................. 41 Wimpfen .......................................................................... 14 Dramatis Personae .......................................................... 44 Höchst ............................................................................. 19 Scenario Selection Guide ................................................ 48 Fleurus............................................................................. 25 Designers’ Notes ............................................................. 50 Stadtlohn ......................................................................... 29 Bibliography ................................................................... 52 GMT Games, LLC • P.O. Box 1308, Hanford, CA 93232-1308 www.GMTGames.com 2 Saints in Armor ~ Playbook General Information: All scenarios throughout this Playbook use the following in- formation. Counters Color Codes: All leaders bear the same color as the nationality of the army or contingent they were in, not necessarily the color of their -
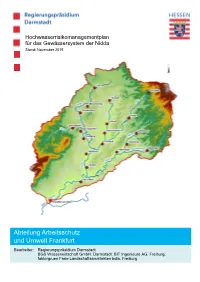
HWRM-Nidda-Langfassung.Pdf
Hochwasserrisikomanagementplan für das Gewässersystem der Nidda Stand: November 2015 Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Frankfurt Bearbeiter: Regierungspräsidium Darmstadt BGS Wasserwirtschaft GmbH, Darmstadt; BIT Ingenieure AG, Freiburg, faktorgruen Freie Landschaftsarchitekten bdla, Freiburg Bearbeiter: Brandt Gerdes Sitzmann Wasserwirtschaft GmbH Pfungstädter Straße 20 64297 Darmstadt Internet: www.bgswasser.de Tel.: +49 (0)6151 9453-0 Fax: +49 (0)6151 9453-80 BIT Ingenieure AG Talstraße1 79102 Freiburg Internet: http://www.bit-ingenieure.de Tel.: +49 (0)761 29657-0 Fax: +49 (0)761 29657-11 faktorgruen Freie Landschaftsarchitekten BDLA Merzhauser Straße 110 79100 Freiburg Internet: www.faktorgruen.de Tel.: +49 (0)761 707647-0 Fax: +49 (0)761 707647-50 Regierungspräsidium Darmstadt Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Frankfurt Dezernat IV/F 41.2 - Oberflächengewässer Gutleutstraße 114 60327 Frankfurt am Main Internet: www.rp-darmstadt.hessen.de Tel.: +49 (0)69 2714-0 Fax: +49 (0)69 2714-5950 Hochwasserrisikomanagementplan Nidda Der Hochwasserrisikomanagementplan für das Gewässersystem der Nidda, nachfolgend vereinfachend als Hochwasserrisikomanagementplan Nidda bezeichnet, umfasst das gesamte Einzugsgebiet der Nidda mit der Nidda als Hauptge- wässer inklusive der Nebengewässer Nidder, Seemenbach, Wetter, Usa und Horloff. Der Hochwasserrisikomanagementplan Nidda ist wie folgt dokumentiert: Mappe 1: Textunterlagen - Hochwasserrisikomanagementplan - Maßnahmensteckbrief - Umweltbericht Mappe 2: Planunterlagen - Übersicht Projektgebiet -