Naturschutzjahresbericht 2004/2005 Für Den Wetteraukreis
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
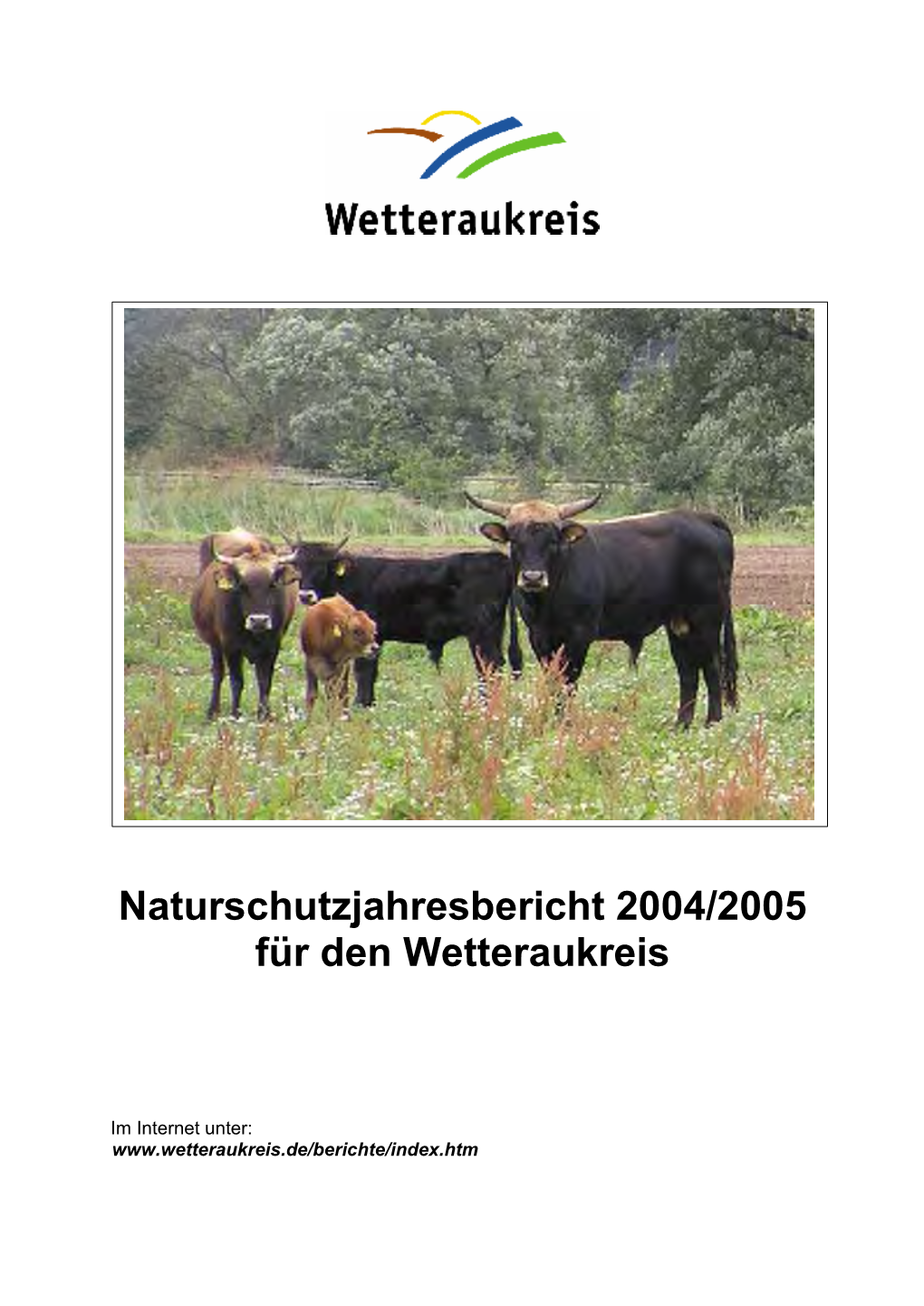
Load more
Recommended publications
-

Der Ursprung Des Eichelbachs Und Sein Weg in Die Nidda Der
Der Ursprung des Eichelbachs und sein Weg in die Nidda Der Eichelbach ist ein ganz unspektakulärer Bach im Vogelsberg. Doch was wären wir ohne ihn. In der freien Enzyklopädie wird er als gut 18km langer linker bzw. südöstlicher Zufluss der Nidda beschrieben. Der Eichelbach entspringt im Vogelsberg nördlich des Hoherodskopfes und östlich von Schotten Breungeshain, so liest man dort. Er mündet bei Nidda-Eichelsdorf in die Nidda. So kurz, in nur zwei Sätzen, handelt die Enzyklopädie unseren Eichelbach ab. Doch wenn man interessiert ist, kann man daraus mehr ableiten. Bei dem Hinweis auf die Quelle „nördlich und östlich“ erkennt der aufmerksame Leser, dass der Eichelbach sich aus zwei Quellbächen bilden muss. Tatsächlich entspringt der bekanntere der beiden Quellbäche nördlich vom Hoherodskopf in der Breungeshainer Heide unterhalb des Taufsteins. Im Bruchgebiet zwischen dem bekannten Restaurant „Taufsteinhütte“ und der Jugendherberge sind die Ursprünge des Baches zu finden. Nicht eingefasst, noch nicht einmal mit einem kleinen Hinweisschild versehen, gluckert hier das erste Eichelbachwasser aus der Erde. Auch in der Grundschule meines Heimatdorfes Eichelsachsen lernten wir, dass hier die Quelle des Eichelbaches sei. Wir waren oft mit unseren Lehrern und der Schulklasse im Landschulheim auf dem Hoherodskopf, um die die gesunde Luft und den Blick auf die Landschaft zu genießen. Was war einfacher für den Lehrer als zu erklären, dass direkt dort unterhalb der Jugendherberge der Eichelbach, der durch unseren Wohnort fließt, entspringt. Ein kleines Rohr direkt am Straßenrand fasst das Quellwasser zusammen. Es lässt schon eine ganze Menge Wasser fließen, genügend um sogleich den Feuerlöschteich für das Haus der Jugend ausreichend zu füllen. -

Bewirtschaftungsplan
1 Regierungspräsidium Darmstadt Obere Naturschutzbehörde Bewirtschaftungsplan für das FFH–Gebiet 5520-302 „Talauen von Nidder und Hillersbach bei Gedern und Burkhards“ und Teilflächen des Vogelschutzgebietes 5421-401 „Vogelsberg“ Gültigkeit: 01.01.2017 Versionsdatum: 08.11.2016 Darmstadt, den 02.12.2016 FFH-Gebiet: 5520-302 „Talauen von Nidder und Hillersbach bei Gedern und Burkhards“ Betreuungsforstamt: Nidda Kreis: Wetterau u. Vogelsberg Gemeinde: Gedern und Schotten Größe: 254 ha Ident. - Nummer: 4277 VS-Gebiet: 5421-401 „Vogelsberg“ Verordnung über die Natura 2000 Gebiete in Hessen vom 16. Januar 2008 GVBl I vom 7. März 2008 NSG „Talauen von Nidder und Hillersbach bei Gedern und Burkhards“ Verordnung über das Naturschutzgebiet vom 15. Januar 1982 StAnz 5/1982 S. 235 geändert durch VO vom 8. Mai 1996 StAnz 31/1996 S. 2368 Bearbeitung: Eckhard Richter, Dipl Forsting. (FH), FA Nidda 2 Inhaltsverzeichnis Seite 1. Einführung 4 2. Gebietsbeschreibung 6 2.1 Kurzcharakteristiken 2.2 Politische und administrative Zuständigkeit 2.3 Erläuterungen aktueller und früherer Nutzungen, Historie 2.4 Eigentumsverhältnisse 3. Leitbilder, Erhaltungsziele und Prognosen 8 3.1 Leitbilder 3.1.1 für das FFH-Gebiet 3.1.2 für das VS-Gebiet 3.2 Erhaltungs- und Schutzziele für LRT und Arten 3.2.1 Erhaltungsziele für LRT nach Anhang I der FFH-RL 3.2.2 Erhaltungsziele der Arten nach Anhang I der FFH-RL 3.2.3 Schutzziele der Arten nach Anhang IV der FFH-RL 3.2.4 Erhaltungsziele für Vogelarten nach Anhang I der VS-RL 3.2.5 Erhaltungsziele für Vogelarten nach Artikel 4 Abs. 2 der VS-RL 3.3 Prognosen erreichbarer Ziele für LRT und Arten 3.3.1 für Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-RL 3.3.2 für Arten nach Anhang I der FFH-RL 3.3.3 für die Vogelarten nach Anhang I der VS-RL 3.3.4 Altholzprognose 4. -

Niddataler Nachrichten 2021-03
NiddatalerNiddatalerNachrichten Ausgabe 3/2021 Dienstag, den 26.01.2021 Jahrgang 3 Amtliches Bekanntmachungsorgan der Stadt Niddatal mit den Stadtteilen Assenheim, Bönstadt, Ilbenstadt und Kaichen AAmtMT FÜRfür Bodenmanagement BODENMANAGEMENT BÜDINGEN Büdingen - Flurbereinigungsbehörde - Flurbereinigungsverfahren- Flurbereinigungsbehörde Wöllstadt B3/ arbeiter Herrn - Brandner (Tel.: 06042/ 9612- Einwendungen gegen die B45 7244, E-Mail: [email protected]. Ergebnisse der Werter- Az.: UF 1944 de). Ein Mund-Nasen-Schutz ist zu den Ter- mittlung können in einem Öffentliche Bekanntmachung minen mitzubringen. vereinbarten Termin vom Vorlage der Wertermittlung Jeder Teilnehmer erhält einen Auszug aus 15.02.2021 bis 17.02.2021 Im Flurbereinigungsverfahren Wöllstadt B3/ dem Nachweis des Alten Bestandes per schriftlich oder zur Nie- B45, Wetteraukreis, werden die Nachweise Post, in dem die Grundstücke mit Bezeich- derschrift erhoben werden.Büdingen, 07.01.2019 über die Ergebnisse der Wertermittlung der nung, Größe und Wert nachgewiesen sind. Schriftliche Einwendungen sind spätestens Grundstücke gemäß § 32Vereinfachte Flurbereinigungs- DieFlurbereinigung Teilnehmer werden gebeten, „Nidderau-Uferrandstreifen“ die Anga- bis zum 04.03.2021 der Flurbereinigungsbe- VF 2531 gesetz (FlurbG) vom 16. März 1976 (BGBl. I ben in den Auszügen zu überprüfen und Un- hörde zuzuleiten. S. 546) in der derzeit geltenden Fassung stimmigkeiten oder Veränderungen (Eigen- Beteiligte, die an den oben genannten Termi- von Montag, 15.02.2021 tumswechsel) der FlurbereinigungsbehördeLadung -

Pastports, Vol. 3, No. 8 (August 2010). News and Tips from the Special Collections Department, St. Louis County Library
NEWS AND TIPS FROM THE ST. LOUIS COUNTY LIBRARY SPECIAL COLLECTIONS DEPARTMENT VOL. 3, No. 8—AUGUST 2010 PastPorts is a monthly publication of the Special Collections Department FOR THE RECORDS located on Tier 5 at the St. Louis County Library Ortssippenbücher and other locale–specific Headquarters, 1640 S. Lindbergh in St. Louis sources are rich in genealogical data County, across the street Numerous rich sources for German genealogy are published in German-speaking from Plaza Frontenac. countries. Chief among them are Ortssippenbücher (OSBs), also known as Ortsfamilienbücher, Familienbücher, Dorfsippenbücher and Sippenbücher. CONTACT US Literally translated, these terms mean “local clan books” (Sippe means “clan”) or To subscribe, unsubscribe, “family books.” OSBs are the published results of indexing and abstracting change email addresses, projects usually done by genealogical and historical societies. make a comment or ask An OSB focuses on a local village or grouping of villages within an ecclesiastical a question, contact the parish or administrative district. Genealogical information is abstracted from local Department as follows: church and civil records and commonly presented as one might find on a family group sheet. Compilers usually assign a unique numerical code to each individual BY MAIL for cross–referencing purposes (OSBs for neighboring communities can also reference each other). Genealogical information usually follows a standard format 1640 S. Lindbergh Blvd. using common symbols and abbreviations, making it possible to decipher entries St. Louis, MO 63131 without an extensive knowledge of German. A list of symbols and abbreviations used in OSBs and other German genealogical sources is on page 10. BY PHONE 314–994–3300, ext. -

Ahsgramerican Historical Society of Germans from Russia Germanic Origins Project Ni-Nzz
AHSGR American Historical Society of Germans From Russia Germanic Origins Project Legend: BV=a German village near the Black Sea . FN= German family name. FSL= First Settlers’ List. GL= a locality in the Germanies. GS= one of the German states. ML= Marriage List. RN= the name of a researcher who has verified one or more German origins. UC= unconfirmed. VV= a German Volga village. A word in bold indicates there is another entry regarding that word or phrase. Click on the bold word or phrase to go to that other entry. Red text calls attention to information for which verification is completed or well underway. Push the back button on your browser to return to the Germanic Origins Project home page. Ni-Nzz last updated Jan 2015 Ni?, Markgrafschaft Muehren: an unidentified place said by the Rosenheim FSL to be homeUC to Marx family. NicholasFN: go to Nicolaus. Nick{Johannes}: KS147 says Ni(c)k(no forename given) left Nidda near Buedingen heading for Jag.Poljanna in 1766. {Johannes} left Seelmann for Pfieffer {sic?} Seelmann in 1788 (Mai1798:Mv2710). Listed in Preuss in 1798 with a wife, children and step-children (Mai1798:Ps52). I could not find him in any published FSL. NickelFN: said by the Bangert FSL to be fromUC Rod an der Weil, Nassau-Usingen. For 1798 see Mai1798:Sr48. Nickel{A.Barbara}FN: said by the 1798 Galka census to be the maiden name of frau Fuchs{J.Kaspar} (Mai1798:Gk11). Nickel{J.Adam}FN: said by the Galka FSL to be fromUC Glauburg, Gelnhausen. For 1798 see Mai1798:Gk21. -

Scho-Sdz Last Updated 5 June 2016
AHSGR American Historical Society of Germans From Russia Germanic Origins Project Legend: BV=a German village near the Black Sea . FN= German family name. FSL= First Settlers’ List. GL= a locality in the Germanies. GS= one of the German states. ML= Marriage List. RN= the name of a researcher who has verified one or more German origins. UC= unconfirmed. VV= a German Volga village. A word in bold indicates there is another entry regarding that word or phrase. Click on the bold word or phrase to go to that other entry. Red text calls attention to information for which verification is completed or well underway. Push the back button on your browser to return to the Germanic Origins Project home page. Scho-Sdz last updated 5 June 2016 SchockFN{Johannes}: listed in the Bergdorf 1858 census (KS:667) without origin, however, their origin in Abstatt, Heilbronn [Amt], Wuerttemberg was proven by the GCRA using FHL(1,187,120). See the GCRA book for more details. SchockFN{Jakob Friedr.}: said by the 1816 Glueckstal census (KS:678, 434) to be fromUC Buttenhausen, Muensingen [Amt], Wuerttemberg. Also spelled Scheck. See the GCRA book for a bit more information. SchockFN{Gottlieb}: lived for a time in Glueckstal, but the CGRA could find no origin; see their book for detail. Schock/Schorch{Christina Magdalena}: using LDS Film #1184767 and other primary souces Corina Hirt and Jerry Amen found that she was born 4 Nov 1719 to Schock{J.Adam} and wife Bigler{A.Barbara}, and in Weiler on 15 July 1738. Schoeckingen, Leonberg [Amt], Wuerttemberg: is 3.5 miles N of Leonberg city. -

Tschüss, Nullzins: Bei Geld Fängt Der Spaß Erst Richtig An! Jetzt Zu Unserem Sparkassen-Anlegerforum Mit Chin Meyer Kostenfrei Anmelden
18. Juni 2019 Sparkassen- Anlegerforum Tschüss, Nullzins: Bei Geld fängt der Spaß erst richtig an! Jetzt zu unserem Sparkassen-Anlegerforum mit Chin Meyer kostenfrei anmelden Ausgabe 1 | 2019 Auflage: 145.000 Stück „Glück auf, Oberhessen“: Finanzieren mit Heimvorteil: Edle Tropfen: Das Braunkohlerevier Die Baufinanzierung der Die Schlitzer Destillerie Wölfersheim Sparkasse Oberhessen Vorwort Liebe Leserinnen und Leser, die Niedrigzinsphase hat uns nun fast ein Jahrzehnt fest im Griff und viele Menschen haben die Lust am Sparen verloren. Doch es geht auch anders: Wir bieten Ihnen attraktive Auswege aus dem Zinstief und zeigen Ihnen, dass Geld anlegen Spaß machen kann. Dazu veranstalten wir für Sie das kostenfreie „Sparkassen-Anlegerforum“ – eine Infotainment-Veranstaltung mit dem bekannten Finanzkabarettisten Chin Meyer und Dr. Holger Bahr von der DekaBank. Melden Sie sich schnell an – die Plätze sind begrenzt! Auf der anderen Seite sind die niedrigen Zinsen natürlich günstig für alle, die einen Kredit aufnehmen. Insbesondere „Häuslebauer“ profitieren davon. Noch mehr Vorteile haben Sie, wenn Sie mit dem „Heimvorteil“ der Sparkasse Oberhessen finanzieren: Faire Beratung mit flexiblen Beratungszeiten, Top-Konditionen und 18 Monate keine Bereitstellungszinsen. Mehr dazu ab Seite 10. Auch für die vorliegende Ausgabe haben wir uns auf die Suche nach spannenden Geschichten aus Oberhessen gemacht. Diesmal nehmen wir Sie mit auf eine Zeitreise zu einem einst bedeutenden Wirtschaftszweig in Wetterau und Vogelsberg: dem Bergbau. Im ersten Teil unserer Serie „Glück auf, Oberhessen“ zeigen wir Ihnen, wie der Abbau von Braunkohle „über und unter Tage“ 200 Jahre lang die Region um Wölfersheim geprägt hat. Auch die Gegenwart hat viel Interessantes zu bieten: Lesen Sie, wie die Schülerfirma „Frunana“ aus Nidda zur Erfolgsstory wurde (Seite 18), was es mit Hessens erstem „Moped-Marathon“ auf sich hat (Seite 19) und wo in unserer schönen Heimat eine der ältesten Brennereien der Welt steht (Seite 12/13). -

Viertage-Wanderung 2016 Montag 13
Viertage-Wanderung 2016 Montag 13. – Donnerstag 16.Juni 2016 Das gab es noch nie, dass wir ein zweites Mal und unmittelbar im Jahr darauf im selben Quartier unsere Viertage-Wanderung veranstalteten. Doch das gute Essen und die Betreuung durch die Familie Straub im Landgasthof „Kupferschmiede“ in Schotten-Rainrod sowie die abwechs- lungsreiche Vogelsberger Landschaft mit ihren hervorragend gestalteten Premiumwegen fand unser aller Zustimmung. Für unsere 14 Teilnehmer hat es sich mehr als gelohnt, vom 13-16.Juni wieder dabei gewesen zu sein. Und trotz der ungünstigen Wetterprognose hielten sich die Regenwolken zurück, ließen es woanders regnen und machten uns den Himmel frei für hinreichend Sonnenschein. 1.Tag Ziel ist die oberhessische Kleinstadt Homberg an der Ohm. Weil die Schächerbach-Tour dort für uns zu kurz ist, habe ich für den Vormittag die Geotour Felsenmeer in unser Tagesprogramm eingebaut. Sie soll uns über die Höhe des Hohe Bergs mit weiten Ausblicken rund um führen, von denen der auf Amöneburg der wohl eindrucksvollste sein wird. Weil wir etwas oberhalb des Ein- gangsportals los- wandern, habe ich Orientierungspro- bleme. Als wir dann beim Insek- tenhotel ankom- men, entscheide ich mich, die Tour in der umgekehr- ten Richtung an- zugehen. Beim Insektenhotel Das zahlte sich dann auch aus, obwohl wir eigentlich auf dem richtigen weg waren. Ich bin dann doch erleichtert, als wir das Logo für unsere Tour an einem Pflock entdecken. Nach Überschreiten des lang gezogenen Bergkammes durchwandern wir das in einem Kerbtal liegende Felsenmeer und freuen uns über die Schutzhütte am Naturdenkmal „Dicke Steine“. Denn dort rasten wir erst einmal und lassen nach der etwa 80 km langen Anfahrt nun die Seele so richtig baumeln. -

WANDERWELT Tourenvorschläge
WANDERWELT Tourenvorschläge JETZT: mit NEUEN Premiumwegen! VOGELSBERG Hessen www.vogelsberg-touristik.de 02|03 VULKANREGION VOGELSBERG … auf neuen Wegen INHALTSVERZEICHNIS 04 | 11 Vulkanring Vogelsberg 12 | 17 Wander-Gastgeber und Pauschalen 18 Premiumwege ExtraTouren Vogelsberg 19 Höhenrundweg Hoherodskopf 20 | 21 Bergmähwiesenpfad 22 | 23 Drei-SeenTour Freiensteinau 24 | 25 SchächerbachTour Homberg (Ohm) 26 | 27 StauseeTour Eschenrod 28 | 29 NaturTour Nidda 30 | 31 BachTour Lauterbach 32 | 33 GipfelTour Schotten 34 | 35 FelsenTour Herbstein 36 | 37 WeitblickTour Ulrichstein 38 | 39 HeinzemannTour Gemünden 40 | 41 WiesenTour Lauterbach Geotouren Vogelsberg 42 Geführte Geotouren 43 Geopark Vulkanregion Vogelsberg 44 Amanaburch-Tour 45 Geotour Felsenmeer 46 Zeitpfad Wartenberg 47 Erzweg Süd 48 | 49 Eisenpfad Gedern 50 Spur der Natur mit geol. Baumhecke 51 Erlebnispfad: Geopfad Themenwege Naturerlebnis Marburg Homberg/ Alsfeld Wandern auf dem Vulkan Ohm Fulda 52 | 53 Erlebnispfade ab Hoherodskopf Schlitz 54 | 55 Schäfer- und Magerrasenroute Lauterbach Lahn REGION Der Vogelsberg ist ein Vulkangebirge, genau genommen ein Vulkanfeld mit ungemeiner Mächtigkeit Gießen Grünberg Ulrichstein 56 Auf Schäfers Spuren und 60 km Durchmesser. Immer wieder ergossen sich Lavamassen aus Schloten und Spalten über die Herbstein Fulda 57 Bismarcksteinrunde Schotten Erde. Das war in der Zeit vor 15 bis 18 Millionen Jahren. Laubach 58 | 59 Berchtaweg Hungen Grebenhain Regionale Touren Viele Schichten sind bereits verwittert. Erosion und Wasser formten das Mittelgebirge, auf dem sich Wetter Nidda Freiensteinau Gedern VOGELSBERG 60 Zum Kirchlein Fraurombach die Natur so herrlich breit machen konnte. Der waldreiche Hohe Vogelsberg mit Gipfeln über 700 Friedberg Büdingen Birstein 61 Y-Tour Büdingen Meter ist umgeben von einer parkartigen Landschaft mit Hecken, Lesesteinwällen, Weiden und Seen, Nidda Wächtersbach 62 Antrifttal Rundweg sodass auf den Wanderwegen immer wieder Weitsichten begeistern. -

Friedrichsdorfer Woche Abstrakte Malerei Und Collagen Montags 6 Uhr Sowie Ab Donnerstag, 5
Wollen Sie verkaufen? Wir suchen für unsere Kunden: HÄUSER / VILLEN WOHNUNGEN GRUNDSTÜCKE mit gesicherten Finanzierungen. Friedrichsdorfer Jetzt verkaufen und noch bis zu Friedrichsdorfer 1 Jahr wohnen bleiben! Wöchentlich erscheinende unabhängige Lokalzeitung für die Stadt Friedrichsdorf Anruf genügt! Wir beraten Sie mit den Stadtteilen Friedrichsdorf, Burgholzhausen, Köppern und Seulberg gerne – kostenfrei für Verkäufer sowie die Stadt Bad Homburg mit den Stadtteilen Dornholzhausen, Gonzenheim, Tipp-Prämie bis 1000 € Kirdorf, Ober-Eschbach und Ober-Erlenbach. Auflage: 38.600 Exemplare Woche adler-immobilien.de 06171. 58 400 Herausgegeben vom Hochtaunus Verlag GmbH · Vorstadt 20 · 61440Woche Oberursel · Telefon 06171/6288-0 · Telefax 06171/6288-19 17. Jahrgang Donnerstag, 29. März 2012 Kalenderwoche 13 Österlicher Bummel im Heimatmuseum Seulberg (jas). Gefräst, gekratzt und gebatikt, bemalt, bestickt oder beklebt, in kräftigen Frühlingsfarben oder zarten Pastelltönen: Wer staunen wollte, was aus einfachen weißen Hühner- oder Gänseeiern für Kunstwerke werden können, der war auf dem Ostermarkt im Heimatmuseum Seulberg genau richtig. www.stadtwerke-bad-homburg.de Bereits zum 25. Mal hatten Organisatorin Ute Desch und ihr engagiertes Museumsteam zum österlichen Bummel eingeladen. Und schon kurz nach Öffnung des Marktes strömten die Besucher bei herrlichem Frühlingswetter ins Sauna & Museum, um an den Ständen der 38 Aussteller Infrarotkabinen zu schauen, zu staunen und natürlich auch al- lerlei Österliches zu kaufen. Und die Vielfalt war -

(Main) – Friedberg – Beienheim – Nidda Baubedingte Fahr
Baubedingte Fahrplanänderungen Regionalverkehr Herausgeber Kommunikation Infrastruktur der Deutschen Bahn AG Stand 01.09.2021 KBS 632 Frankfurt (Main) – Friedberg – Beienheim – Nidda gültig bis Freitag, 10. Dezember, jeweils montags bis freitags, 5.45 – 18.00 Uhr Zugausfall Frankfurt (Main) Hbf UV Friedberg (Hess) RB 15352 und 15354 (planmäßig 16.44 Uhr und 17.16 Uhr ab Frankfurt (Main) Hbf) fallen von Frankfurt (Main) Hbf bis Friedberg (Hess) aus. RB 15353 und 15355 (planmäßige Ankunft 6.32 Uhr und 7.54 Uhr in Frankfurt (Main) Hbf) fallen von Friedberg (Hess) bis Frankfurt (Main) Hbf aus. Nutzen Sie in diesem Abschnitt alternativ die Züge der Linien RE 30, RB 40/41 und RE 98/99. Grund Bahnsteigarbeiten in Friedberg (Hess) Kontaktdaten https://bauinfos.deutschebahn.com/kontaktdaten/SBahnRheinMain Diese Fahrplandaten werden ständig aktualisiert. Bitte informieren Sie sich kurz vor Ihrer Fahrt über zusätzliche Änderungen. Bestellen Sie sich unseren kostenlosen Newsletter und erhalten Sie alle baubedingten Fahrplanänderungen per E-Mail Xhttps://bauinfos.deutschebahn.com/newsletter Fakten und Hintergründe zu Bauprojekten in Ihrer Region finden Sie auf https://bauprojekte.deutschebahn.com Seite 1 Bauarbeiten in Friedberg (Hess) RB 48 Nidda ► Beienheim ► Friedberg (Hess) (► Frankfurt (Main) Hbf) Teilausfälle zwischen Friedberg (Hess) und Frankfurt (Main) Hbf Verlängert bis 10. Dezember 2021 (jeweils Montag-Freitag) Seit dem 10. Mai kommt es aufgrund von Bahnsteigarbeiten in Friedberg (Hess) zu Abweichungen im Zugverkehr zwischen Nidda, Friedberg und Frankfurt (RB 48). Bitte beachten Sie, dass sich die Bauarbeiten mit den entsprechenden Auswirkungen bis zum 10. Dezember 2021 verlängern werden. Die Züge der Linie RB 48 fallen auf dem Abschnitt Friedberg (Hess) – Frankfurt (Main) Hbf aus. -

RP325 Cohn Marion R.Pdf
The Central Archives for the History of the Jewish People Jerusalem (CAHJP) PRIVATE COLLECTION MARION R. COHN – P 325 Xeroxed registers of birth, marriage and death Marion Rene Cohn was born in 1925 in Frankfurt am Main, Germany and raised in Germany and Romania until she immigrated to Israel (then Palestine) in 1940 and since then resided in Tel Aviv. She was among the very few women who have served with Royal British Air Forces and then the Israeli newly established Air Forces. For many years she was the editor of the Hasade magazine until she retired at the age of 60. Since then and for more than 30 years she has dedicated her life to the research of German Jews covering a period of three centuries, hundreds of locations, thousands of family trees and tens of thousands of individuals. Such endeavor wouldn’t have been able without the generous assistance of the many Registors (Standesbeamte), Mayors (Bürgermeister) and various kind people from throughout Germany. Per her request the entire collection and research was donated to the Central Archives for the History of the Jewish People in Jerusalem and the Jewish Museum in Frankfurt am Main. She passed away in 2015 and has left behind her one daughter, Maya, 4 grandchildren and a growing number of great grandchildren. 1 P 325 – Cohn This life-time collection is in memory of Marion Cohn's parents Consul Erich Mokrauer and Hetty nee Rosenblatt from Frankfurt am Main and dedicated to her daughter Maya Dick. Cohn's meticulously arranged collection is a valuable addition to our existing collections of genealogical material from Germany and will be much appreciated by genealogical researchers.