L-G-0003820740-0002440280.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
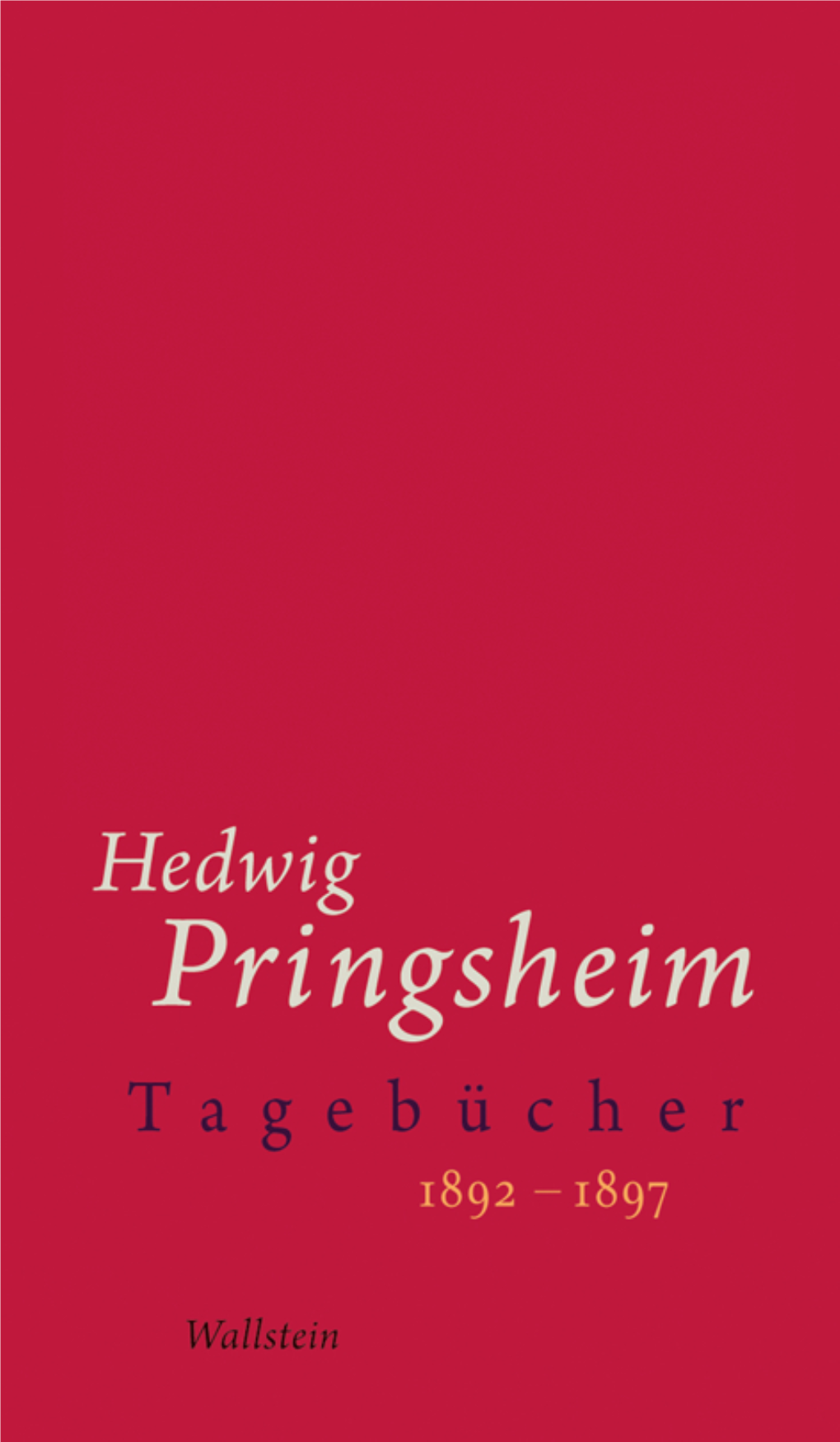
Load more
Recommended publications
-

Erik Pringsheims Tod in Argentinien- Ein Bayrisch-Puntanisch-Schottisches Drama
Juan D. Delius und Julia A. M. Delius Erik Pringsheims Tod in Argentinien- ein bayrisch-puntanisch-schottisches Drama Es ist bekannt, dass Thomas Mann beim Schreiben seiner Biicher gerne auf die Erfahrungen seiner Familienmitglieder zuriickgriff. Seine Schwiegermutter Hedwig Pringsheim (1855-1942) war eine derjenigen, die ihn gelegentlich mit solchem Quellmaterial versorgten. Sie war die Tochter des Kladderadatsch-Re dakteurs Ernst Dohm (1819-1883) und der friihen Frauenrechtlerin Hedwig Dohm (1831-1919) und hatte eine Karriere als Schauspielerin aufgegeben, um 1878 Alfred Pringsheim (1850-1941) zu heiraten. Dieser war ein sehr reicher Mathematikprofessor in Miinchen: Sein Vater Rudolf Pringsheim (1821-1906) hatte als Fuhr- und Bergbauunternehmer ein riesiges Vermogen gemacht. Um 1890 baute sich das junge Ehepaar Pringsheim in Miinchen eine prachtige Villa, Treffpunkt vieler Schriftsteller, Musiker und Maler der damaligen Zeit. Das Paar hatte fiinf Kinder. Die jiingste Tochter Katia (1883-1980) heiratete 1905 Thomas Mann und spielte eine einflussreiche Rolle in seinem Leben. Hier inte ressiert uns aber der erste Sohn der Pringsheims, Erik, 1879 in Miinchen gebo ren.! Er wuchs unauffallig heran und erlangte das Abitur am Wilhelmsgymna sium, Miinchen. 1897 nahm er das Universitatsstudium am Balliol College, , Die hier vorgestellten Nachforschungen wurden durch das Buch von Inge und Waiter Jens: Katias Mutter. Das auflerordentliche Leben der Hedwig Pringsheim (Hamburg: Rowohlt 2005) angeregt. Als Inge und Waiter Jens Auf der Suche nach dem verlorenen Sohn. Die Siidamerika Reise der Hedwig Pringsheim (2. erw. Auf!., Hamburg: Rowohlt 2008) vorbereiteten, hat der argentinische Erstautor des vorliegenden Beitrags einige Einzelheiten zur Geschichte des Erik Pringsheim beigesteuert, siehe S. 164. Der vorliegende Aufsatz baut auf den Schilderungen in diesem Buch auf und prasentiert seitdem hinzugekommene Befunde. -

Über Das Verleugnete Jüdische. Viola Roggenkamp Ermöglicht Einen
Isabel Rohner Komparatistik Online 2006.1 Über das verleugnete Jüdische. Viola Roggenkamp ermöglicht einen neuen Blick auf die Familie Mann-Pringsheim Editorial zu: Viola Roggenkamp Erika Mann - Eine jüdische Tochter. Über Erlesenes und Verleugnetes in der Familie Mann-Pringsheim. Le Décodeur Houellebecq Viola Roggenkamp: Erika Mann - Eine jüdische Tochter. Über Erlesenes und Verleugnetes in der Familie Mann-Pringsheim. Hamburg: Arche Verlag 2005. 272 Seiten, 19,90 EUR. ISBN 3716023442 Sebald Da Vinci Code „Worüber ich schreiben will, hätte Erika Mann nicht gefallen, und ihrer Mutter Katia Mann auch nicht. Ich will über das Jüdische in der Familie des Lee Miller deutschen Dichters Thomas Mann schreiben." So beginnt Viola Roggenkamp ihre Biografie Erika Mann - Eine jüdische Tochter. Im Verlauf des Ausstellung Buches wird tatsächlich immer deutlicher, dass es ihr nicht so sehr um die älteste Tochter des „Zauberers" geht, sondern um die Geschichte eines anderen „Familienmitglieds", eines verleumdeten, ignorierten: dem Jüdischen. Rezension Waldenfels Damit rückt Roggenkamp einen Aspekt in das Zentrum ihres Vorhabens, der in der umfangreiche Forschungsliteratur zur Familie von Thomas und Rezension Foucault Katia Mann sowie zu ihren Kindern kaum je erwähnt wird. Eben das aber macht ihn für neue Fragestellungen so interessant wie ergiebig: „Warum Rezension Roggenkamp aber wurde in der Familie Mann das Jüdische verleugnet - im Gegensatz zur Homosexualität, worüber man am Teetisch offen plauderte?"[1] Rezension Rodenstein Eine deutsch-jüdische Ehe Mit Katia Pringsheim (1883-1980) heiratete Thomas Mann (1875-1955) in eine der einflussreichsten deutsch-jüdischen Familien Münchens. Sie war die Tochter des jüdischen Mathematikprofessors Alfred Pringsheim (1850-1941) und der ehemaligen Meininger Schauspielerin Hedwig Pringsheim (1855-1942). -

L-G-0012633907-0039047985.Pdf
Hedwig Pringsheim Tagebücher Band 8 1929-1934 Hedwig Pringsheim Tagebücher Band 8 1929 – 1934 Herausgegeben und kommentiert von Cristina Herbst Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. © Wallstein Verlag, Göttingen 2019 www.wallstein-verlag.de Vom Verlag gesetzt aus der Stempel Garamond Umschlag: Susanne Gerhards, Düsseldorf, unter Verwendung eines Ausschnitts aus einem Familienporträt, 1930, ETH-Bibliothek Zürich, Thomas-Mann-Archiv. ISBN (Print) 978-3-8353-3499-1 ISBN (E-Book, pdf) 978-3-8353-4373-3 Inhalt Zur Edition . 7 Dank. 9 Einleitung . 13 Zu dieser Ausgabe . 72 Zum Text . 72 Zum Kommentar . 72 Zum Personenregister . 74 Tagebücher 1929 – 1934 1929 . 79 1930 . 149 1931 . 229 1932 . 302 1933 . 386 1934 . 468 Anhang Zusätzliche Dokumente Abbildungen . 548 Zu Hedwig Pringsheim Vater muß sitzen . 557 Ernst Dohms Montag-Abende. 561 Das Modell der Kronprinzessin . 566 Häusliche Erinnerungen . 570 Meine Eltern Ernst und Hedwig Dohm. 574 Wie ich nach Meiningen kam . 582 Auf dem Fahrrad durch die weite Welt . 591 Bayreuth einst und jetzt . 598 Ein Blumenstrauß von Liszt . 603 Ich plaudere aus der Schule . 606 Wir reisen nach Nidden . 611 Aus der Jugendzeit … . 614 Erinnerung an Ludwig Bamberger . 618 Meininger Theaterzettel . 621 6 Inhalt Zu Alfred Pringsheim Alfred Pringsheim wird achtzig Jahre alt . 631 Alfred Pringsheims 80. Geburtstag . 633 90 Semester München . 635 Telephon-Aufführungen . 637 Zu Klaus Pringsheim Eine Woche Sibirienexpreß (von K. Pringsheim). 639 Triumph der deutschen Musik in Japan . 643 Europäische Musik in Japan (von H. Konoye) . -

Aus Wissenschaftsgeschichte Und -Theorie
Aus Wissenschaftsgeschichte und -theorie Hubert Laitko zum 70. Geburtstag überreicht von Freunden, Kollegen und Schülern Herausgegeben von Horst Kant und Annette Vogt Verlag für Wissenschafts- und Regionalgeschichte Dr. Michael Engel Berlin 2005 Die Autoren: Bernhard vom Brocke, Michael Engel, Jaroslav Folta, Wolfgang Girnus, Martin Guntau, Bruno Hartmann, Eckart Henning, Dieter Hoffmann, Ekkehard Höxtermann, Jan Janko, Andreas Kahlow, Horst Kant, Marion Kazemi, Peter Krüger, Wolfgang Küttler, Reinhard Mocek, Alfred Neubauer, Heinrich Parthey, Jochen Richter, Axel Schmetzke, Peter Schneck, Hans-Werner Schütt, Helmut Steiner, Soňja Štrbáňová, Annette Vogt, Regine Zott Bibliographische Information Der Deutschen Bibliothek: Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbiblio- grafie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar. Die Entscheidung darüber, ob die alte oder neue Rechtschreibung Anwendung findet, blieb den Autoren überlassen, die auch für ihre Literaturangaben und Quellenzitate verantwortlich zeichnen. Copyright 2005 Verlag für Wissenschafts- und Regionalgeschichte Dr. Michael Engel Kaiserdamm 102, D-14057 Berlin-Charlottenburg www.verlag-engel.de ISBN 3-929134-49-7 Preis: 49,80 € Gesamtherstellung: Offsetdruckerei Gerhard Weinert Saalburgstr. 3, D-12099 Berlin Gedruckt auf alterungsbeständigem Papier (säurefrei, pH-neutral, chlorarm gebleicht) Prof. Dr. sc. Hubert Laitko Inhaltsverzeichnis Vorwort ................................................................................................................9 -

Krause-Arcisstr Engl. Bbl 1.2. Em .Indd
In this richly illustrated book Alexander Krause investigates the varied history of No. 12 Arcisstraße, which is not only part of Munich’s cultural and intellectual history, but also of a sad chap- ter of world history. Alexander Krause, a lawyer, is Chancellor of the University of Music and Performing Arts Munich. edition monacensia Edited by the Monacensia Literaturarchiv und Bibliothek Dr. Elisabeth Tworek Alexander Krause No. 12 Arcisstraße The Palais Pringsheim – The Führerbau – The Amerika Haus – The Hochschule für Musik und Theater (University of Music and Performing Arts) Translation: Kirsty Malcolm For further information on the publisher and catalogue, see www.allitera.de The Deutsche Bibliothek’s bibliographical information The Deutsche Bibliothek lists this publication in the Deutsche National- bibliografie, with details available online at http://dnb.ddb.de March 2010 Allitera Verlag An imprint of Buch&media GmbH, Munich © 2010 Buch&media GmbH Cover design: Kay Fretwurst, Freienbrink Production: Kessler Druck + Medien GmbH&Co. KG, Bobingen Printed in Germany. isbn 978-3-86906-048-4 Contents The Maxvorstadt district · 9 The Pringsheim family · 14 The Führerbau and the NSDAP (Nazi Party)’s Temples of Honour · 27 The interior of the Führerbau · 38 The Munich Agreement · 46 A warehouse for the Führermuseum · 48 The end of the War · 54 “The Greatest Theft in the History of Art” · 57 Central Art Collecting Point (CCP), the State Archive and other institutions · 60 The Amerika Haus · 62 The Hochschule für Musik (University of Music) · 68 Bibliography · 71 Appendix · 76 Concerts at the Amerika Haus 1948–1957 (selection) · 76 A selection of exhibitions in the Amerika Haus 1948–1957 (selection) · 79 Lectures, recitations and readings in the America Haus 1948–1957 (selection)· 81 Picture credits · 84 Acknowledgements · 84 I would never have believed that I’d ever address another letter to No. -
Ich War Immer Verärgert, Wenn Ich Ein Mädchen Bekam« Thomas Und Katia Mann Als Eltern
ANDREA WÜSTNER »Ich war immer verärgert, wenn ich ein Mädchen bekam« Thomas und Katia Mann als Eltern Mit 22 Abbildungen auf Tafeln Piper München Zürich Wüstner_Ichwarimmerverärgert.indd 3 05.01.2010 17:50:37 Uhr Mehr über unsere Autoren und Bücher: www.piper.de In memoriam Geertruda Joppa und Martha Wüstner, meinen Großmüttern ISBN 978-3-492-05283-2 © Piper Verlag GmbH, München 2010 Satz: Satz für Satz. Barbara Reischmann, Leutkirch Druck und Bindung: Pustet, Regensburg Printed in Germany Wüstner_Ichwarimmerverärgert.indd 4 05.01.2010 17:50:37 Uhr 1 »Einzuleben, einzupassen (soweit es geht)« Thomas Mann und Katia Pringsheim: Herkunft »Das sage ich gleich: Es ist müßig zu fragen, ob es mein ›Glück‹ sein würde. Trachte ich nach dem Glück? Ich trachte nach dem Leben und damit wahrscheinlich ›nach meinem Werke‹. Fer- ner: Ich fürchte mich nicht vor dem Reichthum. Ich habe nie- mals aus Hunger gearbeitet, habe mir schon in den letzten Jahren nichts abgehen lassen und habe schon jetzt mehr Geld, als ich im Augenblick zu verwenden weiß. Auch ist alles Ver- gängliche mir nur ein Gleichnis.«1 Der das schreibt ist Thomas Mann, Ende zwanzig und Star- autor. Die »Buddenbrooks« haben bereits ihre 18. Auflage er- reicht, der Schriftsteller ist ein »berühmter Mann« und wird auf große Gesellschaften eingeladen, wo er in der »anstren- gendsten Weise« zu repräsentieren hat: »Leute gingen um mich herum, beguckten mich, ließen sich mir vorstellen, horchten auf das, was ich sagte. Ich glaube, ich habe mich nicht übel gehalten. Ich habe im Grunde ein gewisses fürstliches Talent zum Repräsentieren, wenn ich einigermaßen frisch bin«, schreibt Thomas an seinen Bruder Heinrich Mann im Februar 1904 über eine Soiree im Hause Pringsheim in der Münchner Arcisstraße. -

Die Mathematik Ist Eine Gar Herrliche Wissenschaft“ ” Penhauer Nicht Gut Auf Die Mathematik Zu Sprechen War
Urs Stammbach Die Mathematik ist eine ” gar herrliche Wissenschaft“ Johann Heinrich Tischbein, Abraham Gotthelf K¨astner von Urs Stammbach 1719–1800 (Smithsonian Images) Ein Mathematiker, der einen Vortrag vor einem allgemeinen Publikum halten soll, steht vor einem schwierigen Problem. W¨ahlt er ein Thema aus der Mathematik, so spaltet er die Zuh¨orerschaft automatisch in drei Teile: Ein Drittel, bestehend aus den Mit-Mathematikerinnen und Mathematikern wird nichts Neues zu h¨oren bekom- men und den Vortrag dementsprechend langweilig finden; ein zweites Drittel, bestehend aus mathematischen Laien wird den vertrackten mathematischen Gedankeng¨angen nicht folgen k¨onnen oder nicht folgen wollen und sich deswegen ebenfalls langweilen; nur das mittlere Drittel der Zuh¨orerschaft wird in einigen glucklichen¨ F¨allen dem Vortrag etwas Interessantes abgewinnen k¨onnen. Das Problem ist ubrigens¨ alt. Schon 1756 hatte der Teil der Zuh¨orerschaft sondern alle Anwesenden an- neuberufene Mathematikprofessor Abraham Gotthelf zusprechen und mit meinem Vortrag in den n¨achs- K¨astner1 in seiner Antrittsrede in G¨ottingen damit ten Minuten etwas unterhalten zu k¨onnen. Die Zitate, zu k¨ampfen. Er sagte dort: die ich vorfuhren¨ will, sind nicht zuf¨allig aufgereiht, sondern sie sind locker eingebettet in eine historisch- Von wenigen und nur denen, die als verstandig gelten, ¨ gesellschaftliche Entwicklung, die auch fur¨ sich allein anerkannt zu werden, ist das Einzige, was ein Mathe- genommen interessant ist und Uberraschungen¨ ent- matiker [...] zu erwarten hat. Den Beifall der Menge zu finden, daran darf er gar nicht erst denken. h¨alt. Man m¨oge mir verzeihen, wenn ab und zu die- ser Hintergrund etwas zu prominent in Erscheinung Ich m¨ochte hier dem Dilemma ausweichen; im Rah- treten sollte. -

Die Mathematik Ist Eine Gar Herrliche Wissenschaft
Research Collection Journal Article Die Mathematik ist eine gar herrliche Wissenschaft Author(s): Stammbach, Urs Publication Date: 2005 Permanent Link: https://doi.org/10.3929/ethz-b-000422890 Originally published in: Mitteilungen der Deutschen Mathematiker-Vereinigung 13(4), http://doi.org/10.1515/ dmvm-2005-0082 Rights / License: In Copyright - Non-Commercial Use Permitted This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection. For more information please consult the Terms of use. ETH Library Urs Stammbach Die Mathematik ist eine ” gar herrliche Wissenschaft“ Johann Heinrich Tischbein, Abraham Gotthelf K¨astner von Urs Stammbach 1719–1800 (Smithsonian Images) Ein Mathematiker, der einen Vortrag vor einem allgemeinen Publikum halten soll, steht vor einem schwierigen Problem. W¨ahlt er ein Thema aus der Mathematik, so spaltet er die Zuh¨orerschaft automatisch in drei Teile: Ein Drittel, bestehend aus den Mit-Mathematikerinnen und Mathematikern wird nichts Neues zu h¨oren bekom- men und den Vortrag dementsprechend langweilig finden; ein zweites Drittel, bestehend aus mathematischen Laien wird den vertrackten mathematischen Gedankeng¨angen nicht folgen k¨onnen oder nicht folgen wollen und sich deswegen ebenfalls langweilen; nur das mittlere Drittel der Zuh¨orerschaft wird in einigen glucklichen¨ F¨allen dem Vortrag etwas Interessantes abgewinnen k¨onnen. Das Problem ist ubrigens¨ alt. Schon 1756 hatte der Teil der Zuh¨orerschaft sondern alle Anwesenden an- neuberufene Mathematikprofessor Abraham Gotthelf -

Erik Pringsheims Tod in Argentinien Verfasst Von Juan D
Kapitel Y , Bayrisch-Puntanisch-Schottisches-Polnisches Drama, Erik Pringsheims Tod in Argentinien verfasst von Juan D. Delius, Universität Konstanz, Konstanz und Julia A. M. Delius, Max Plank Institut für Bildungsforschung, Berlin. Zusatz zur Reseña acerca de los campos que circundan la antigua estancia Monte Molina, Saladillo, Córdoba , http://www.pampa-cordobesa.de . Fassung vom April 2014; versión abreviada en español, ver abajo; shortened version in English, see below. Korrespondenz an [email protected] Es ist bekannt, dass Thomas Mann (*1875, Lübeck -+1955, Zürich), Literaturnobelpreis 1929 beim Schreiben seiner Bücher gerne auf die Erfahrungen seiner Familienmitglieder zurückgriff 1. Seine Schwiegermutter Hedwig Pringsheim (*1855, Berlin -+1942, Zürich) war eine derjenigen, die ihn gelegentlich mit solchem Quellmaterial versorgten. Sie war die Tochter des Kladderadatsch (1848-1944)-Redakteurs Ernst Dohm, ursprünglich Levy (*1819, Breslau, heute Wroclaw, Polen -+1883, Polen) und der frühen Frauenrechtlerin und Schriftstellerin Hedwig Dohm, geborene Schleh, ursprünglich Schlesinger (*1831, Berlin - +1919, Berlin 2). Sie hatte eine Karriere als Schauspielerin aufgegeben, um 1878 Alfred (Israel) Pringsheim (*1850, Ohlau, heute Olawa, Polen -+1941, Zürich) zu heiraten. Dieser war ein sehr reicher Mathematikprofessor in München, dessen Spezialität reelle und komplexe Funktionen waren, in denen die an sich unmögliche, imaginäre Zahl i (=Quadratwurzel von -1) vorkommt. Sein Vater Rudolf Pringsheim (ursprünglich Mendel, *1821, Oels, Schlesien, heute Ole śnica, Polen -+1906, Berlin, ∞Paula Deutschmann, *1827, Oels -+1909, Wannensee) hatte als Fuhr- und Bergbauunternehmer ein riesiges Vermögen 1 Die hier vorgestellten Nachforschungen wurden durch das Buch Inge Jens/Walter Jens: Katias Mutter: Das außerordentliche Leben der Hedwig Pringsheim, Hamburg: Rowohlt 2005, angeregt. Als Inge Jens/Walter Jens: Auf der Suche nach dem verlorenen Sohn: Die Südamerika-Reise der Hedwig Pringsheim, 2. -

Erika Mann-Einblicke in Ihr Leben
1 ERIKA MANN-EINBLICKE IN IHR LEBEN Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der Philosophischen Fakultäten der Albert-Ludwigs-Universität zu Freiburg i.Br. vorgelegt von Anja Maria Dohrmann aus Karlsruhe SS 2003 2 Erstgutachter: Prof. Dr. Rüdiger Scholz Vorsitzende des Promotionsausschusses der gemeinsamen Kommission der Philologischen, Philosophischen und Wirtschafts- und Verhaltenswissenschaftlichen Fakultät: Prof. Dr. Elisabeth Cheauré Datum der letzten Fachprüfung im Promotionsfach: 16. Juni 2003 3 INHALTSVERZEICHNIS Einleitung Seite 1 ERSTER TEIL: Die Biographie 1. Unbeschwerte Kindheit (1905-1924) 26 1.1. Nichts Ernsthaftes 26 1.2. Tölzer Sommer 31 1.3. Pulswärmer für die Soldaten 36 1.4. Das Leben ist die Bühne 39 2. Die Schauspielerin (1924-1932) 47 2.1. Berlin und das Theater 47 2.2. Ein großer Schreck 51 2.3. Rundherum und immer noch Gründgens 56 2.4. Treffpunkt im Unendlichen 60 2.5. Das Schweizerkind 64 2.6. Kinderbücher und tödliche Ungezogenheiten 65 2.7. Eine folgenschwere Rede 69 3. Die Direktorin der Pfeffermühle (1933-1937) 72 3.1. Ein Kabarett wird geboren 72 3.2. Münchner Premiere 74 3.3. "Bonbonniere" und "Serenissimus" 77 3.4. Neubeginn in der Schweiz 80 3.5. Thomas Mann entscheidet sich 86 3.6. Die Pfeffermühle auf Tournée 89 4 3.7. Die Schweiz macht Front 90 3.8. Bürgerin Seiner Majestät 95 3.9. Amerika! Der Vorhang fällt zum letzten Mal 100 4. Die Kämpferin im Exil (1937-1945) 103 4.1. Aller Anfang ist schwer... 103 4.2. Speaches, speaches, speaches 106 4.3. Im Spanischen Bürgerkrieg 109 4.4. Hilfe ist gefragt und noch ein Buch 111 4.5. -

L-G-0011153288-0030588956.Pdf
Hedwig Pringsheim Tagebücher Band 7 1923-1928 Hedwig Pringsheim Tagebücher Band 7 1923 – 1928 Herausgegeben und kommentiert von Cristina Herbst Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. © Wallstein Verlag, Göttingen 2018 www.wallstein-verlag.de Vom Verlag gesetzt aus der Stempel Garamond Umschlag: Susanne Gerhards, Düsseldorf, unter Verwendung eines Ausschnitts aus einem Familienporträt Thomas Mann, 1931, © ullstein bild – ullstein bild. ISBN (Print) 978-3-8353-3183-9 ISBN (E-Book, pdf) 978-3-8353-4206-4 Inhalt Zur Edition . 7 Dank. 9 Einleitung . 11 Zu dieser Ausgabe . 51 Zum Text . 51 Zum Kommentar . 51 Zum Personenregister . 53 Tagebücher 1923 – 1928 1923 . 57 1924 . 115 1925 . 176 1926 . 242 1927 . 311 1928 . 380 Anhang Zusätzliche Dokumente Abbildungen . 451 Zu Alfred Pringsheim Dem Meister der Mathematik (von Max v. Pidoll) . 459 Telephon-Aufführungen . 461 Zu Klaus Pringsheim Gustav Mahler. Zehn Jahre nach seinem Tode . 472 Gustav Mahler und die dt. Gegenwart . 478 [Brief an Professor Bruno Walter] . 480 Aus Berlin (von Max Chop) . 482 Klaus Pringsheims Tätigkeit an den Reinhardt-Bühnen . 485 Zu Thomas Mann Thomas Mann. Zu seinem 50. Geburtstage (von Franz Muncker) . 486 Thomas Mann. Schwere Beschimpfung der deutschen Ozeanflieger (MZ) . 496 6 Inhalt »Flieger-Tröpfe«. Thomas Manns Harmlosigkeiten . 498 Thomas Mann – Praeceptor Monachiae. Ein Brief von Hanns Johst . 501 Zu den Autonomiebestrebungen . 505 Zum Hitler-Putsch . 510 Zum Hitler-Prozeß . 547 Stammtafeln Stammtafel Schleh . 589 Stammtafel Heimann Pringsheim . 595 Stammtafel Alfred Pringsheim . 597 Stammtafel Thomas Johann Heinrich Mann . -

L-G-0009834555-0019351409.Pdf
Hedwig Pringsheim Tagebücher Band 6 1917-1922 Hedwig Pringsheim Tagebücher Band 6 1917 – 1922 Herausgegeben und kommentiert von Cristina Herbst Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. © Wallstein Verlag, Göttingen 2017 www.wallstein-verlag.de Vom Verlag gesetzt aus der Stempel Garamond Umschlag: Susanne Gerhards, Düsseldorf, unter Verwendung eines undatierten Porträts von Hedwig Pringsheim (Ausschnitt) (© KEYSTONE / Thomas-Mann-Archiv, Zürich). ISBN (Print) 978-3-8353-1996-7 ISBN (E-Book, pdf) 978-3-8353-4076-3 Inhalt Zur Edition . 9 Dank. 11 Einleitung . 14 Zu dieser Ausgabe . 66 Zum Text . 66 Zum Kommentar . 67 Zum Personenregister . 68 Tagebücher 1917 – 1922 1917 . 73 1918 . 161 1919 . 248 1920 . 333 1921 . 405 1922 . 475 Anhang Zusätzliche Dokumente Abbildungen . 539 Zu Ernst und HedwigDohm Zu Ernst Dohms 100. Geburtstag . 547 Die letzten Tage von Hedwig Dohm (von H. Pringsheim) . 550 Hedwig Dohm † . 553 Hedwig Dohm (von Adele Schreiber). 555 Hedwig Dohm (von Lida Gustava Heymann) . 558 Zu Hermann Rosenberg Hermann Rosenbergs Testament . 560 Zur Information für meine Testamentsvollstrecker . 561 Aus den Akten des Kaiser Friedrich-Museums-Vereins . 564 6 Inhalt Zu Klaus Pringsheim Revolution und Theater . 566 Schauspielerausstand . 573 K. Pringsheims Tätigkeit an den Reinhardt-Bühnen . 578 Zu Thomas Mann Thomas Manns neues Buch . 580 Wirthshaus zum Sterbebett (von Maximilian Harden). 581 Zu Heinrich Mann Sinn und Idee der Revolution . 584 Zum Ende des Ersten Weltkrieges und den Friedensverhandlungen Wilsons Kriegsziele . 588 Die Entente-Note an Wilson. 594 Wilson über den Völkerbund .