Geologischen Karte
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
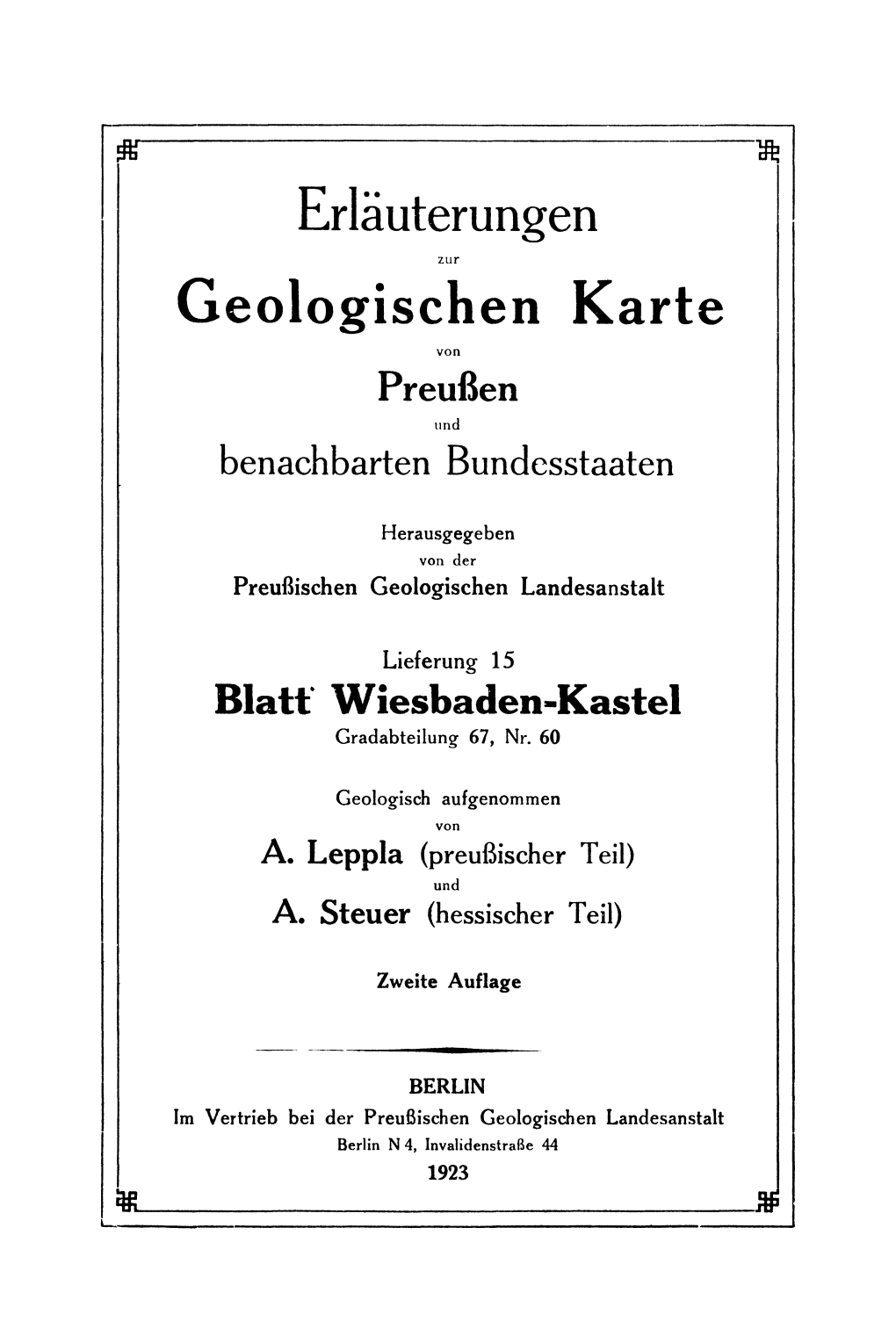
Load more
Recommended publications
-

Ortsbezirk Klarenthal
Amt für Strategische Steuerung, Wohndauer Klarenthal Gesamtstadt Arbeitsmarkt Klarenthal Gesamtstadt Stadtforschung und Statistik Neubürger/-innen 12,0 % 17,8 % Sozialversicherungs- 3 129 103 395 Stadtteilprofile 2016 Wohndauer von Erwach- pflichtig Beschäftigte senen unter 2 Jahre ohne Selbständige und Ortsbezirk Beamte Alteingesessene 29,6 % 27,3 % Klarenthal Wohndauer von Erwach- Beschäftigtenquote 54,7 % 57,3 % senen über 20 Jahre Anteil an den 18- bis 64-Jährigen Bevölkerung Klarenthal Gesamtstadt Melderegister 01.01.2016 Arbeitslose 516 11 031 Einwohner/-innen 10 531 284 620 Anteil Arbeitslose u. 25 J. 14,0 % 11,9 % Anteil an der Haushalte Klarenthal Gesamtstadt Arbeitslosenquote 10,9 % 7,5 % Gesamtbevölkerung: Haushalte 4 903 144 297 Bundesagentur für Arbeit, eigene Berechnungen Personen mit Migrations- 52,9 % 36,2 % 30.09.2015 (Beschäftigte), September 2015 (Arbeitslose) hintergrund* Haushalte mit Kindern 24,0 % 20,2 % Ausländer/-innen 18,3 % 18,9 % Kaufkraft je Einwohner Alleinerziehende 4,9 % 4,7 % Klarenthal Gesamtstadt und Jahr Spätaussiedler* 14,9 % 4,0 % Einpersonenhaushalte 12,7 % 7,1 % in € 21 828 24 770 Melderegister 01.01.2016, * Zuordnungsverfahren auf Basis des mit 75-Jährigen und Melderegisters 01.01.2016 Älteren Wiesbaden=100 88 100 Zuordnungsverfahren auf Basis des Melderegisters 01.01.2016 IFH Unternehmensberatung 2016 Die häufigsten ausländischen Klarenthal Gesamtstadt Staatsangehörigkeiten Individualverkehr Klarenthal Gesamtstadt Wohnungen und Klarenthal Gesamtstadt Neubau Ausländer/-innen 1 927 53 721 PKW darunter: Wohnungen 4 830 140 260 absolut 3 713 135 741 je Haushalt 0,8 0,9 Türkei 22,1 % 17,7 % Neubauquote 0,8 % 1,0 % Syrien 8,7 % 3,1 % Anteil der in den letzten 5 Motorisierungsgrad 44,0 % 57,5 % Polen 6,9 % 8,1 % Jahren fertiggestellten PKW je 100 volljährige Wohnungen Afghanistan 6,0 % 1,8 % Einwohner/-innen ehem. -

Ortsbezirk Frauenstein
Amt für Statistik Wohndauer Frauenstein Gesamtstadt Arbeitsmarkt Frauenstein Gesamtstadt und Stadtforschung Neubürger/-innen 9,9 % 15,7 % Sozialversicherungs- 918 111 255 Stadtteilprofile 2021 Wohndauer von Erwach- pflichtig Beschäftigte senen unter 2 Jahre ohne Selbständige und Ortsbezirk Beamte Alteingesessene 46,8 % 28,6 % Frauenstein Wohndauer von Erwach- Beschäftigtenquote 66,9 % 60,5 % senen über 20 Jahre Anteil an den 18- bis 64-Jährigen Bevölkerung Frauenstein Gesamtstadt Melderegister 01.01.2021 Arbeitslose 53 12 412 Einwohner/-innen 2 382 291 160 Haushalte Frauenstein Gesamtstadt Anteil Arbeitslose u. 25 J. 11,4 % Anteil an der Arbeitslosenquote 4,4 % 8,0 % Gesamtbevölkerung: Haushalte 1 105 147 256 Bundesagentur für Arbeit, eigene Berechnungen Personen mit Migrations- 15,7 % 39,4 % Haushalte mit Kindern 19,7 % 20,3 % 30.09.2020 (Beschäftigte), September 2020 (Arbeitslose) hintergrund* Alleinerziehende 3,4 % 4,2 % Ausländer/-innen 7,6 % 21,9 % Kaufkraft je Einwohner Frauenstein Gesamtstadt Einpersonenhaushalte 7,4 % 7,7 % und Jahr Spätaussiedler* 1,1 % 3,7 % mit 75-Jährigen und in € 25 235 26 601 Melderegister 01.01.2021, * Zuordnungsverfahren auf Basis des Älteren Melderegisters 01.01.2021 Wiesbaden=100 95 100 Zuordnungsverfahren auf Basis des Melderegisters 01.01.2021 IFH Unternehmensberatung, Stand: März 2021 Die häufigsten Wohnungen und Frauenstein Gesamtstadt ausländischen Frauenstein Gesamtstadt Neubau Staatsangehörigkeiten Individualverkehr Frauenstein Gesamtstadt Wohnungen 1 188 142 571 Ausländer/-innen 180 63 -

Wiesbaden Und Der Bergbau
Jb. nass. Ver. Naturkde. 133 S. 89-108 19 Abb. Wiesbaden 2012 Wiesbaden und der Bergbau HARTMUT SCHADE Bergbau auf Erze, Schwerspat, Braunkohle, Ton, Dachschiefer, sonstige Bodenschätze; Bergbehörde Kurzfassung: Die in Wiesbaden nachgewiesenen bergbaulichen Bodenschätze ergeben sich aus den bergrechtlichen Verleihungen. Wo und wann sie aufgesucht und abgebaut wurden, wird aufgezeigt. Wiesbaden war und ist auch Sitz der Bergbehörde. Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung ............................................................................................. 89 2 Bergbau in Wiesbaden ......................................................................... 89 2.1 Gold ..................................................................................................... 89 2.2 Kupfererz ............................................................................................. 90 2.3 Schwerspat ........................................................................................... 91 2.4 Eisen- und Manganerze ....................................................................... 92 2.5 Schwefelkies ........................................................................................ 97 2.6 Braunkohle ........................................................................................... 98 2.7 Ton ....................................................................................................... 98 2.8 Dachschiefer ........................................................................................ 101 2.9 Sonstige Bodenschätze -

Erläuterungen EJ 1880 (Pdf)
Kart. H 140 ?? Erläuterungen zur geologischen Specialkarta von Preussen und den Thüringischm Staaten. ___-„___...un- ‘Gradabtheilung 67, No. 60. Blatt Wiesbaden. \ fh f'ßkf *** _ " ‘” ßé'7 ;' *: €”, . w ‘ ß - .. f;...ff “‘ w - ff 3 E B L I N. Verlag der Simon Schropp’schen Hof-Landkartenhandlung. (J. H. Neumann.) 1880. g @EEEEÜEE%EEVWBEQ @ König]. Universitäts-Bibliothek zu Göttingen. Bl Geschenk Ü! des Kg]. Ministeriums der geistlichen, % Unterrichts- und Med.-Angelegenheiten zu Berlin. „ EX BIBLIOTHECA REGACAUEMLH: 6337135. 1\°“° SUB Göttlngen Blatt Wiesbaden. Gradabtheilung 67 (Breite 510@, Länge 25°|26°), Blatt No. 60. /\/\ /\.n Geognostisch bearbeitet durch Carl Koch. 1. Allgeméine Verhältnisse. Das Gebiet des Blattes Wiesbaden gehört ungefähr zu zwei Drittel seiner Ausdehnung dem Königlich Preussischen Regierungs- bezirke Wiesbaden der Provinz Hessen—Nassau an; das südlich gelegene Drittel gehört zu der Grossherzoglich Hessischen Pro- vinz Rheinhessen. Nur in dem nördlichsten und nordwestlichsten Theile des Blattes verlaufen noch die südlichen Ausläufer des Taunusgebirges, während der übrige Theil den hügeligen Vor- landen oder dem unteren Theile der flachen Rhein-Main-Ebene angehört. Im südwestlichen Theile erheben sich die niedrigen meist sandigen Hügel, welche auf der linken Seite des Rheines fort- setzen und keinen besonderen Namen haben. Die höchsten Punkte liegen in dem nordwestlichen Theile in dem Districte Kohlheck, und zwar an der höchsten Stelle 960 Preuss. (Duodecimal-) Fuss *); der Frauensteiner Berg bei Dotzheim misst innerhalb des Blattes 924 Fuss und der Neroberg bei Wiesbaden 781 Fuss. Das mit jüngeren Gebirgsschichten be- deckte meist flachböschige Hügelland vor dem Taunus hat seinen höchsten Punkt bei der Bierstadter Warte, welche 685 Fuss hoch *) Alle Höhenangaben, bei denen Nichts anderes bemerkt ist, beziehen sich auf den Nullpunkt des Amsterdamer Pegels in Preuss. -

Haltestellenverzeichnis Wiesbaden 2021
Haltestellenverzeichnis Gemeinde Ortsteil Ziel- Haltestelle Linie code Altheim (Hess) Münster (Hessen) Amöneburg (Wiesbaden) Wiesbaden Aschaffenburg Aschaffenburg Hauptbahnhof ▲ RB75 9110 Assmannshausen Rüdesheim (Rhein) Auringen Wiesbaden Babenhausen (Hess) Babenhausen (Hess) Bahnhof RB75 4143 Hergershausen (DA) Bahnhof RB75 4143 Bad Camberg Bad Camberg Bahnhof RE20, RB21, RB22 6101 Bad Homburg v.d.Höhe Bad Homburg v.d.Höhe Bahnhof X26 5101 Feldbergstraße X26 5101 Finanzamt X26 5101 Kurhaus X26 5101 Markt X26 5101 Untertor/Friedhof X26 5101 Biebrich (Wiesbaden) Wiesbaden Bierstadt Wiesbaden Bischofsheim (Kr GG) Bischofsheim (Kr GG) Bahnhof S8, S9, RB75 6593 Braubach Braubach Bahnhof # RB10 Brechen Niederbrechen Bahnhof RE20, RB21, RB22 6120 Oberbrechen Bahnhof RB21, RB22 6120 Breckenheim Wiesbaden Bremthal Eppstein (Taunus) Bretzenheim (Mainz) Mainz Büttelborn Klein-Gerau Bahnhof RB75 3715 Darmstadt Darmstadt Hauptbahnhof RB75 4001 Nordbahnhof RB75 4001 Kranichstein Bahnhof RB75 4035 Delkenheim Wiesbaden Dieburg Dieburg Bahnhof RB75 4128 Diedenbergen Hofheim (Taunus) Dietesheim Mühlheim am Main, Stadt 630670 Haltestellenverzeichnis Gemeinde Ortsteil Ziel- Haltestelle Linie code Dietzenbach Dietzenbach Bahnhof S2 3550 Mitte Bahnhof S2 3550 Steinberg Bahnhof S2 3550 Dotzheim Wiesbaden Drais Mainz Dudenhofen (b Offenbach) Rodgau Eddersheim Hattersheim (Main) Eltville am Rhein Eltville am Rhein Bahnhof RE9, RB10 6455 Erbach (Rheingau) Bahnhof RE9, RB10 6455 Hattenheim Bahnhof RE9, RB10 6494 Martinsthal Am Steinberg 5 6455 Schiersteiner Straße -

Vertrauen Durch Kompetenz Wir Tun Alles, Damit Sie Sich Weiterhin Wohlfühlen! Pflegezeit Wiesbaden Wir Pflegen Helmholtzstraße • Grundpflege (Z.B
Nehmen Sie Kontakt auf! Viele weitere Informationen zu Pflegezeit und unserem Ambulanten Pflegedienst erhalten Sie auf unserer Webseite unter www.pflegezeit.com. Darüber hinaus berichten wir regelmäßig über unsere Aktivitäten auf unserer facebook-Seite unter Unsere Leistungen www.facebook.com/pflegezeit. Schauen Sie rein! Seit über 30 Jahren beraten, pflegen und helfen wir Menschen in ihrer eigenen Häuslichkeit. Im Mittel- Schönbergstraße punkt unserer Arbeit steht immer der zu pflegende Mensch mit seinem Anspruch auf ein selbstbe- stimmtes Leben in seiner gewohnten Umgebung. Vertrauen durch Kompetenz Wir tun alles, damit Sie sich weiterhin wohlfühlen! Pflegezeit Wiesbaden Wir pflegen Helmholtzstraße • Grundpflege (z.B. Körperpflege, Mahlzeiten, Kohlheckstraße Mobilisation) • Behandlungspflege (z.B. Medikamentengabe, Krähenweg Verbandswechsel, Injektionen, Stomaversorgung, Blutzuckermessungen) Edisonstraße • Palliativpflege Hertzstraße • Hauswirtschaftliche Versorgung • Einkäufe • Spaziergänge Wir fahren an: Auringen, Biebrich, Bierstadt, Wir organisieren Breckenheim, Delkenheim, Dotzheim, Erbenheim, • Pflegehilfsmittel Frauenstein, Heßloch, Igstadt, Klarenthal, Kloppen- • Hausnotrufsysteme heim, Mainz-Amöneburg, Mainz-Kastel, Mainz- • Friseur & Fußpflege nach Hause Kostheim, Medenbach, Naurod, Nordenstadt, • Essen auf Rädern Rambach, Schierstein, Sonnenberg und auf Anfra- • Ergo-, Physio- und Logotherapie ge auch darüber hinaus. Wir beraten Pflegezeit Wiesbaden GmbH • in allen Fragen rund um Pflege, Betreuung Helmholtzstraße 52 & Hilfeleistungen 65199 Wiesbaden Telefon: 0611 - 26 75 66 0 Wir helfen Fax: 0611 - 26 75 66 22 • bei Pflegeanträgen und Kostenklärung Email: [email protected] • bei Behördengängen Web: www.pflegezeit.com • als Urlaubsvertretung der Pflegeperson FB: www.facebook.com/pflegezeit Stand: 06/2017 Stand: Pflegedienst Ihres Vertrauens 10 gute Gründe für Pflegezeit Seit vielen Jahren pflegen wir von Pflegezeit Wiesbaden 1. Geprüfte Qualität: Wir reden nicht nur über Qualität, Einstufung in Pflegegrade und Wohnraumanpassung. -

Planungsraumprofile Igstadt
Amt für Statistik Wohndauer Igstadt-Mitte Igstadt Arbeitsmarkt Igstadt-Mitte Igstadt und Stadtforschung Neubürger/-innen 9,4 % 9,5 % Sozialversicherungs- 842 842 Stadtteilprofile 2021 Wohndauer von Erwach- pflichtig Beschäftigte senen unter 2 Jahre ohne Selbständige und Planungsraum Beamte Alteingesessene 38,2 % 38,9 % Igstadt-Mitte Wohndauer von Erwach- Beschäftigtenquote 61,8 % 61,8 % senen über 20 Jahre Anteil an den 18- bis 64-Jährigen Bevölkerung Igstadt-Mitte Igstadt Melderegister 01.01.2021 Arbeitslose 47 47 Einwohner/-innen 2 170 2 239 Haushalte Igstadt-Mitte Igstadt Anteil Arbeitslose u. 25 J. Anteil an der Arbeitslosenquote 4,1 % 4,1 % Gesamtbevölkerung: Haushalte 973 1 001 Bundesagentur für Arbeit, eigene Berechnungen Personen mit Migrations- 17,2 % 16,9 % Haushalte mit Kindern 24,8 % 24,8 % 30.09.2020 (Beschäftigte), September 2020 (Arbeitslose) hintergrund* Alleinerziehende 4,3 % 4,2 % Ausländer/-innen 7,2 % 7,0 % Kaufkraft je Einwohner Igstadt-Mitte Igstadt Einpersonenhaushalte 4,2 % 4,2 % und Jahr Spätaussiedler* 2,8 % 2,7 % mit 75-Jährigen und in € . 27 987 Melderegister 01.01.2021, * Zuordnungsverfahren auf Basis des Älteren Melderegisters 01.01.2021 Wiesbaden=100 . 105 Zuordnungsverfahren auf Basis des Melderegisters 01.01.2021 IFH Unternehmensberatung, Stand: März 2021 Die häufigsten Wohnungen und Igstadt-Mitte Igstadt ausländischen Igstadt-Mitte Igstadt Neubau Staatsangehörigkeiten Individualverkehr Igstadt-Mitte Igstadt Wohnungen 1 047 1 072 Ausländer/-innen 156 156 PKW Neubauquote 2,6 % 2,5 % darunter: Anteil -

Die Sozialdemokratie Und Die Eingemeindung 1926-1928 Im
Die Sozialdemokratie und die Eingemeindung 1926/1928 im Rahmen der 135-jährigen Geschichte der Dotzheimer SPD ____________________________________________________ Seit 140 Jahren gibt es eine sozialdemokratische Parteistruktur in Deutschland und seit 135 Jahren in Dotzheim - eine Kontinuität, auf die wir stolz sein können und die lediglich während der letzten Jahre der Nazi-Diktatur unterbrochen wurde. Ich möchte zunächst auf diese „roten“ Wurzeln eingehen, ehe ich dann das Einge- meindungsthema aufgreife. Die Sozialdemokratie war lange Zeit nicht nur einfach eine Partei, sondern auch und zuerst eine soziale Bewegung, bei der sich schwer sagen lässt, wann sie sich gebil- det hat; exakte Entstehungsdaten gibt es jedenfalls nicht. Als Geburtsstunde gilt „par- teihistorisch“ der 23. Mai 1863 – ein mittlerweile 140 Jahre zurückliegendes Ereignis: Damals gründete Ferdinand Lassalle in Leipzig den Allgemeinen Deutschen Arbei- terverein (ADAV). Von diesem Zeitpunkt an lässt sich von einer ungebrochenen Kon- tinuität der sozialistischen sozialdemokratischen Arbeiterbewegung und Partei spre- chen, die fortan als eigenständige politische Organisation auftrat und ihre gesell- schaftspolitischen Forderungen vertreten konnte. Ferdinand Lassalle war eine schillernde Persönlichkeit: Jüdischer Großbürgersohn, Bohemien, Jurist, Intellektueller. Als Anwalt vertrat er in 36 Prozessen vor 20 Gerich- ten die Gräfin Sophie von Hatzfeldt in derem Ehescheidungsverfahren und starb an den Folgen eines Duells wegen einer Liebesgeschichte 1864 in Genf - nicht gerade -

Breckenheim Igstadt Medenbach Auringen Naurod Rambach
Naurod Auringen LANDESHAUPTSTADT Nordost 23 22 Kellerkopf Auringer Rundwanderweg 26 Rundwanderweg um die Opelbad auf dem Neroberg Sonnenberg Ausflugsziel mit Aussichtsturm und angeschlossenem Berggasthof Auringer Gemarkung ab/bis Freibad mit einer 65 Meter 25 auf 474 Metern Höhe Hinkelhaus mit Informati- Bahn und Rutsche über Burg Sonnenberg onstafeln und Einkehrmög- den Dächern der Stadt mit Burgruine mit Museum im Linie(n): 21 | 22 lichkeit gastronomischem Angebot Erbsenacker Bergfried sowie angrenzender Linie(n): 21 Waldlandschaft zum Spazieren Linie(n): 1 Kloppenheim & Bahnhof Auringen-Medenbach - und Spielen Kletterwald & Walderleb Nerotal Heßloch nispfad gleich um die Ecke. (anschließende Fahrt mit Linie(n): 16 | 18 19+ 20 Medenbach der Nerobergbahn) Hofgartenpatz Hessischer Radfernweg R6 – „Flusstäler und Wälder“ 21 Fernradweg für die ganze Streuobstroute „Nassauer Rambach Familie mit kostenfreien Land“ mit Sortengarten Klarenthal 24 Parkplätzen Netz von Wander- und Goldsteintal Radwegen vorbei an 1 Linie(n): 21 | 22 Streuobstbeständen und Tier- & Pflanzenpark Landschaftspark mit weit Erbsenacker Sortengarten mit über Fasanerie verzweigten Grünländern, 150 Bäumen und 120 Tierpark mit zahlreichen beliebtes Erholungsgebiet und verschiedenen Sorten, heimischen Tier- & Zielpunkt für Wanderungen ausgeschildert mit Pflanzenarten, wie Wölfen, von der Innenstadt Infotafeln Wildkatzen und Füchsen Linie(n): 16 Linie(n): 21 Linie(n): 33 Goldsteintal Naurod Kirschenbergstraße Tierpark Fasanerie Dotzheim www.wiesbaden.de 23 2 Rambach Auringen -

Schiedsamtsbezirk Adresse Schiedsamt Zuständige Stadt
Schiedsamtsbezirk Adresse zuständige Stadt- Name Sprechzeit Telefon E-Mail Schiedsamt bzw. Gemeinde- Schiedsper- verwaltung sonen Wiesbaden Alt I – III Rathaus Wiesbaden Landeshauptstadt Wiesbaden Peter Vogt Nach Vereinbarung 0611/974 46 69 [email protected] Gesamte Innenstadt Schloßplatz 6 Rechtsamt 0611/31 3637 [email protected] Erdgeschoss Zi. 17 Wilhelmstraße 32 Stellvertreter/in: Mobil: Fax: 0611 9744666 65183 Wiesbaden Burghard Heidke 0170 150 36 86 Tel. 0611/31-0 Klarenthal Rathaus Wiesbaden Landeshauptstadt Wiesbaden Burghard Heidke Nach Vereinbarung 0611/46 69 65 Schloßplatz 6 Rechtsamt in Hermann-Brill-Str. 4 Mobil: Erdgeschoss Zi. 17 Wilhelmstraße 32 Stellvertreter/in: Altenwohnanlage 11 0175 3710293 65183 Wiesbaden Bernd Thielmann 65197 Wiesbaden Tel. 0611/31-0 Biebrich Ortsverwaltung Landeshauptstadt Wiesbaden Helmut Caspary Nach Vereinbarung 0611-601898 [email protected] Biebrich Rechtsamt Rathausstr. 63 Wilhelmstraße 32 Stellvertreter/in: 65203 Wiesbaden 65183 Wiesbaden Ernst Schauß Tel. 0611/31-0 Bierstadt Ortsverwaltung Landeshauptstadt Wiesbaden Manfred Kinzer Dienstag 0611/31-7264 [email protected] mit Heßloch, Igstadt, Bierstadt Rechtsamt 17:00 – 18:00 Uhr Kloppenheim, Breckenheim Poststraße 11 a Wilhelmstraße 32 Stellvertreter/in: 65191 Wiesbaden 65183 Wiesbaden Monika Zerbe-Hardt Tel. 0611/31-0 Delkenheim Ortsverwaltung Landeshauptstadt Wiesbaden Klaus Wehner Nach Vereinbarung 06122/508-0 [email protected] Delkenheim Rechtsamt Rathausplatz 2 Wilhelmstraße 32 Stellvertreter/in: 65205 Wiesbaden 65183 Wiesbaden Erika Büttner Tel. 0611/31-0 Dotzheim Ortsverwaltung Landeshauptstadt Wiesbaden Bernd Thielmann Nach Vereinbarung 0611/204 7254 [email protected] mit Frauenstein und Dotzheim Rechtsamt Schierstein Postadresse für Wilhelmstraße 32 Stellvertreter/in: Schiedsamt: 65183 Wiesbaden Burghard Heidke Tel. 0611/31-0 Rathaus Schierstein Karl-Lehr-Str. -

Geschäftsverteilung Im Gerichtsvollzieherdienst Stand
A M T S G E R I C H T W I E S B A D E N Geschäftsverteilung 2 0 2 1 des Gerichtsvollzieherdienstes Stand: 01.07.2021 Geschäftsverteilung im Gerichtsvollzieherdienst Die Geschäfte der Gerichtsvollzieher werden ab 01.07.2021 wie folgt geändert: Vorbemerkungen I. Für die Erledigung von Zustellungsaufträgen, die der Gerichtsvollzieher persönlich durchzu- führen hat, die in verschiedenen Gerichtsvollzieherbezirken des Amtsgerichtsbezirks Wiesbaden auszuführen sind, ist der jeweilige Gerichtsvollzieher des Gerichtsvollzieher- bezirks zuständig. Sollen z. B. Zustellungen an mehrere Drittschuldner, die in verschiedenen Gerichtsvollzieherbezirken des Amtsgerichts Wiesbaden sesshaft sind, erfolgen, so führt zunächst der für den zuerst genannten Drittschuldner zuständige Gerichtsvollzieher die Zustellung an die in seinem Gerichtsvollzieherbezirk wohnenden Drittschuldner aus. Hiernach gibt er das zuzustellende Schriftstück an den für den nächsten Drittschuldner zu- ständigen Gerichtsvollzieher ab. Anlage 1) dieser Geschäftsverteilung ist eine alphabetische Liste sämtlicher Straßen des Amtsgerichtsbezirks Wiesbaden. Jeder Straße ist der zuständige Gerichtsvollzieher zugeordnet. Anlage 2) regelt abweichend von Anlage 1) außerordentliche Zuständigkeiten unabhängig von der Straßenzuordnung. Anlage 3) dieser Geschäftsverteilung ist die Übersicht der Vertretungsregelung sowie der Zuständigkeit für die auswärtigen Zustellungen. II. Unberührt von der Zuständigkeitsregelung in Ziffer I bleiben die in § 16 GVO aufgeführten Fälle. Für die Erledigung von Aufträgen, die ohne Gefährdung der Parteirechte keinen Aufschub gestatten, gilt meine Verfügung vom 08.12.1958 – 32 Eb – 25 -. Danach ist der „Eilgerichts- vollzieher“ der nach der Geschäftsverteilung zuständige Gerichtsvollzieher. Im Verhinderungsfall ist sein in der Geschäftsverteilung bestimmter Vertreter in Anspruch zu nehmen. Sind Gerichtsvollzieher und Vertreter nicht zu erreichen, so ist der Gerichtsvollzieher, der am schnellsten zu erreichen ist, für die Erledigung des Eilauftrages zuständig. -

Verbundweiter Nahverkehrsplan Für Die Region Frankfurt Rhein-Main 2
Verbundweiter Nahverkehrsplan für die Region Frankfurt Rhein-Main 2. Fortschreibung 2020 – 2030 Entwurf 1 Inhaltsverzeichnis 1 Ziele und Anforderungen .................................................................................................... 6 1.1 Einführung ..................................................................................................................... 6 1.2 Leitbild und Ziele – Mobilität 2030 ................................................................................. 7 1.3 Vorgehensweise .......................................................................................................... 15 1.4 Künftige Entwicklungen und Zukunftstrends ............................................................... 16 1.5 Gesetzliche und planerische Rahmenbedingungen.................................................... 24 2 Bestandsaufnahme ........................................................................................................... 25 2.1 Einführung ................................................................................................................... 25 2.2 Leistungsangebot und Verkehrsnachfrage ................................................................. 41 2.3 Bahnhöfe und Haltestellen .......................................................................................... 51 2.4 Streckeninfrastruktur ................................................................................................... 73 2.5 Fahrzeuge ..................................................................................................................