Studie Games & VXR in Sachsen 2020
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
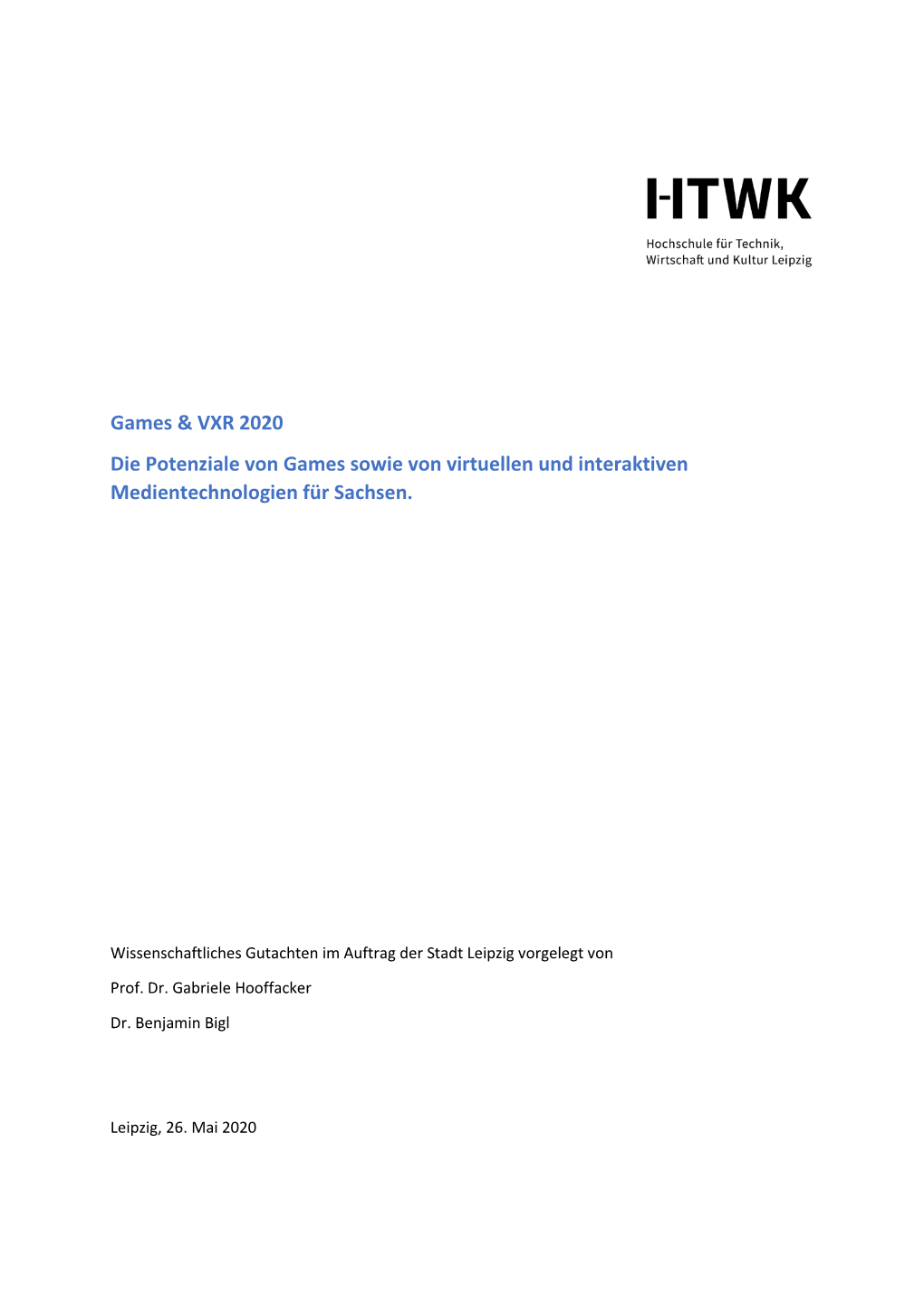
Load more
Recommended publications
-

It's Meant to Be Played
Issue 10 $3.99 (where sold) THE WAY It’s meant to be played Ultimate PC Gaming with GeForce All the best holiday games with the power of NVIDIA Far Cry’s creators outclass its already jaw-dropping technology Battlefi eld 2142 with an epic new sci-fi battle World of Warcraft: Company of Heroes Warhammer: The Burning Crusade Mark of Chaos THE NEWS Notebooks are set to transform Welcome... PC gaming Welcome to the 10th issue of The Way It’s Meant To Be Played, the he latest must-have gaming system is… T magazine dedicated to the very best in a notebook PC. Until recently considered mainly PC gaming. In this issue, we showcase a means for working on the move or for portable 30 games, all participants in NVIDIA’s presentations, laptops complete with dedicated graphic The Way It’s Meant To Be Played processing units (GPUs) such as the NVIDIA® GeForce® program. In this program, NVIDIA’s Go 7 series are making a real impact in the gaming world. Latest thing: Laptops developer technology engineers work complete with dedicated The advantages are obvious – gamers need no longer be graphic processing units with development teams to get the are making an impact in very best graphics and effects into tied to their desktop set-up. the gaming world. their new titles. The games are then The new NVIDIA® GeForce® Go 7900 notebook rigorously tested by three different labs GPUs are designed for extreme HD gaming, and gaming at NVIDIA for compatibility, stability, and hardware specialists such as Alienware and Asus have performance to ensure that any game seen the potential of the portable platform. -

DIE Nächsteation UNSERE EXPERTEN TRENNEN DIE BUZZWORDS VON FAKTEN ANALYSEN UND ERKENNTNISSE VON EPIC, HAVOK UND BUNGIE
JEDE AUSGABE MIT FIRMENREGISTER 04/2013 € 6,90 OFFIZIELLER PARTNER VON DESIGN BUSINESS ART TECHNOLOGY 04 4 197050406909 GENERDIE NÄCHSTEaTION UNSERE EXPERTEN TRENNEN DIE BUZZWORDS VON FAKTEN ANALYSEN UND ERKENNTNISSE VON EPIC, HAVOK UND BUNGIE MEINUNG BEST PRACTICE INTERVIEW ICH HASSE DRM! ODER WIE SICH BEI UNITY3D-ASSETS UBISOFTS JADE RAYMOND ÜBER DOCH WAS ANDERES? RECHENLEISTUNG SPAREN LÄSST DEN NÖTIGEN ERNST IM SPIEL "PHANTASIE, NICHT ERFINDUNG, SCHAFFT IN DER KUNST WIE IM LEBEN DAS GANZ BESONDERE." Joseph Conrad Die Welt, die Sie erschaffen, soll nur durch Ihre Vorstellungskraft limitiert sein – nicht durch die Leistung Ihres Servers. Verschieben Sie Ihre Grenzen. Managed Hosting von Host Europe. Kompromisslose Rechenleistung schon ab € 89 mtl.* Managed Hosting – Rechenpower und individueller Service ▶ Dell® Markenhardware, individuell für Ihre Anforderungen konfiguriert ▶ Hosting im Hightech-Rechencenter mit garantierter Verfügbarkeit und bester Netzanbindung ▶ Managed Service mit festen Ansprechpartnern, 24/7/365 Wartung und Entstörung Mehr Informationen: i www.hosteurope.de/creation Kontakt & Beratung (Mo-Fr: 09-17 Uhr) 02203 1045 2222 www.hosteurope.de *Die einmalige Setupgebühr entfällt. Die Aktion gilt bis zum 31.07.2013. Die Hardware ist individuell konfigurierbar. Die Mindestvertragslaufzeit beträgt 24 Monate – alternative Laufzeiten sind optional möglich. Die Kündigungsfrist beträgt 4 Wochen zum Ende der Laufzeit. Editorial Making Games Magazin 04/2013 UNGERECHTE E3 ie hatten das bessere Line-up, die Next-Gen-Tipps von Havok & Epic Heiko Klinge innovativere Technologie und die Mehr als genug Gründe also, den Shitstorm ist Chefredakteur vom unterhaltsamere Show: Trotzdem mal getrost zu ignorieren und die eigentlichen Making Games Magazin. hat Microsoft das Next-Gen- Auswirkungen der Next Gen in unserem Kräftemessen mit Sony nach Mei- Titelthema ein wenig genauer unter die Lupe nung fast aller Beobachter und zu nehmen. -

Attending the Games Convention 2007
Vol. 1, Issue 1/2007 Black and White: Attending the Games Convention 2007 Ralf Stockmann Since the sneaky death of the E3 Entertainment Expo, the “Games Convention (GC)” established itself as the international gaming industry’s leading fair. 185.000 visitors - amongst them 3.300 journalists and 503 exhibitors - populated the crowded halls in Leipzig, Germany. But when it comes to innovation and evolution, the GC 2007 falls short. Thus, my answer on “how is the GC this year?” is “Just like last year. Played Table Tennis. Played Crysis. Waited for Spore. Maybe the GC is not exactly like last years – it is whiter”. The GC 07 does not encourage my faith in the video game industry. Instead, it was simply another year of waiting for the big titles: Crysis [1] much awaited successor of the both critics and players acclaimed Far Cry [2], is still in manufacturing. The single player demo looked breathtakingly good and played smooth and intense. So did the multiplayer demo one year ago. One has to raise the question what kind of progress has been made to justify this lack of scheduling. The situation gets only worse concerning Spore [3], probably the most awaited game recently: there was no demo at all. The so called “Spore creature editor” with its unique, bizarre possibilities of creating complex live forms out of nothing was the unchallenged highlight of the GC 06. There was no editor available this year, literally there was nothing available, and when I asked the staff at Electronic Arts (EA), they barely recognized the title of their forthcoming flagship. -

Total Conquest Adventure Games Overview Godfather Hattrick Liberté Lords of the Earth Middle Earth PBM Prometheus Raceplan Sports News Ultima Online Worlds Apart
ISSUE 99 Flagship THR MAGAZINE FOR GAMERS £3.95 Total Conquest Adventure Games Overview Godfather Hattrick Liberté Lords of the Earth Middle Earth PBM Prometheus Raceplan Sports News Ultima Online Worlds Apart plus ... Games Galore! The 10 Best Online Games, Board Games, Roleplaying, New PBM Games, D20 & Dark Age RPG... Convention Listings, plus news from GenCon UK! Zine Scene ... ... and all the gaming news, views & reviews! AUSTERLITZ The Rise of the Eagle THE No 1 NAPOLEONIC WARGAME AUSTERLITZ is the premier PBM & PBEM Napoleonic Wargame. An award winner all over Europe, unparalleled realism and accurate modelling of Europes armies make this a Total Wargaming Experience! MAIN FEATURES OF THE GAME Two elegant battle systems Blockades, coastal defence and fleet realistically simulating strategic and actions involving the periods major tactical warfare. naval powers. Large scale three map action Austerlitz offers you the chance to encompassing both European and play the wargame of your dreams! Colonial holdings. Command Napoleonic armies of over Active political and diplomatic system 100 battalions in the field. Try your which encourages grand alliance and strategy across all the old battlefields evil treachery! of Europe and fight battles that history never saw! Austerlitz is the Sophisticated trade and economic ultimate challenge; a thinking mans systems give authentic control of a dream of world domination. Napoleonic economy. Austerlitz is now playable fully by email at a reduced price. For details or for a FREE Information Pack contact: SUPERSONIC GAMES LTD PO BOX 1812, Galston, KA4 8WA Email: [email protected] Phone: 01563 821022 or fax 01563 821006 (Mon-Fri 9am 5.30pm) Report from FLAGSHIP #99 the Bridge October / November 2002 Sense & Sensitivity IT’S GOOD to bring you an issue that’s crammed with news, review and comments, all inside a terrific cover. -
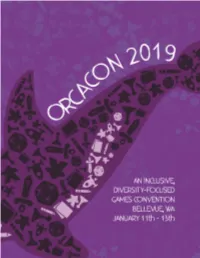
Orcacon-2019-Program-Web.Pdf
WELCOME TO ORCACON 2019 Greetings, OrcaFriends! Wow, it’s already time for OrcaCon again; it seems like just last week we were here playing games and eating delicious food truck noms. We welcome back everyone who’s been with us from the beginning, and offer a joyous hello to all of you who are new to our wee convention. OrcaCon was founded by a group of friends with an idea of a modest friendly convention, focused on being a welcoming and safe space for folks of all ages to play games. We decided early on to focus on bringing diversity, inclusion, and accessibility to tabletop games, and highlighting many marginalized creators who feel left out of other tabletop spaces. For year four, we’re focusing on LGBTQIA+ creators, artists, designers, and more. Be sure to attend their panels and play their games during your weekend. We’re extremely excited to present an amazing guest list, and hope you’ll get a chance to play games with them or have a wee chat. They’ve submitted some great games and panels, so be sure to drop by and see that they’re doing. It’s great to support marginalized creators! We are extremely happy to be back here at the Bellevue Hilton. They’ve been so kind to allow us free parking and to bring in food trucks. They’ve been a delight to work with so be sure to say thanks when you interact with them! Speaking of new things for 2019, we’re also excited about some new Sponsors and groups. -

Handbuch Gameskultur Warum Games Teil Der Kultur Familie Sind Olaf Zimmermann & Felix Falk
HAND HERAUSGEBER: OLAF ZIMMERMANN UND FELIX FALK BUCH GAMES KULTUR ÜBER DIE KULTURWELTEN VON GAMES HAND BUCH GAMES KULTUR HAND BUCH GAMES KULTUR HERAUSGEBER: OLAF ZIMMERMANN UND FELIX FALK INHALT INTRO GRUNDLAGEN WARUM GAMES 1.1 SPIELEN 023 TEIL DER KULTUR JENS JUNGE FAMILIE SIND 009 1.2 GAME STUDIES 029 OLAF ZIMMERMANN & GUNDOLF S. FREYERMUTH FELIX FALK 1.3 GAMEBEGRIFFE 034 TUTORIAL 012 JOCHEN KOUBEK CHRISTIAN HUBERTS & FELIX ZIMMERMANN 1.4 GESCHICHTE 039 NICO NOLDEN 1.5 SCHNITTSTELLEN 046 TIMO SCHEMERREINHARD 1.6 ERSTE SCHRITTE 049 DANIEL HEINZ & TORBEN KOHRING 1.7 KANON 053 ÇIĞDEM UZUNOĞLU & DAS TEAM DER STIFTUNG DIGITALE SPIELEKULTUR 002 —— 003 KUNST & KULTUR VERMITTLUNG 2.1 BILDENDE KUNST 063 3.1 SERIOUS GAMES 105 STEPHAN SCHWINGELER STEFAN GÖBEL 2.2 THEATER 069 3.2 ERINNERUNGS 110 JAN FISCHER KULTUR EUGEN PFISTER & 2.3 LITERATUR 074 FELIX ZIMMERMANN LENA FALKENHAGEN 3.3 SOZIALADÄQUANZ 116 2.4 FILM & SERIE 080 JÖRG FRIEDRICH ANDREAS RAUSCHER 3.4 KULTURARCHIVE 120 2.5 MUSIK 085 SEBASTIAN MÖRING MELANIE FRITSCH 3.5 BEWAHRUNG 125 2.6 GEWALT 091 ANDREAS LANGE JÖRG VON BRINCKEN 3.6 MUSEUM 131 2.7 ÄSTHETIK 097 LINDA PFISTER, CELINA RETZ, DANIEL MARTIN FEIGE SUSANNE GRUBE, ULRICH SCHMID & SABIHA GHELLAL 3.7 JOURNALISMUS 136 MICHAEL GRAF INHALT GEMEINSCHAFT DEBATTEN 4.1 COMMUNITYS 145 5.1 KULTURPOLITIK 177 BENJAMIN STROBEL OLAF ZIMMERMANN 4.2 LET’S PLAY 151 5.2 FÖRDERUNG 182 & STREAMING FELIX FALK VERA MARIE RODEWALD 5.3 GEFÄHRLICHE 186 4.3 COSPLAY 156 MEDIEN KAREN HEINRICH MARTIN ANDREE 4.4 MODDING 160 5.4 KILLERSPIELE 193 STEFAN KÖHLER ANDREAS GARBE 4.5 ESPORT 165 5.5 JUGENDSCHUTZ 199 MARKUS BREUER & MARTIN LORBER DANIEL GÖRLICH 5.6 DIVERSITÄT 203 4.6 EVENTS 171 NINA KIEL THORSTEN S. -

University of Oklahoma Graduate College An
UNIVERSITY OF OKLAHOMA GRADUATE COLLEGE AN ETHNOGRAPHY OF TWITCH STREAMERS: NEGOTIATING PROFESSIONALISM IN NEW MEDIA CONTENT CREATION A DISSERTATION SUBMITTED TO THE GRADUATE FACULTY in partial fulfillment of the requirements for the Degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY By CHRISTOPHER M. BINGHAM Norman, Oklahoma 2017 AN ETHNOGRAPHY OF TWITCH STREAMERS: NEGOTIATING PROFESSIONALISM IN NEW MEDIA CONTENT CREATION A DISSERTATION APPROVED FOR THE DEPARTMENT OF COMMUNICATION BY _______________________________ Dr. Eric Kramer, Chair _______________________________ Dr. Ralph Beliveau _______________________________ Dr. Ioana Cionea _______________________________ Dr. Lindsey Meeks _______________________________ Dr. Sean O’Neill Copyright by CHRISTOPHER M. BINGHAM 2017 All Rights Reserved. Dedication For Gram and JJ Acknowledgements There are many people I would like to acknowledge for their help and support in finishing my educational journey. I certainly could not have completed this research without the greater Twitch community and its welcoming and open atmosphere. More than anyone else I would like to thank the professional streamers who took time out of their schedules to be interviewed for this dissertation, specifically Trainsy, FuturemanGaming, Wyvern_Slayr, Smokaloke, MrLlamaSC, BouseFeenux, Mogee, Spooleo, HeavensLast. and SnarfyBobo. I sincerely appreciate your time, and am eternally envious of your enthusiasm and energy. Furthermore I would like to acknowledge Ezekiel_III, whose channel demonstrated for me the importance of this type of research to semiotic theory, as well as CohhCarnage and ItmeJP, whose show Dropped Frames, allowed further insight into the social milieu of professional Twitch streaming. I thank Drew Harry, PhD, Twitch’s Director of Science for responding to my enquiries. Finally, I thank all the streamers and fans who attended TwitchCon in 2015 and 2016, for the wonderful experience. -

Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis Computerspiel-Events gestern und heute Mit dem Science MashUp zurück zu den Wurzeln -- in die Zukunft. 3 Gabriele Hooffacker 1 Neues Format: Science MashUp ................................ 4 2 Aus einer Vortragsreihe entstanden .............................. 6 3 Games und Games Studies verbinden ............................ 7 3.1 E-Sport ............................................... 8 3.2 3D- und VR-Technologien ................................ 9 3.3 Mobile-Gaming ........................................ 9 3.4 Gamification & App-Entwicklung .......................... 9 4 Warum eine Publikation? ..................................... 10 Literatur ...................................................... 11 Transfer der 14. Langen Nacht der Computerspiele in die virtuelle Welt ................................................. 13 Vanessa Funke und Lisa Herrmann 1 Bereiche und Arbeitsteams .................................... 14 2 Aufbau und Funktion der Kanäle ............................... 15 3 Reichweite in Social Media und der Website ...................... 17 4 Positive Aspekte der gesamten Umsetzung ....................... 21 5 Analyse der verschiedenen Problemstellungen .................... 22 6 Optimierungsvorschläge für die LNC 2021 ....................... 23 7 Fazit ...................................................... 24 Abbildungsverzeichnis .......................................... 24 Literatur ...................................................... 28 IX X Inhaltsverzeichnis Computer- und Spiele-Veranstaltungen -

Interview: Andreas Lange (Computerspielemuseum)
Special issue Preserving Play August 2018 21-27 Interview: Andreas Lange (Computerspielemuseum) Conducted by Alison Gazzard and Carl Therrien AG/CT: Can you give us a brief history of the Computerspielemuseum? How did it come to be, what were the major principles guiding its creation, and what challenges have you faced? AL: The initial idea was our belief that computer games have a big cultural impact on us and our society. At the time of the opening in 1997 they often were underestimated as only toys. Our approach was to set up a standard museum. We wanted to put games as a new medium in a traditional museum setting to show everyone that the cultural aspect of games is worthy of our attention. Thus this was our program and part of our name as Computerspielemuseum. From the beginning we received broad and positive feedback, even if the exhibition was quite small and made with modest resources. The founder and current owner of the Computer Games Museum is a non-profit organization called fjs e.V., which ran and still runs several projects on education and youth culture. For example it founded the German age rating system for games (USK) in 1994. The collection only started when we had decided to open a museum. I then went to flea markets and read private announcements in newspapers to buy the first collectibles, which were meant to become our exhibits. At that time, Ebay wasn’t invented yet. After we had opened, people started to offer us donations of their old games, hardware and magazines. -

Emag0404.Pdf
e M A G V ORWORT V o r w o r t Vorwort Der eSport wird salon- fähig, dass sah man an der Games Convention, die vor zwei Wochen stattfand. Neben den diversen Spie- leherstellern glänzte die NGL, ESL und Giga vor allem mit interessanten Events, die sehr professionell darge- boten wurden. Alleine mit der Games Convention hätte man eine einzige Ausgabe füllen können, jedoch haben wir uns auf dass beschränkt, weshalb ihr das Magazin lesen wollt. Unser Hauptaugenmerk lag auf den NGL- Finals und dem Giga-Grandslam, weiterhin findet ihr Informationen zu den anderen eSports-Events auf der Games Convention, wie zum Beispiel dem ersten iFNG der aktuellen Saison #5 und dem eSport-Award. Die letzten Sommermo- nate waren nicht gerade zum sonnen geeignet, jedoch zum zocken. Mit dem CPL-Summerevent gab es ein Turnier der Überraschungen und spannenden Spielen. Gerade bei Counter-Strike hat sich gezeigt, dass Schroet nicht automatisch gewinnt. Aber nicht nur die CPL fand in diesem Sommer statt, sondern auch die ESWC, in welcher gerade in Unreal Tournament die Deutschen sich sehr gut behaupten konnten und mit Burnie den Weltmeis- ter stellen. 1 eMAG - September 2004 V ORWORT e M A G V o r w o r t Abseits der virtuellen Schlachtfelder bieten wir euch Infor- mationen zu der CPL Worldtour und die Wahrheit weshalb kein Event in Deutschland stattfindet, weiterhin ge- hen wir der interessanten Frage nach: „Was passiert wenn Gamer Eltern wer- den?“ Ein Aspekt der zu oft übersehen wird, aber manche der eSportler sind schon in dem Alter eigene Kinder zu bekommen und genau da stellt sich die Frage, wie sie ihre Kinder erzie- hen wollen. -

Tabletop Games Convention Jan. 10-12, 2020 Hilton Bellevue Hotel Map
TABLETOP GAMES CONVENTION JAN. 10-12, 2020 HILTON BELLEVUE HOTEL MAP HILTON BELLEVUE 300 112TH AVENUE SE BELLEVUE, WA, 98004 5th Level 3rd Level Vancouver Panels Freeplay Tables 4th Level Guest Rooms Elevators Quiet Freeplay Quiet Room (402) Bar Front Solarium Desk Kitchen & Bar Chelan Cascades Freeplay Tables Available Boardroom 3 Freeplay Tables 2nd Level Available (part time) Official OrcaCon Skyview Beer on Tap Guest Rooms Workshops Elevators Games on Demand Northwest Play & Win Newcastle D&D Adventurers League Open Overnight 1st Level All Gender Restroom Game Demo Tables King County Games Library Kirkland Merchant Hall Guest Rooms Elevators Food Trucks Bellevue Main Ballroom Redmond Community Row REGISTRATION WELCOME TO ORCACON 2020 We’re excited to offer 24 hour games one we open on Friday and lasting until we close on Sunday. We have QUICK NAVIGATION: special hours for the Merchant Hall and other events, so here’s the hours you need: GET HERE & EAT! Transit Options CONVENTION HOURS: Food Trucks Everything opens on Friday, January 10th at 10:00AM and we close up everything on Sunday, January 12th at 6:00 PM. All Game Rooms will close by Midnight, with the exception of the Redmond Room, which will be open for overnight games. Redmond is on the 1st Floor near Registration. POLICIES REGISTRATION HOURS: Friday – 9 AM to 8 PM Saturday – 9 AM to 7 PM Sunday – 9 AM to Noon GUESTS MERchaNT HALL & COMMUNITY ROW HOURS: Friday – 10 AM to 6 PM Saturday – 10 AM to 6 PM Sunday – 10 AM to 6 PM GAMES Open Play Scheduled Games Play & Win ONLINE SchEDULE: Catan National Championship Qualifier Banned Games MERchaNT HALL Community Row FOLKS WHO MADE ORCACON POSSIBLE Board Staff Sponsors HTTP://ORCACON2020.schED.COM 1 TRANSIT OPTIONS There are bus stops near the Hilton Bellevue (300 112th Avenue SE, Bellevue, WA, 98004). -

Ethical Gaming: Problems and Opportunities Lena Bergholm
Ethical gaming: problems and opportunities Lena Bergholm Degree thesis Online media 2012 Lena Bergholm EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Mediekultur Identifikationsnummer: 3797 Författare: Lena Bergholm Arbetets namn: Handledare (Arcada): Owen Kelly Uppdragsgivare: Sammandrag: I framtiden kommer alla att spela datorspel av något slag. Eftersom det inte finns någon universal lag som kontrollerar spelutveckling så finns det aspekter inom industrin som kan anses vara oetiska. Bör spelutvecklarna handla i sina kunders bästa intressen? Detta arbete förklarar hur online-spelindustrin är byggd kring att generera så mycket pengar som möjligt på bekostnaden av ovetande kunder. För att komma till det som anses vara roligt i ett spel så måste spelaren tillbringa timmar om inte dagar på annat i spelet – allt för att försäkra att spelaren är så länge som möjligt i spelet. Paraleller dras till hasardspelande: även om folk varnas att inte börja med sådant så varnar ingen folk om att inte börja spela vissa online-spel. Det har inte gjorts mycket forskning inom området så för detta arbete fick mycket information tas från Internet. En studie och analys över Activision Blizzards World of Warcraft och ArenaNets nya titel Guild Wars 2 gjordes. Med dem som bas kommer detta arbete förklara problemen som finns i så många online spel i dag, samtidigt som det förklarar hur saker kan kommas att göras i framtiden. Nyckelord: etisk hasardspel spel spelutveckling online warcraft Sidantal: 70 Språk: Engelska Datum för godkännande: DEGREE THESIS Arcada Degree Programme: Online media Identification number: 3797 Author: Title: Supervisor (Arcada): Owen Kelly Commissioned by: Abstract: In the future everyone will be playing video games of some sort.