Die Rothschilds Portrait Einer Familie.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
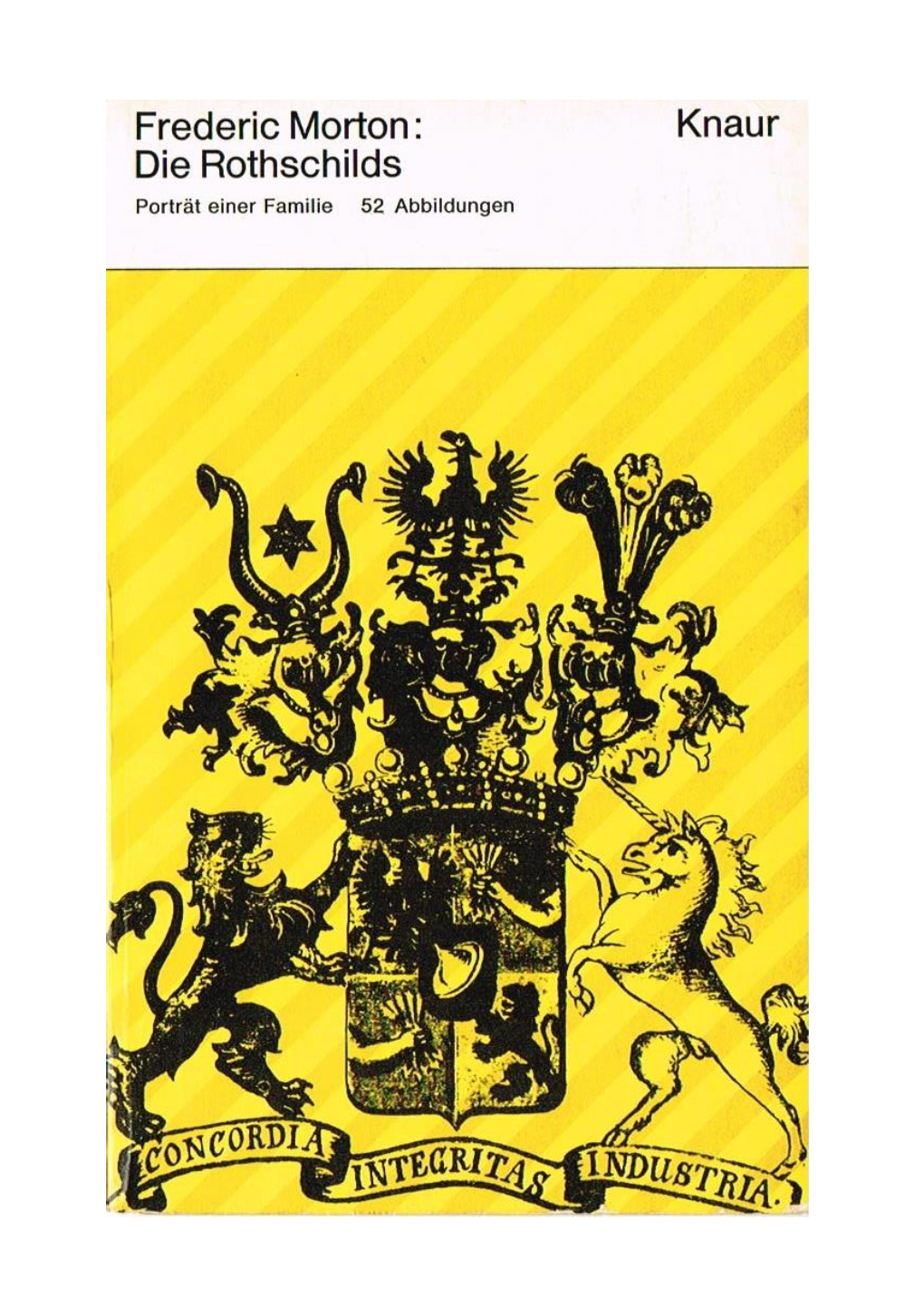
Load more
Recommended publications
-

Descendants of Mayer Amschel Rothschild
Descendants of Hirsch (Hertz) ROTHSCHILD 1 Hirsch (Hertz) ROTHSCHILD d: 1685 . 2 Callmann ROTHSCHILD d: 1707 ....... +Gütle HÖCHST m: 1658 .... 3 Moses Callman BAUER ....... 4 Amschel Moses ROTHSCHILD ............. +Schönche LECHNICH m: 1755 .......... 5 Mayer Amschel ROTHSCHILD b: 23 February 1743/44 in Frankfurt am Main Germany d: 19 September 1812 in Frankfurt am Main Germany ................ +Guetele SCHNAPPER b: 23 August 1753 m: 29 August 1770 in Frankfurt am Main Germany d: 7 May 1849 Father: Mr. Wolf Salomon SCHNAPPER .............. 6 [4] James DE ROTHSCHILD b: 15 May 1792 in Frankfurt am Main Germany d: 15 November 1868 in Paris France .................... +[3] Betty ROTHSCHILD Mother: Ms. Caroline STERN Father: Mr. Salomon ROTHSCHILD ................. 7 [5] Gustave DE ROTHSCHILD b: 1829 d: 1911 .................... 8 [6] Robert Philipe DE ROTHSCHILD b: 19 January 1880 in Paris France d: 23 December 1946 .......................... +[7] Nelly BEER b: 28 September 1886 d: 8 January 1945 Mother: Ms. ? WARSCHAWSKI Father: Mr. Edmond Raphael BEER ....................... 9 [8] Alain James Gustave DE ROTHSCHILD b: 7 January 1910 in Paris France d: 1982 in Paris France ............................. +[9] Mary CHAUVIN DU TREUI ........................... 10 [10] Robert DE ROTHSCHILD b: 1947 .............................. 11 [11] Diane DE ROTHSCHILD .................................... +[12] Anatole MUHLSTEIN d: Abt. 1959 Occupation: Diplomat of Polish Government ................................. 12 [1] Anka MULHSTEIN ...................................... -

Die Beteiligung Jüdischer Ärzte an Der Entwicklung Der Dermatologie Zu Einem Eigenständigen Fach in Frankfurt Am Main
Aus der Klinik und Poliklinik für Dermatologie und Allergologie der Ludwig-Maximilians-Universität München Direktor: Prof. Dr. med. Dr. med. h. c. Thomas Ruzicka Die Beteiligung jüdischer Ärzte an der Entwicklung der Dermatologie zu einem eigenständigen Fach in Frankfurt am Main Dissertation zum Erwerb des Doktorgrades der Zahnheilkunde an der Medizinischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität zu München Vorgelegt von Dr. med. Henry George Richter-Hallgarten aus Schönbrunn 2013 1 Mit Genehmigung der Medizinischen Fakultät der Universität München Berichterstatter: Prof. Dr. med. Rudolf A. Rupec Mitberichterstatter: Prof. Dr. med. Wolfgang G. Locher Prof. Dr. med. Dr. phil. Johannes Ring Prof. Dr. med. Joest Martinius Mitbetreuung durch den promovierten Mitarbeiter: Dekan: Prof. Dr. med. Dr. h.c. M. Reiser, FACR, FRCR Tag der mündlichen Prüfung: 16.10.2013 2 Henry George Richter-Hallgarten Die Geschichte der Dermato-Venerologie in Frankfurt am Main Band 1: Die Vorgeschichte (1800 – 1914) und der Einfluss jüdischer Ärzte auf die Entwicklung der Dermatologie zu einem eigenständigen Fach an der Universität Frankfurt am Main 3 Henry George Richter-Hallgarten Dr. med. Der vorliegenden Publikation liegt die Inauguraldissertation: „Die Beteilig- ung jüdischer Ärzte an der Entwicklung der Dermatologie zu einem eigen- ständigen Fach in Frankfurt am Main“ zur Erlangung des Doktorgrades der Zahnheilkunde an der Medizinischen Fakultät der Ludwig-Maximilians- Universität München zugrunde. 4 Karl Herxheimer Scherenschnitt von Rose Hölscher1 „Die Tragödie macht einer Welt – so abscheulich, daß der eigene Vater, den Dingen ihren Lauf in den Abgrund lassend, sie verleugnete – den Prozeß.“ Alfred Polgar 1 Rose Hölscher: Geboren 1897 in Altkirch, gestorben in den 1970-er Jahren in den USA. -

Table of Contents
Table of contents I. ARE THEY STILL THERE? 1. A Procession at Pauillac 3 2. Chutzpah and Orchids 8 3. A Golden Silence 10 II. JEW STREET 1. Little Orphan Mayer 15 2. A Dreamer in the Ghetto 17 3. Mayer's Serenity 21 4. A Dynasty Aborning 24 III. FIVE FLYING CARPETS 1. The Boys Erupt 28 2. Something Rotten in Denmark 33 IV. ROTHSCHILD VERSUS NAPOLEON 1. Round One: Contraband 37 2. Round Two: A Million-Pound Idea 42 3. Round Three: The Giant Gold Smuggle 45 4. Round Four: The Scoop of Scoops 48 http://www.light1998.com/Rothschilds-Book/Table_of_contents.htm (1 of 3) [11/8/2000 2:11:08 PM] Table of contents 5. Round Five: Conquering the Victors 50 V. THE MISHPOCHE MAGNIFICENT 1. By No Other Name as Great 56 2. The Escutcheon 59 3. The Five Demon Brothers 63 (a) MR. NATHAN 63 (b) BEAU JAMES 70 (c) KING SALOMON 78 (d) CARL, THE MEZZUZAH BARON 89 (e) AMSCHEL OF THE FLOWERS 93 VI. RUNNING EUROPE 1. The Peacemongers 101 2. Short-Term and Long 107 3. The Railway Madness 109 (a) AUSTRIA 109 (b) FRANCE 116 4. Il Est Mort 118 5. The Grandest Larceny Ever 123 6. Monsters' Duel 126 VII. THE MlSHPOCHE JUNIOR 1. lnside Society 142 (a) ANSELM 142 (b) LIONEL AND BROTHERS 144 (c) COUNTRY SQUIRES 152 2. Kings of the Jews 157 3. Storming Parliament 163 4. Three Suns at Noon 170 (a) NATTY 172 (b) SWEET LEO 177 http://www.light1998.com/Rothschilds-Book/Table_of_contents.htm (2 of 3) [11/8/2000 2:11:08 PM] Table of contents (c) THE INCOMPARABLE ALFRED 179 5. -

Waddesdon Manor
waddesdon manor ANNUAL 14 20 15 REVIEW The Lod floor mosaic, late third C.e., Israel antiquities authority. Photo: © Israel antiquities authority / nicky davidov / nicky antiquities authority © Israel Photo: antiquities authority. Israel floor mosaic, late third C.e., Lod The We want Waddesdon to set an ChaIr’s sTaTemenT 5 overvIew AND hIghLIghTs 6 international example of excellence, InsIde 8 reflecting and preserving the best of exhibitions and displays its past while embracing the future Christmas 2014 – Lights and Legends Public events and inspiring audiences of all ages. Bruce munro: snowcode Families, education and schools Programmes Every pound spent through commercial activity supports this ouTsIde 16 gardens fundamental work. aviary art in the garden Public events Bruce munro: winter Light acquisitions 20 academic Programme and specialist outreach 23 The waddesdon archive at windmill hill 26 Looking after and managing our Collections 28 visitor numbers and Information 32 marketing, Pr and social media 34 external validation 36 major Projects 37 volunteers 39 rothschild waddesdon Limited group 40 Waddesdon Manor rwL Key Performance Indicators 42 Near Aylesbury Buckinghamshire HP18 0JH Committees 44 www.waddesdon.org.uk staff Listing 45 ChaIr’s sTaTemenT 5 2014/15 was a year of cultural and operational highlights. welcoming 364,319 to Waddesdon. Whilst this was down From the critical success of our exhibition programme, 7% on the previous year (which saw the highest visitor to new acquisitions by the Rothschild Foundation, the numbers in Waddesdon’s history at 392,000), house introduction of new architectural lighting by Woodroffe visitors were 7% up on the previous year at 157,000 and Bassett, an excellent breeding year for the Aviary, and a our family audience has grown by over 10% due to our successful first full year of the new car park, our aim is expanded programme for families and schools. -

Bangor University DOCTOR of PHILOSOPHY Space Beyond Place
Bangor University DOCTOR OF PHILOSOPHY Space Beyond Place: Welsh Settings in European Fiction, 1900–2010 Les, Christina Award date: 2019 Awarding institution: Bangor University Link to publication General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research. • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ? Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Download date: 27. Sep. 2021 Space Beyond Place: Welsh Settings in European Fiction, 1900–2010 Christina Les PhD Modern Languages Bangor University Christina Les Welsh Settings in European Fiction, 1900–2010 Abstract This thesis examines the way Wales has been portrayed in European fiction between 1900 and 2010. The research process has revealed that, within seemingly disparate texts, Welsh space appears to be more important than Welsh people, and Wales’s physical presence more prominent than its language, history and culture. There is also duality of place and space in these Welsh settings. Wales as a named, known, bordered entity is superficially present, but through this the protagonists gain access to very different, even otherworldly, surroundings. -

Paradise and Plenty: a Rothschild Family Garden Kindle
PARADISE AND PLENTY: A ROTHSCHILD FAMILY GARDEN PDF, EPUB, EBOOK Mary Keen,Tom Hatton,Gregory Long,Lord Rothschild,The Waddesdon Estate | 304 pages | 15 Nov 2015 | The Pimpernel Press | 9781910258125 | English | London, United Kingdom Paradise and Plenty: A Rothschild Family Garden PDF Book While not a practical how-to since the scale is so vast and the garden is well staffed, this title will provide home gardeners with a tip or two as they enjoy the story and photographs of a well-managed estate. Family Maps of Daviess County, Indiana. Family Maps of Barron County, Wisconsin. This perfect book is not cheap, but it should feature prominently on every gardener's Christmas wish list. Fiction Books in English Carolyn Keene. Friend Reviews. Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. Description The productive garden at Lord Rothschild's private house, Eythrope in Buckinghamshire, is legendary in the garden world for the excellence of the gardening and as a haven for traditional techniques that might otherwise be lost. Gregory Long of the New York Botanic Garden points out in his introduction to the book that as more and more people turn to growing their own, books are needed that show the techniques of dedicated cultivation, as well as the results. Society Blog. Preview — Paradise and Plenty by Mary Keen. Isabel and Julian Bannerman have been described as "mavericks in the grand manner, touched by About Mary Keen. For twenty years she was a member of the National Trust Gardens Panel, which advises on the care of important and historic gardens. -

Principal Acquisitions 1 April 2000-31 March 2001 This List Is Not Comprehensive but Attempts to Record All Acquisitions of Most Immediate Relevance to Research
508964AR.CHI 8/23/02 12:19 PM Page 30 Principal Acquisitions 1 April 2000-31 March 2001 This list is not comprehensive but attempts to record all acquisitions of most immediate relevance to research. Some items listed here may, however, remain closed to access for some time and for a variety of reasons. Researchers should always enquire as to the availability of specific items before visiting the Archive, quoting the reference number which appears at the end of each paragraph Family papers collected by Nathaniel Mayer (Natty), 1st Lord Rothschild (1840-1915), his wife Emma Louisa and their descendants, including: sale particulars and correspondence re the purchase of the Gunnersbury estate by Nathan Mayer Rothschild (1777-1836); letters from Charlotte de Rothschild (1819-1884) to her husband Lionel (1808-1879); correspondence from Hannah Rothschild (née Cohen, 1783-1850), and her children to her husband Nathan Mayer, 1824-25; letters from Evelyn (1886- 1917) and Anthony de Rothschild (1887-1961) and other serving officers, 1915; collections of bills and returns relating to the Rothschild property at 148 Piccadilly; lists, notes and valuations of works of art at Tring Park and 148 Piccadilly; correspondence addressed to Lionel de Rothschild (1808-1879) from various political figures; letters of condolence addressed to Nathaniel Mayer on the death of his father, Lionel, in 1879; letters to Nathaniel Mayer, 1st Lord Rothschild, from staff of The Times and from George V and Queen Alexandra re the paper’s Red Cross appeal, 1915; letters to -

Ekonomski Vpliv Rodbine Rothschild
UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO EKONOMSKI VPLIV RODBINE ROTHSCHILD Ljubljana, maj 2010 ALEŠ RECEK IZJAVA Študent/ka ________________________________ izjavljam, da sem avtor/ica tega diplomskega dela, ki sem ga napisal/a pod mentorstvom ________________________ , in da dovolim njegovo objavo na fakultetnih spletnih straneh. V Ljubljani, dne____________________ Podpis: _______________________________ KAZALO UVOD ........................................................................................................................................ 1 1 PREDSTAVITEV RODBINE ROTHSCHILD.................................................................. 2 1.1 VIDNI PREDSTAVNIKI RODBINE ROTHSCHILD NEKOČ IN DANES................. 5 1.1.1 Mayer Amschel (Bauer) Rothschild.......................................................................... 5 1.1.2 Nathan Mayer Rothschild.......................................................................................... 7 1.1.3 David René de Rothschild......................................................................................... 8 1.2 RODBINA ROTHSCHILD SKOZI ČAS........................................................................ 9 1.2.1 Doba od 1798 do 1820 – začetki rodbine Rothschild ............................................... 9 1.2.1.1 Frankfurtska podružnica..................................................................................... 9 1.2.1.2 Londonska podružnica ...................................................................................... -

Le Salon Musical De La Famille Rothschild : Autour Du Legs De Charlotte De Rothschild À La Bibliothèque Du Conservatoire
Pauline Prevost-Marcilhacy, Laura de Fuccia et Juliette Trey (dir.) De la sphère privée à la sphère publique Les collections Rothschild dans les institutions publiques françaises Publications de l’Institut national d’histoire de l’art Le salon musical de la famille Rothschild : autour du legs de Charlotte de Rothschild à la bibliothèque du Conservatoire Rosalba Agresta DOI : 10.4000/books.inha.11351 Éditeur : Publications de l’Institut national d’histoire de l’art Lieu d'édition : Paris Année d'édition : 2019 Date de mise en ligne : 4 décembre 2019 Collection : Actes de colloques ISBN électronique : 9782917902875 http://books.openedition.org Référence électronique AGRESTA, Rosalba. Le salon musical de la famille Rothschild : autour du legs de Charlotte de Rothschild à la bibliothèque du Conservatoire In : De la sphère privée à la sphère publique : Les collections Rothschild dans les institutions publiques françaises [en ligne]. Paris : Publications de l’Institut national d’histoire de l’art, 2019 (généré le 18 décembre 2020). Disponible sur Internet : <http://books.openedition.org/inha/ 11351>. ISBN : 9782917902875. DOI : https://doi.org/10.4000/books.inha.11351. Ce document a été généré automatiquement le 18 décembre 2020. Le salon musical de la famille Rothschild : autour du legs de Charlotte de Ro... 1 Le salon musical de la famille Rothschild : autour du legs de Charlotte de Rothschild à la bibliothèque du Conservatoire Rosalba Agresta 1 Au XIXe siècle, la musique fait partie des arts que cultivent les gens de goût. Partageant un caractère à la fois artistique et mondain, elle est en effet, à cette époque, un critère de distinction et de culture. -

The English Trade in Nightingales Ingeborg Zechner
The English Trade in Nightingales Italian Opera in Nineteenth-Century London Ingeborg Zechner Translated from the German by Rosie Ward Published with the support from the Austrian Science Fund (FWF):PUB 390-G26 Open access: Except where otherwise noted, this work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 Unported License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Deutsche Nationalbibliothek Cataloging-in-publication data: http://dnb.d-nb.de © 2017 by Böhlau Verlag GmbH & Co. KG, Wien Köln Weimar Wiesingerstraße 1, A-1010 Wien, www.boehlau-verlag.com Translation: Rosie Ward Cover design: Michael Haderer, Wien Layout: Bettina Waringer, Wien Printing and binding: Prime Rate, Budapest Printed on acid-free and chlorine-free bleached paper Printed in the EU ISBN 978-3-205-20554-8 Acknowledgements I would like to thank all those who have enabled and supported the writing of this book, which originated as a PhD dissertation completed at the University of Graz in 2014 and was published as a German monograph by Böhlau Verlag in Vienna in 2017. I therefore owe the deepest gratitude to Rosie Ward, who undertook the translation of the German version with impressive thoroughness and professionalism. In the earlier stages, a John M. Ward Fellowship from Harvard University’s Houghton Library enabled me to access essential sources. I am equally indebted to the ever-helpful Antonella Imolesi of the Biblioteca Forlì, particularly for allowing me to reproduce archival materials. I thank Gabriella Dideriksen, Jennifer Hall-Witt, Roger Parker, Curtis Price and Sven Oliver Müller for their advice and their readiness to share their research experience. -

Jewish Hospitals in Frankfurt Am Main (1829 – 1942)
Jewish Hospitals in Frankfurt am Main (1829 – 1942) For the care of the patients, for the edification of the parish, for the good of the city of our fathers” The opening of Frankfurt´s Jewish Ghetto (1462 – 1796) and the granting of the long sought-for status as citizens (“isaelitische Bürger”) on 1st September 1824 (Heuberger/Krohn 1988, page 37) created the framework for the resolution of the cramped and outdated hospital system of the Ghetto time. Finally Frankfurt´s two Jewish communities – the Jewish community with a liberal majority and the smaller conservative Jewish religious community – could then establish a modern medical and care system. Both Jewish-religious (with their own synagogues and kosher cooking) and inter- denominational oriented hospitals and nursing homes emerged; even the conservative-Jewish institutions admitted non-Jews in accordance with the Bikkur-Cholim-provisions. As early as 1829, a few decades prior to the establishment of equality of Frankfurt´s Jewish population on 8th October, 1864, the “Hospital of the Jewish Health Insurances ” opened its doors at Rechneigrabenstrasse 28 – 20 (next to the “Neuer Börneplatz” memorial). The Rothschild banker family had the double building erected: “The barons Amschel, Salomon, Nathan, Carl, Jacob von Rothschild put up this house in accordance with the wishes of their immortalized father [Mayer Amschel Rothschild, d.V.); “for the care of the patients, for the edification of the parish, for the good of the city of our fathers”; a monument of filial reverence and fraternal unity” (quotation by Arnsberg 1983, book volume 2, page 123). The hospital emerged from the two Jewish insurance companies for men (established in 1738 and 1758) and the Jewish health insurance for women (established in 1761) of Frankfurt´s Jewish Ghetto. -
Rothschild Family - Wikipedia
2/29/2020 Rothschild family - Wikipedia Rothschild family The Rothschild family (/ˈrɒθstʃaɪld/) is a wealthy Jewish Rothschild family originally from Frankfurt that rose to prominence with Mayer Amschel Rothschild (1744–1812), a court factor to the Jewish noble banking family German Landgraves of Hesse-Kassel in the Free City of Frankfurt, Holy Roman Empire, who established his banking business in the 1760s.[2] Unlike most previous court factors, Rothschild managed to bequeath his wealth and established an international banking family through his five sons,[3] who established themselves in London, Paris, Frankfurt, Vienna, and Naples. The family was elevated to noble rank in the Holy Roman Empire and the United Kingdom.[4][5] The family's documented history starts in 16th century Frankfurt; its name is derived from the family house, Coat of arms granted to the Barons Rothschild, built by Isaak Elchanan Bacharach in Frankfurt in Rothschild in 1822 by Emperor 1567. Francis I of Austria During the 19th century, the Rothschild family possessed the Current Western Europe largest private fortune in the world, as well as in modern world region (mainly United history.[6][7][8] The family's wealth declined over the 20th Kingdom, France, and century, and was divided among many various descendants.[9] Germany)[1] Today their interests cover a diverse range of fields, including Etymology Rothschild (German): financial services, real estate, mining, energy, mixed farming, "red shield" winemaking and nonprofits.[10][11] This article is illustrated Place of Frankfurter throughout with their buildings, which adorn landscapes across origin Judengasse, Frankfurt, northwestern Europe. Holy Roman Empire The Rothschild family has frequently been the subject of Founded 1760s (1577) [12] conspiracy theories, many of which have antisemitic origins.