Hoffmann, Emil Krebs
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
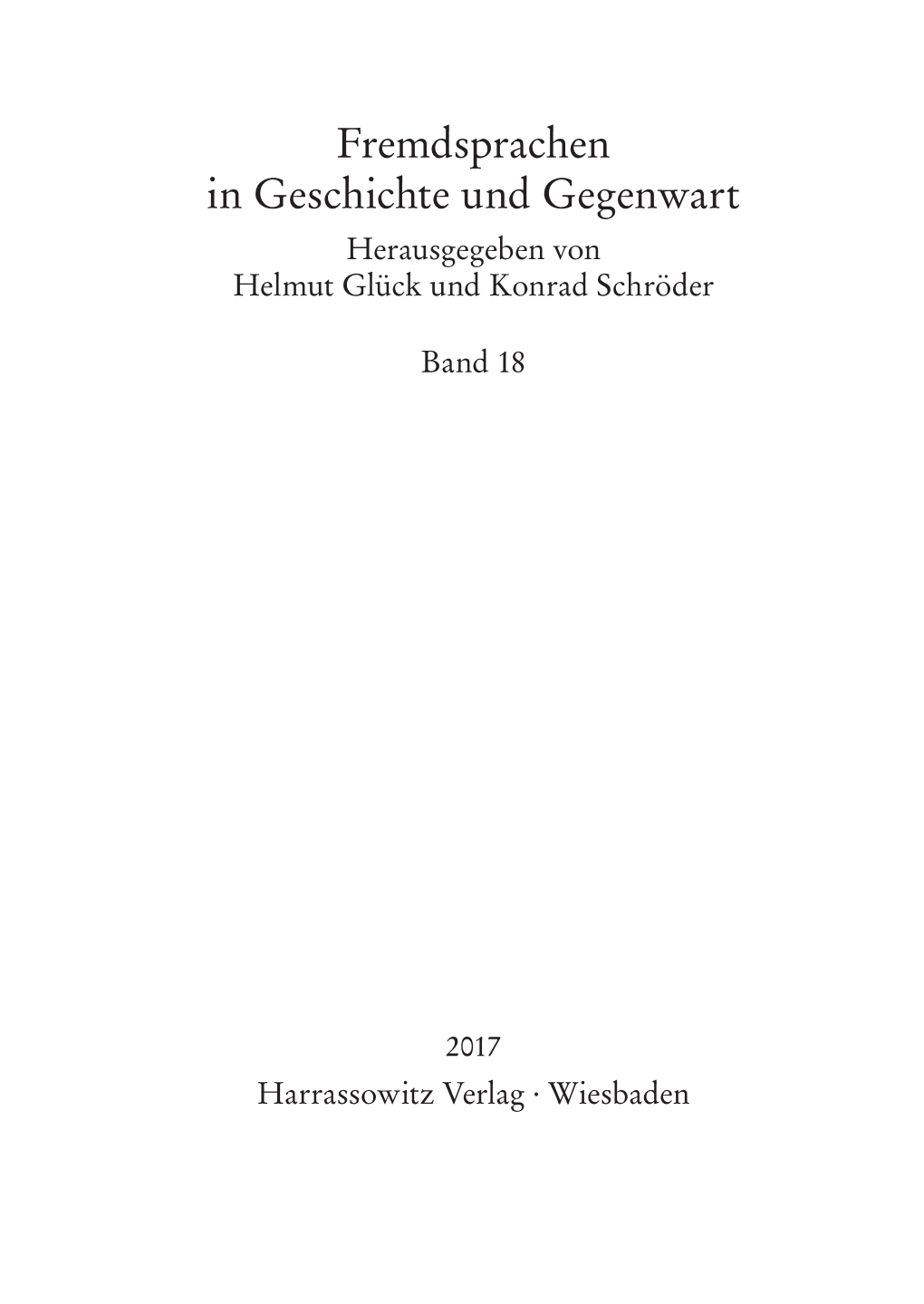
Load more
Recommended publications
-

Sebastian Heine. *
Dr. phil. Hussein Habasch, www.habasch.de, www.drhabasch.wordpress.com [email protected]. Fünfundsechzig Sprachen mit siebenundzwanzig Jahre Ein Gespräch mit dem Sprachwissenschaftler, das Genie Sebastian Heine. * 1. In der Schule als Du fünfzehn Jahre alt warst entdecktest du, dass die griechische Sprache eng mit der Sanskrit verwandt ist, wie geschah das? Mein Vater war von Hause aus Historiker und besaß eine umfangreiche Bibliothek, in der sich auch eine sprachwissenschaftliche Abteilung mit Schwerpunkt auf die indogermanischen Sprachen befand. Mein Vater machte mich nicht nur früh mit der Welt der Geschichte und der abendländischen Kultur (Musik, Kunst, Literatur) vertraut sondern weckte in mir ein besonderes Interesse an den Sprachen. Um die Geschichte verstehen zu können, so mein Vater, bedarf es des Quellenstudiums, und dies wiederum verlanget eine sehr gute philologische Ausbildung um die Quellen auch in ihrer jeweiligen Sprache studieren zu können. So ging mein Studium des Lateinischen und später des Griechischen mit einer Beschäftigung mit den Grundlagen der Indogermanistik. Die Kenntnis des linguistischen Vergleichs im Bereich der Phonologie und Morphologie ermöglichte mir die genetische Sprachverwandtschaft der beiden grundlegenden Sprachen für das Verständnis der okzidentalen Kultur, des Lateinischen und Griechischen zu verstehen, und dies in ihren entscheidenden texten, wie etwa der Ilias des Homer aus dem 8 Jh. v.chr. der erste überlieferte Text der europäischen Geistesgeschichte. In dieser Zeit empfahl mir mein Vater auch das Sanskrit mit in meine Studien einzubeziehen. Er kaufte mir die klassische Studiengrammtik des Sanskrits von dem deutschen Indologen Stenzler. Somit begann ausgehende vom Sanskrit im Alter von 15 Jahren meine geistesgeschichtliche und linguistische Reise durch den- hier rein geographisch zu verstehenden – Orient. -

The Contemporary China Collection in the Asian Division the Library of Congress
Journal of East Asian Libraries Volume 2007 Number 141 Article 6 2-1-2007 The Contemporary China Collection in the Asian Division the Library of Congress Judy S. Lu Follow this and additional works at: https://scholarsarchive.byu.edu/jeal BYU ScholarsArchive Citation Lu, Judy S. (2007) "The Contemporary China Collection in the Asian Division the Library of Congress," Journal of East Asian Libraries: Vol. 2007 : No. 141 , Article 6. Available at: https://scholarsarchive.byu.edu/jeal/vol2007/iss141/6 This Article is brought to you for free and open access by the Journals at BYU ScholarsArchive. It has been accepted for inclusion in Journal of East Asian Libraries by an authorized editor of BYU ScholarsArchive. For more information, please contact [email protected], [email protected]. Journal of East Asian Libraries, No. 141, February 2007 THE CONTEMPORARY CHINA COLLECTION IN THE ASIAN DIVISION THE LIBRARY OF CONGRESS Judy S. Lu Head, Collection Services, Asian Division, Library of Congress Beginning of the Chinese Collection in the Library of Congress In June 1869 the Library of Congress (LC) received a donation of 10 works in 905 volumes of Chinese traditional stitch-bound books from the Tongzhi Emperor (同治皇帝) of China. This donation marked the beginning of the Library’s Chinese Collection. In 1879, the Library acquired the personal library of 2,547 volumes on classical literature, politics, law, and medicine of Caleb Cushing (顾盛)1, the first U.S. minister to China who led negotiations resulting in the first treaty (Wangxia Treaty 望厦条约) between the United States and China in 1844. -

Shadow Theaters of the World
Fa n P e n C h e n State University o f New Yor\ Shadow Theaters of the World Abstract This paper examines the origin of the shadow theaters of the world including those of India, Indonesia, Southeast Asia, Egypt, Turkey, China, and Europe, and the relation ships among the various traditions. Theories which have been advanced are discussed and analyzed, along with suggestions of other possibilities. Although all the shadow the ater traditions of the world are highly distinctive, many links and influences have existed among them. This study suggests that the shadow theater may have originated in either Central Asia or India. The Euro-Asian steppe and the seas between Africa, Asia and Southeast Asia may have served as avenues that linked disparate shadow traditions, and some influences were probably not unidirectional. The paper also refutes numerous the ories concerning the relationship between Chinese Shadows and those of the rest of the world. Keywords: Shadow theater— shadow puppets— wayang~Karagoz— Chinese Shadows— Ombres Chinoises— nang yai— nang sebe\—nang talung. Asian Folklore Studies, Volume 62,2003: 25—64 CHOLARS STUDYING VARIOUS shadow theater traditions of the world have advanced theories concerning origins and influences within specific Sregions, but a comprehensive study has never been done. The origin of the shadow theater, the relationships among the various traditions——their relationship to the Chinese shadow theater in particular——have intrigued me since I began working on traditional Chinese Shadows.1 While a con clusive study of this topic does not seem possible, I would like to present available theories and evidence concerning the origin of the shadow theater, and discuss some possible routes of influence. -

Hier Der Großneffe Von Emil Krebs Sich Seinem Vorfahren Kritisch Nähert Und Ihn Einer Breiten Öffentlichkeit in All Seinen Facetten Präsentiert
39 Mottini, Roger Die Schweiz und Japan während der Meiji-Zeit (1868–1912): Begegnungen, Berichterstattung und Bilder, Diss., Bamberg 1998 Netto, Curt Papierschmetterlinge aus Japan, Leipzig 1888 Schaffers, Uta Konstruktion der Fremde: Erfahren, verschriftlichen und erlesen am Beispiel Japans, Berlin 2006 Buchbesprechung Eckhard Hoffmann: Emil Krebs: Ein Sprachgenie im Dienste der Diplomatie (Fremdsprachen in Geschichte und Gegenwart, Band 18), Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, 2017; 212 Seiten, Abb., 54 Euro ISBN-13: 978-3447107402 Im Folgenden ist von jemandem die Rede, der schon zu Lebzeiten als ausgesproche- nes Sprachwunder galt und für das Erlernen von Fremdsprachen offenbar eine ange- borene Disposition mitbrachte. Gemeint ist der aus Niederschlesien stammende Emil Krebs (1867-1930), der vor allem als langjähriger Dolmetscher an der Kaiserlichen Ge- sandtschaft Peking bzw. in der Kolonialverwaltung Kiautschous (1893-1917) über die deutschsprachigen Grenzen hinausgehende philologische Meriten errang. Krebs ist vielleicht eines der wenigen real existierenden Exemplare jener Spezies, die als beson- ders kompetent in der Beherrschung „exotischer“ Sprachen galt – von europäischen Sprachen ganz zu schweigen – und bei denen Sprachfähigkeit und -beherrschung weit über Höflichkeitsfloskeln und gutgemeinte subjektive Einschätzungen Dritter hinaus- gingen. 12/2018 40 Der Reiz der neuen wissenschaftlichen Abhandlung1 über das Sprachgenie liegt neben der Ausbreitung bislang unbekannten biographischen Materials vor allem darin, dass hier der Großneffe -

Cognitive Consequences of Trilingualism and Explain Them Relative to the Cognitive Consequences of Bilingualism
IJB0010.1177/1367006916637288International Journal of BilingualismSchroeder and Marian 637288research-article2016 Article International Journal of Bilingualism 1 –20 Cognitive consequences © The Author(s) 2016 Reprints and permissions: of trilingualism sagepub.co.uk/journalsPermissions.nav DOI: 10.1177/1367006916637288 Ijb.sagepub.com Scott R Schroeder Department of Communication Sciences and Disorders, Northwestern University, IL, USA Viorica Marian Department of Communication Sciences and Disorders, Northwestern University, IL, USA Abstract Aims and objectives: The objectives of the present research were to examine the cognitive consequences of trilingualism and explain them relative to the cognitive consequences of bilingualism. Approach: A comparison of cognitive abilities in trilinguals and bilinguals was conducted. In addition, we proposed a cognitive plasticity framework to account for cognitive differences and similarities between trilinguals and bilinguals. Data and analysis: Three aspects of cognition were analyzed: (1) cognitive reserve in older adults, as measured by age of onset of Alzheimer’s disease and mild cognitive impairment; (2) inhibitory control in children and younger adults, as measured by response times on behavioral Simon and flanker tasks; and (3) memory generalization in infants and toddlers, as measured by accuracy on behavioral deferred imitation tasks. Results were considered within a framework of cognitive plasticity, which took into account several factors that may affect plasticity including the age of learning a third language and the extent to which additional cognitive resources are needed to learn the third language. Findings: A mixed pattern of results was observed. In some cases, such as cognitive reserve in older adults, trilinguals showed larger advantages than did bilinguals. On other measures, for example inhibitory control in children and younger adults, trilinguals were found to exhibit the same advantages as bilinguals. -

Ausgabe 4 „Sonderausgabe“ (06/2021)
Grenzfluss Neiße am Internationalen Begegnungszentrum St. Marienthal. Foto: Aureliusz Marek Pędziwol 2 1 Inhaltsverzeichnis / Spis treści GELEITWORT / OD REDAKCJI / Gunnar Hille 4 GRUßWORT / SŁOWO WSTĘPNE 7 Staatsministerin der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung des Freistaates Sachsen Minister Sprawiedliwości oraz ds. Demokracji, Europy i Równości Wolnego Kraju Saksonii / Katja Meier MANIFEST 14 Polnische Sprache in Deutschland im Lichte europäischer Mehrsprachigkeitspolitik Język polski w Niemczech w świetle europejskiej polityki wielojęzyczności / Waldemar Martyniuk POLNISCH IN DEUTSCHLAND IN GESCHICHTE UND GEGENWART 20 JĘZYK POLSKI W NIEMCZECH DAWNIEJ I DZIŚ Polnischunterricht in den deutschen Landen vom 16. Jh. bis 1990. Eine kulturhistorische Untersuchung / Nauczanie języka polskiego na ziemiach niemieckich od XVI wieku do 1990 roku. Studium historyczno-kulturowe / Przemysław Chojnowski / / / Wie lernte Emil Krebs Polnisch? / Jak Emil Krebs uczył się języka polskiego? / Eckhard Hoffmann 42 / / / Polnisch als Herkunfts- und Fremdsprache in Deutschland 1991−2021 47 Język polski jako język pochodzenia i język obcy w Niemczech 1991–2021 / Magdalena Telus / / / Polnisches Leben und polnische Sprache im deutschen Alltag − Transnationale Realität 63 am Beispiel von Görlitz/Zgorzelec / Życie po polsku i język polski w niemieckiej codzienności – rzeczywistość transgraniczna na przykładzie Görlitz/Zgorzelca / Christin Stupka POLNISCH IN LEHRE UND FORSCHUNG / POLSKI W DYDAKTYCE I NAUCE 76 Unterrichtsmaterialien für Polnisch -

Neurology of Foreign Language Aptitude
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Studies in Second Language Learning and Teaching Studies in Second Language Learning and Teaching Department of English Studies, Faculty of Pedagogy and Fine Arts, Adam Mickiewicz University, Kalisz SSLLT 5 (1). 2015. 13-40 doi: 10.14746/ssllt.2015.5.1.2 http://www.ssllt.amu.edu.pl Neurology of foreign language aptitude Adriana Biedroń Pomeranian University, Słupsk, Poland [email protected] Abstract This state-of-the art paper focuses on the poorly explored issue of foreign language aptitude, attempting to present the latest developments in this field and reconcep- tualizations of the construct from the perspective of neuroscience. In accordance with this goal, it first discusses general directions in neurolinguistic research on for- eign language aptitude, starting with the earliest attempts to define the neurological substrate for talent, sources of difficulties in the neurolinguistic research on foreign language aptitude and modern research methods. This is followed by the discussion of the research on the phonology of foreign language aptitude with emphasis on functional and structural studies as well as their consequences for the knowledge of the concept. The subsequent section presents the studies which focus on lexical and morphosyntactic aspects of foreign language aptitude. The paper ends with a dis- cussion of the limitations of contemporary research, the future directions of such research and selected methodological issues. Keywords: foreign language aptitude, neurology, neurolinguistics, individual differences 1. Introduction In the research on individual differences, foreign language aptitude (FL aptitude) has recently become one of the most often debated topics among scholars not 13 Adriana Biedroń only in the field of SLA and language education but also neurolinguistics. -

Life with More Than One Language
CHAPTER 7 LIFE WITH MORE THAN ONE LANGUAGE BILINGUAL CHILDREN LEARNING SECOND LANGUAGES How Do Bilingual Children Differ From What Teaching Methods Are Used in Language Monolingual Children? Classes? Language Milestones Do All Countries Have Bilingual Education? Perceptual Abilities How Does First Language Influence Second Vocabulary Size Language Acquisition? Language Mixing Text Box 7.2. Extraordinary Individuals: Code-Switching Emil Krebs: An Extraordinary Polyglot Text Box 7.1. Diversity of Human Languages: LIFE WITH TWO OR MORE LANGUAGES Pidgins and Creoles What Factors Predict Proficiency? Are There Cognitive Benefits When Children Text Box 7.3. Research Discovery: Bilingual Are Bilingual? Problem Solving Attentional Processing How Are Multiple Languages Stored in Language Skills Memory? What Brain Changes Are Associated With Can One Forget One’s First Language? Bilingualism? SUMMARY AND THEORETICAL IMPLICATIONS In some parts of the world, such as the United States, there is the misperception that knowing only one language, or monolingualism, is the norm. In fact, it is common to know more than one language. Approximately half of the world’s population use more than one language in their daily life. Even in the United States, 55% of those surveyed for the 2000 census reported being proficient in English and using a language other than English at home (U.S. Census Bureau, 177 178 INTRODUCTION TO LANGUAGE DEVELOPMENT 2000). In the United States, it is expected that the number of bilinguals will con- tinue to rise in the coming decades. The term bilingualism is used to describe cases in which one knows more than one language. The term mul- tilingualism is used to describe cases in which one knows more than two lan- guages. -

French-English Bilingualism As a Determinant of Learners’ General Language Competence in Some Selected Secondary Schools in Ibadan
Journal of Literature, Languages and Linguistics www.iiste.org ISSN 2422-8435 An International Peer-reviewed Journal Vol.13, 2015 FRENCH-ENGLISH BILINGUALISM AS A DETERMINANT OF LEARNERS’ GENERAL LANGUAGE COMPETENCE IN SOME SELECTED SECONDARY SCHOOLS IN IBADAN ARAROMI M. O. PhD DEPARTMENT OF TEACHER EDUCATION FACULTY OF EDUCATION UNIVERSITY OF IBADAN IBADAN AKINSOLA N.A DEPARTMENT OF TEACHER EDUCATION FACULTY OF EDUCATION UNIVERSITY OF IBADAN IBADAN. Abstract The poor performance in English and French language has called for concern among stakeholders in the field of language education in Nigeria. While students recorded low performance in English across the years, there is low turn- out of students in French language. Researchers have looked into the viability of bilingualism in English and French as a symbiotic measure to finding lasting solution to the problem of general language deficiency among Nigerian learners’ of English and French language respectively. Therefore, this study sought to investigate the complimentary role of English and French language in the attainment of general language competence of some bilingual students in Ibadan, Oyo state. Purposive sampling technique was used to select 156 students in four junior secondary schools in Ibadan. Three research questions were raised. Two instruments were used to collect data i.e. ELAT and FLAT. The result shows that there was significant difference in the bilingualism in French and English language among the selected students in the secondary school in Ibadan (t = 7.922, df = 155, P<0.05). There was no Gender difference in the attainment of Bilingualism in English and French from the selected secondary schools. -

Volhynian German Baptists in St. Paul Minnesota
On the cover: Certificates of death can be requested by immediate descendants of a citizen of the former Soviet Union from the regional ZAGS (Bureau of Registry of Civilian Acts) in which the person lived/died. This death certificate is for David Andreyevich Fischer, father of Friedrich Davidovich, whose story is found pages 1-4. A translation of the certificate reads as follows: CERTIFICATE OF DEATH Citizen Fischer David Andreyevich died on 10 November 1937 [in letters and figures] at the age of 66 according to the registry book of deaths, [Extract #12 made] 26 September 1990. Cause of death: shot Place of death: Engels Region: Engels Oblast/krai: Saratov Republic: Russian S.F.S.R. Place of registration: Marxstadt, bureau of ZAGS Saratov Oblast Date of issuance: 26 September 1990 Signed and sealed by bureau director III RU No. 368618 Published by American Historical Society of Germans From Russia 631 D Street • Lincoln, Nebraska 68502-1199 • Phone 402-474 -3363 Edited by Jo Ann Kuhr ©Copyright 1992 by the American Historical Society of Germans From Russia. AH rights reserved. 1SSN 0162-8283 The Society does not assume responsibility for statements made by its contributors. CONTENTS UNFORGETTABLE ENCOUNTERS ............................................................................................................................... 1 Nikolai V. Titov Translated by Elena Petrovna Mikhailova and Lawrence A. Weigel EVERYTHING IS DIFFERENT ..................................................................................................................................... -

Hubert Haider – Wie Viele Sprachen Passen in Ein Menschliches Hirn?
11.03.2015 H. Simpson *May 12, 1955 Hubert Haider – Wie viele Sprachen passen in ein menschliches Hirn? 1 11.03.2015 Wo hört polyglott auf und beginnt hyper-polyglott? Richard Hudson: 6 Sprachen schafft fast jeder, wenn er die Gelegenheit dazu bekommt Michael Erard: 6-12 Sprachen ist die ‚Grauzone‘ zwischen polyglott und hyper-poly- glott Darüber: über 12: definitiv von ‚einem ande- ren Stern‘ d.h. mit einem etwas anderen Hirn als unsereiner eines mitbekommen hat. Maximum? 12 Wochen pro Sprache + Recycling (4 p.a. x 50 200) 2012 Free Press (Simon & Schuster) N.Y. / London / Sydney 2 11.03.2015 Sprachliche Hochbegabung – Linguistische Aspekte Wie kann man (sprachliche) Hochbegabung eingrenzen? Evidenzbasierte Lern- & Lehrforschung In statistics, the 68 – 95 – 99.7 rule, also known as the three-sigma rule or empirical rule, states that nearly all values lie within three standard deviations of the mean in a normal distribution. 68.27% of the values lie within one standard deviation of the mean. Similarly, 95.45% of the values lie within two standard deviations of the mean. Nearly all (99.73%) of the values lie within three standard deviations of the mean. http://en.wikipedia.org/wiki/68%E2%80%9395%E2%80%9399.7_rule 6 3 11.03.2015 Mehrsprachigkeit als ‚Fluch’? – Gab es auch! Der Keltologe Leo Weisgerber (1899–1985) schrieb allen Ernstes noch 1966, dass „der Mensch im Grunde einsprachig angelegt ist (...), dass die geistige Anverwandlung der Welt die Geschlossenheit einer Muttersprache erfordert (so wie man auch nicht erwartet, dass jemand in zwei Religionen lebt) und dass mit dem Zusammen- treffen der für erfüllte Zweisprachigkeit nötigen Vorbedingun- gen nie in dichter Häufigkeit zu rechnen ist.“ Christopher Hutton (1998) „Mother-Tongue Fascism “ Hinweis: Weisgeber war ab 1934 Mitglied der NSDAP. -

Germanistyka Otwarta. Wrocławskie Debaty O Języku I Językoznawstwie
Germanistyka otwarta Wrocławskie debaty o języku i językoznawstwie debaty Wrocławskie Germanistyka otwarta Wrocławskie debaty o języku i językoznawstwie Redakcja Artur Tworek ISBN 978-83-949771-3-9 ISBN 978-83-65815-22-4 Germanistyka otwarta Germanistyka otwarta Wrocławskie debaty o języku i językoznawstwie Redakcja Artur Tworek Wrocław 2019 Recenzenci prof. Danuta Rytel-Schwarz (Uniwersytet w Lipsku): rozdziały 1, 2, 3, 4 prof. Iwona Bartoszewicz (Uniwersytet Wrocławski): rozdziały 1, 4 prof. Maria Katarzyna Lasatowicz (Uniwersytet Opolski): rozdziały 2, 3 Korekta Lucyna Jachym Fotografie na okładce Rafał Jakiel Niniejsza publikacja powstała dzięki finansowemu wsparciu Dyrekcji Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego © Copyright by Authors; Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Germańskiej; Quaestio, Wrocław 2019 ISBN 978-83-949771-4-6 ISBN 978-83-65815-36-1 Uniwersytet Wrocławski Wydział Filologiczny Instytut Filologii Germańskiej pl. Nankiera 15b, 50-140 Wrocław Quaestio www.quaestio.com.pl tel. (48) 784 614 124, [email protected] Spis treści Słowo wstępne ........................................................... 9 Teoria i praktyka dyskursu Zofia Bilut-Homplewicz Jak rozumieć dyskurs w germanistycznej lingwistyce dyskursu? .............13 Anna Dutka-Mańkowska Tekst we współczesnej francuskiej analizie dyskursu ........................27 Agata Rębkowska O potrzebie dyskusji. Triangulacja metodologiczna w analizie dyskursu ......41 Marcela Świątkowska Francuska szkoła analizy dyskursu: