Festvortrag: Ohne Pracht, Ohne Macht?
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Francesca Rogier
The Other Parliam ent in th e Francesca Rogier 07 When the Reichstag, seat of the German parliament Fig. 1 Aerial view of the Palast and the surrounding area. The 190 m from 1889 to 1933, was re-dedicated as the new home long building, placed 180' to the for- mer palace footprint, marks a of the Bundestag last April, another parliament build- sequence of open spaces moving ing gazed vacantly from the foot of Unter east from Marx-Engels-Platz at the westward foot of Unter den Linden to the Marx- Engels-Forum, the 1 969 TV tower, den Linden. The Pa/ost (^er Re^wfaZ/fc, the monolith overlooking and Alexanderplatz. Wrapped in a Marx-Engels-Platz in the heart of Berlin that once housed the East marble base, the Palast's rear eleva- German Volkskammer, might as well have been worlds away, so tion makes contact with the Spree in a lateral walkway and boat landing, insignificant was its presence in the public's consciousness. But at pre- directly engaging the island site in a cisely that moment, a shift have taken place that could lead to a may manner unusual for modernist build- new perception and possible re-use of the forgotten parliament, just as mgs. Although plans for Marx- it could engender a new definition of German identity. Engels-Platz never progressed past the stage of parking lot, it has proven to be an excellent outdoor The greatest moment for the Palast der Republik came in August 1990, space for carnivals, performance art, when the first freely-elected representatives of the Volkskammer, a body volleyball matches, attracting large crowds - the kind of public previously subjugated to the central committee, voted for German unifi- entertain- ments so often promoted today in cation. -

Und Informations-Dialog 2018 Baumaßnahmen Im Netz Der Berliner S-Bahn 2018 - 2020
2. Bau- und Informations-Dialog 2018 Baumaßnahmen im Netz der Berliner S-Bahn 2018 - 2020 DB Netz AG | I.NP-O-D-BLN(BS) + I.NM-O-F(S) | Berlin | 17.07.2018 Übersicht Regionalbereich Ost – Netz Berliner S-Bahn Bauschwerpunkte 2018 Ersatzneubau SÜ Rhinstraße + ESTW+ZBS S7 Ost SEV Lichtenberg–Springpfuhl/ Wuhletal Wochenenden April bis Juni + Dezember 2018 Brückenarbeiten S2 Nord + Neubau SÜ BAB114 SEV Lichtenberg–Ahrensfelde/ Wartenberg SEV Blankenburg–Karow + Blankenburg- 19.10.–25.10.2018 Schönfließ SEV Sprinpfuhl–Wartenberg/ Ahrensfelde 26.06.–16.07.2018 20.07.–23.07.2018 SEV Blankenburg–Buch + Blankenburg- Schönfließ 16.07.–23.07.2018 SEV Blankenburg–Buch Ersatzneubau 23.07.–17.08.2018 EÜ Thälmannstr. + Entflechtung S-/F- ZBS S5 West Schienenauswechslung Bahn Bf Strausberg SEV Westkreuz–Spandau SEV Tiergarten–Charlottenburg SEV Mahlsdorf– 13.08.–16.08.2018 (in Prüfung 23.07.-03.08.2017 Strausberg Nord Verschiebung IBN nach 01/2019) 23.11.–29.11.2018 Umbau Ostkreuz – Neubau Bahnsteig Karlshorst Ibn Endzustand 4-gleisigkeit SEV Rummelsburg–Wuhlheide ZBS S7 West + Begegnungsabschn. Potsdam SEV Ostkreuz–Karlshorst 06.07.–16.07.2018 SEV Wannsee–Potsdam 02.11.–12.11.2018 kein Verkehrshalt Karlshorst 03.08.–06.08. + 10.08.–13.08. + 14.12.–17.12.2018 SEV Alexanderplatz–Lichtenberg 06.07. – 06.08.2018 SEV Westkreuz–Wannsee + Babelsberg–Potsdam 02.11.–05.11. + 09.11.–12.11.2018 eingleisig Wuhlheide – Karlshorst 31.08.–03.09.2018 06.08. – 15.08.2018 SEV Westkreuz–Grunewald 16.11.–19.11.2018 Ende Neubau EÜ Sterndamm + Neubau PT Schöneweide bis 2021 bis 20.08.2018 halbseitg. -

Berliner Mauerweg 2 RR1 Potsdam RR12 Modernisiert Und Ein Zugang Zu Dem Neuen Stand- Dem Mauerbau Änderte Die DDR Die Streckenfüh- Bahn Lag Nördlich Des Königswegs
Griebnitzsee Schönefeld Berliner Forst Wannsee | Düppel Kleinmachnow Teltow Lichterfelde Berliner Mauerweg – 21. Kohlhasenbrück 16. Grenzübergang Drewitz 14. Museumsdorf Düppel 13. Stadt Teltow Berliner Mauerweg – Stadtroute und Umlandrouten Bei Kohlhasenbrück soll der Pferdehändler Hans Der DDR-Grenzübergang Drewitz befand sich Nicht unmittelbar am Mauerweg gelegen, aber Wer heute durch die Straßen der auf dem Teltow Der 160 km lange, durchgängig befahrbare Berliner 160 km historische Grenzwege Kohlhase im 16. Jahrhundert einen königlichen Berliner Mauerweg südlich des Königswegs. In dem erhaltenen Füh- einen Abstecher wert, ist die beeindruckende am Teltowkanal gelegenen Stadt wandert, kann Der Berliner Mauerweg kennzeichnet den Verlauf der ehe- Münztransport überfallen und den Raub unter (Fähre) rungspunkt der ehemaligen DDR-Übergangs- Rekonstruktion eines 800 Jahre alten Dorfes in sich an der 1994 begonnenen Rekonstruktion der Mauerweg nimmt eine Sonderstellung im Berliner einer Brücke versteckt haben. Das Leben und sein stelle hat der Verein Checkpoint Bravo e.V. eine Düppel. In dem Freiluftmuseum können vom Altstadt und Stadtkirche (umgestaltet durch Karl Fahrradroutennetz ein. Er soll an die einstige Trennung maligen DDR-Grenzanlagen zu West-Berlin. Er führt über Ende am Galgen dienten Heinrich von Kleist als Erinnerungsstätte eingerichtet. Der Panzer auf Frühjahr bis zum Herbst mittelalterliche Bräuche Friedrich Schinkel 1810–12) erfreuen. Eine regio- rund 160 km um die einstige Halbstadt herum. In den meis- Vorlage für seine Novelle „Michael Kohlhaas“. dem Sockel an der Autobahn wurde nach der studiert werden. nale Spezialität sind die Teltower Rübchen, das der Stadt erinnern. Auf dem historischen Themenpfad Wende in einer Nacht-und-Nebel-Aktion durch Rübchenfest findet im September statt. können heute die Spuren der ehemaligen Grenzanlagen, ten Abschnitten verläuft die Rad- und Wanderroute auf 2,5 einen rosaroten Schneepflug ersetzt. -

Dorf 27.09.2021 Begegnungsstätte Maxie - Treff 14:30-19:00 Uhr Mo Maxie-Wander-Str
Blutspenden in Berlin bis zum 28.12.2021 Berlin 10178 - Mitte 24.09.2021 KÖRPERWELTEN Berlin 13:00-17:30 Uhr Fr Panoramastr. 1 A Berlin 12203 - Lichterfelde 24.09.2021 Institut Berlin 14:00-19:30 Uhr Fr Hindenburgdamm 30A Berlin 10178 - Mitte 25.09.2021 KÖRPERWELTEN Berlin 10:30-15:00 Uhr Sa Panoramastr. 1 A Berlin 12203 - Lichterfelde 27.09.2021 Institut Berlin 08:00-12:00 Uhr Mo Hindenburgdamm 30A Berlin 12619 - Hellersdorf 27.09.2021 Begegnungsstätte Maxie - Treff 14:30-19:00 Uhr Mo Maxie-Wander-Str. 56-58 Berlin 10785 - Tiergarten 28.09.2021 THE RITZ-CARLTON Berlin 13:00-17:30 Uhr Di Potsdamer Platz 3 Berlin 12203 - Lichterfelde 28.09.2021 Institut Berlin 15:00-19:00 Uhr Di Hindenburgdamm 30A Berlin 12359 - Britz 28.09.2021 Albert-Einstein-Gymnasium 16:00-19:30 Uhr Di Parchimer Allee 109-133 Berlin 10249 - Friedrichshain 29.09.2021 Bethel-Gemeinde 15:00-19:00 Uhr Mi Matternstr. 17/18 Berlin 13439 - Wittenau 29.09.2021 Katholische Kirchengemeinde 14:30-19:00 Uhr Mi Wilhelmsruher Damm 144 Berlin 12439 - Niederschöneweide 30.09.2021 Archenhold-Oberschule 16:00-19:00 Uhr Do Rudower Str. 7 Berlin 13355 - Wedding 30.09.2021 Unicorn.Berlin WEM GmbH 14:00-18:30 Uhr Do Brunnenstr. 64 Berlin 10117 - Mitte 01.10.2021 NH COLLECTION Hotel 14:00-19:00 Uhr Fr Friedrichstr. 96 Berlin 12203 - Lichterfelde 01.10.2021 Institut Berlin 14:00-19:30 Uhr Fr Hindenburgdamm 30A Bernau Bei Berlin 16321 - Bernau 01.10.2021 Historisches Rathaus Bernau 15:00-19:00 Uhr Fr Marktplatz 2 Berlin 10117 - Mitte 02.10.2021 NH COLLECTION Hotel 10:00-14:30 Uhr Sa Friedrichstr. -

Bewohnerumfrage Ihre Meinung Ist Gefragt Kiezportrait Karlshorst
NR. 86 DEZEMBER 2018 Bewohnerumfrage Kiezportrait Karlshorst Ihre Meinung ist gefragt Dahlem des Ostens 2 VORWORT · INHALT · IMPRESSUM Liebe Mitglieder der EVM Berlin eG, INHALT ein interessantes, spannendes und erfolgreiches Jahr liegt BAUEN & MODERNISIEREN hinter unserer Genossenschaft. Zum Ende eines Jahres ist Ge- Richtfest am Bundesratufer und im alten Borsigpark 3 legenheit zurückzublicken, aber auch nach vorne zu schauen. Bauboom wirkt sich auch auf die Genossenschaft aus 4 Neben vielen kleinen und großen Anstrengungen stand das Jahr 2018 auch wieder für Neubau und somit für die Erwei- WOHNEN terung des Bestandes unserer Genossenschaft. Auch wenn Wasser marsch – oder lieber doch nicht? 5 bei weitem nicht so umfangreich wie unser letzter Neubau Sagen Sie uns Ihre Meinung! 6 in Karlshorst, so sind wir trotzdem stolz im nächsten Jahr Hilfe, ich stecke fest! 7 insgesamt 12 Wohnungen (DG Aufstockung und Gartenhaus) in Moabit an die Bewohner übergeben zu können. Um den Be- RATGEBER darf für Familien nach mehr Platz zu erfüllen, haben wir uns Einfach aufhören. Aber wie? 8 bewusst für größere Wohnungen als in unserem Bestands- durchschnitt entschieden. Wir freuen uns auch darüber, dass EVM INTERN unsere EVM Treffs Zuwachs bekommen haben und wir im Herzlich willkommen! 9 Oktober den EVM Treff in Lankwitz eröffnen konnten. Trauer um Hans-Joachim Worm 9 4 Fragen an … 10 Nach vorne geschaut heißt es, neben der Fertigstellung der Ausbildung in unserer Genossenschaft 11 vorgenannten Bauvorhaben, auch mit dem Projekt Soziales Zentrum Mariendorf im nächsten Jahr starten zu können. Damit Sie auch morgen gut und sicher wohnen 12 Leider hat die ein oder andere rechtliche Konstellation es Veränderungen im Personalbereich 12 uns nicht ermöglicht, bereits in diesem Jahr mit den umfang- Vertreterrundfahrt 13 reichen Bauvorhaben zu beginnen. -

2015 Lankwitz Und Lichterfelde
Kiezatlas Lankwitz und Lichterfelde-Ost 2016 unsere Lieblingsorte in Lankwitz und ein Kiez-Atlas für fast Alle Lichterfelde-Ost Zeichenerklärung barrierefreier Ort Hinweise zur Benutzung es gibt ein rollstuhlgerechte Toilette Wenn Sie diesen Teil aufklappen) kommen Sie zu einer Seite mit Erklärungen. Diese Erklärungen helfen Ihnen) die Informationen an diesem Ort sind leicht zu verstehen die Zeichen im Kiez-Atlas zu verstehen. Wenn Sie dann noch einmal blättern) kommen Sie zu einer Karte vom Kiez. Die Orte auf der Karte sind mit einer farbigen Figur gekennzeichnet. Durch die Farben können Sie die Orte einfacher finden. )) Eine Úbersicht ))Was kann ich wo machen? finden Sie auf der letzten Seite. Sie können die Karte immer aufgeklappt lassen) wenn Sie durch den Kiez-Atlas blättern. Dann wissen Sie auch immer) wo die Orte zu finden sind. Diese sind mit einem Pfeil markiert. Lichterfelde-Ost 1 Bahnhof Lichterfelde-Ost / LIO 2 Villa Folke Bernadotte 3 Petruskirche 4 Volkshochschule 5 Tierarztpraxis Dr. Sörensen 6 Lilienthalpark / Fliegeberg Rund um den Bahnhof Lankwitz 7 Käseglocke 8 Pizzeria La Montanara 9 Leonorenstraße Rund um die Kirche Lankwitz 10 Dreifaltigkeitskirche 11 Sultan Grill 12 Stadtteilbücherei Lankwitz 13 Alt-Lankwitzer Sportplatz 14 Kino Thalia Rund um den15 GemeindeparkGemeindepark Lankwitz Lankwitz 16 Pastor-Braune-Haus 17 Pizzeria Bardolino 18 Camphill-Lebensgemeinschaft Alt-Schönow Vorwort Liebe Leserin) lieber Leser) Mit dem Projekt Kiezatlas Der Kiezatlas zeigt einen Ausschnitt davon) ))Unsere Lieblingsorte in Lankwitz und wie vielfältig Lankwitz und Lichterfelde sind – )) alle reden von Inklusion. Lichterfelde-Ost – Ein Kiezatlas für fast Alle es ist bewusst ein subjektiver Eindruck. Gemeint ist) dass alle Menschen möchten wir einen weiteren Schritt Das Ergebnis eines Prozesses) unabhängig vom Alter) in Richtung einer inklusiven Gesellschaft gehen. -

Vereine in Steglitz - Zehlendorf Sortiert Nach Postleitzahl
Vereine in Steglitz - Zehlendorf sortiert nach Postleitzahl VN Name 030 771 68 86 PLZ Ort Telefon E-Mail Webseite 4478 Fechtclub Berlin Südwest e. V. Kollwitzstraße 81 10435 Berlin 030 707 60 440 [email protected] www.fechtclub-berlin.de 4767 TOP TEN BUDO AKADEMIE e. V. Georg-Wilhelm-Straße 3 10711 Berlin 030 30 20 59 76 [email protected] www.afk-berlin.de 1262 Förderverein des Golfverbandes Berlin-Brandenburg e. V. Forststraße 34 12163 Berlin 030 823 66 09 [email protected] www.gvbb.de 4872 Turn- und Sportgemeinde Steglitz 1878 e.V. Schildhornstraße 13 12163 Berlin 030 791 90 19 [email protected] www.tsgsteglitz.de 3119 Sonne 08 Berlin Wannsee e. V. Zimmermannstr. 17 12163 Berlin - [email protected] www.sonne08.de 0935 Budo-Club Randori Berlin e. V. Kuhligkshofstraße 4 12165 Berlin 030 79 70 15 09 [email protected] www.randori-berlin.de/berlin/judo/ 1930 Judo-Karate-Klub Nippon Berlin e. V. Mittelstraße 34 12167 Berlin 030 791 28 84 [email protected] www.sportstudio-nippon.com 1815 Hellas Basket Berlin e. V. Mittelstraße 33 12167 Berlin 0178 2458239 [email protected] www.hellas-basket.clubdesk.com/clubdesk 1766 Handball-Club Steglitz e. V. Bergstraße 4 12169 Berlin 030 791 10 17 [email protected] www.hcsteglitz.de 2664 Red Devils Berlin e. V. Steglitzer Damm 46 12169 Berlin 0151 12 65 69 18. [email protected] www.red-devils-inlinehockey.berlin 4420 Schwimmgemeinschaft Steglitz Berlin e. V. Undinestraße 6 12203 Berlin 030 8174711 [email protected] www.sg-steglitz.de 1182 The English Football Club Berlin e. -
![Shades of Goethe--And of Hitler: a History of [The Town Of] Weimar](https://docslib.b-cdn.net/cover/5171/shades-of-goethe-and-of-hitler-a-history-of-the-town-of-weimar-1655171.webp)
Shades of Goethe--And of Hitler: a History of [The Town Of] Weimar
Michael H. Kater. Weimar: From Enlightenment to the Present. New Haven: Yale University Press, 2014. Illustrations. 480 pp. $45.00, cloth, ISBN 978-0-300-17056-6. Reviewed by Ulf Zimmermann Published on H-German (January, 2016) Commissioned by Nathan N. Orgill Michael H. Kater covers the terrain an‐ of the local Gymnasium, the only upper school in nounced in his subtitle in ten chapters, slicing the duchy and one that taught classical languages, Weimar’s history into periods unique to the city. and ends with the death of Johann Wolfgang von Thus he has, for example, a chapter specifically Goethe. Heintze’s appointment was immediately on the Weimar Bauhaus experiment, from 1919 to approved by Anna Amalia, who, as a niece of 1925, followed by a general one on the Weimar Frederick the Great and princess of Braun‐ Republic, from 1918 to 1933. In addition to a chap‐ schweig-Wolfenbüttel, had a taste for culture. She ter on the Third Reich, from 1933 to 1945, he in‐ was, for example, familiar with the work of cludes a separate one on the nearby concentra‐ Christoph Martin Wieland, then a professor of tion camp of Buchenwald, from 1937 to 1945. philosophy at Erfurt University who had just pub‐ In a brief prologue, Kater explains his motiva‐ lished The Golden Mirror (1772), a work whose tions for writing this book. As a child at his grand‐ pedagogical and political ideas on how a prospec‐ parents’ home in Germany he had heard much tive ruler should be brought up and rule seemed about a direct ancestor who was “a member of perfect for the more exclusive education of the fu‐ the circle of savants surrounding Dowager ture duke. -

Berlin-Lichterfelde.Pdf
Lichterfelde ist ein Ortsteil im Bezirk Steglitz- Zehlendorf von Berlin. Lichterfelde liegt südlich des Ortsteils Dahlem, grenzt im Osten an Steglitz und nach Westen an Zehlendorf. Lichterfelde unterteilt sich in die Ortslagen Giesensdorf und Lichterfelde Süd sowie die beiden Villenkolonien Lichterfelde West und Lichterfelde Ost, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts um das alte Dorf und das Rittergut Lichterfelde entstanden. Lichterfelde-West zählt zu den beliebtesten Wohngegenden der Stadt. Das um 1900 entwickelte Wappen von Lichterfelde zeigt drei Lichter (Kerzen), die die drei Bestandteile des heutigen Stadtteils symbolisieren, die Dörfer, die alten Ortsteile und die Villenkolonien. Geschichte Das Dorf Lichtervelde wurde im 13. Jahrhundert wohl von flämischen Ansiedlern gegründet. Lichterfelde erfuhr eine starke Bevölkerungsveränderung und -zunahme mit Entwicklung der Villenkolonien Lichterfelde West und Lichterfelde Ost nach 1860. 1882 werden die einzelnen Siedlungen zu Groß-Lichterfelde vereinigt. Bei der großen Stadterweiterung von 1920 wird Lichterfelde mit seinen Nachbargemeinden nach Groß- Berlin eingemeindet. Während der Teilung Berlins gehörte Lichterfelde zum US- amerikanischen Sektor. Die Dorfkirche Lichterfelde wurde im 14. Jahrhundert aus Feldsteinen errichtet und um 1780 erneuert. Die Dorfkirche Giesensdorf ist um 1250 errichtet worden. 1609 erhielt sie größere Fenster. Die Kirche wurde im Zweiten Weltkrieg stark zerstört. Beim Wiederaufbau wurde der hölzerne Glockenturm nicht wieder neu errichtet, sondern die Glocken wurden in einem Dachreiter untergebracht. Die neugotische Nazareth-Kirche zu Ehren der Heiligen Familie entstand 1901. Die Lichterfelder Dorfaue war Standort eines weit bekannten und im Jahr 1898 enthüllten Reiterstandbildes von Kaiser Wilhelm I., gefertigt von Ernst Wenck, das kriegsbedingt verlagert bis heute in einem Depot in Spandau aufbewahrt wird. -

Internet-Based Hedonic Indices of Rents and Prices for Flats: Example of Berlin
A Service of Leibniz-Informationszentrum econstor Wirtschaft Leibniz Information Centre Make Your Publications Visible. zbw for Economics Kholodilin, Konstantin A.; Mense, Andreas Working Paper Internet-based hedonic indices of rents and prices for flats: Example of Berlin DIW Discussion Papers, No. 1191 Provided in Cooperation with: German Institute for Economic Research (DIW Berlin) Suggested Citation: Kholodilin, Konstantin A.; Mense, Andreas (2012) : Internet-based hedonic indices of rents and prices for flats: Example of Berlin, DIW Discussion Papers, No. 1191, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), Berlin This Version is available at: http://hdl.handle.net/10419/61399 Standard-Nutzungsbedingungen: Terms of use: Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen Documents in EconStor may be saved and copied for your Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden. personal and scholarly purposes. Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle You are not to copy documents for public or commercial Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich purposes, to exhibit the documents publicly, to make them machen, vertreiben oder anderweitig nutzen. publicly available on the internet, or to distribute or otherwise use the documents in public. Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen (insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten, If the documents have been made available under an Open gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort Content Licence (especially Creative Commons Licences), you genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte. may exercise further usage rights as specified in the indicated licence. www.econstor.eu 1191 Discussion Papers Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung 2012 Internet-Based Hedonic Indices of Rents and Prices for Flats Example of Berlin Konstantin A. -
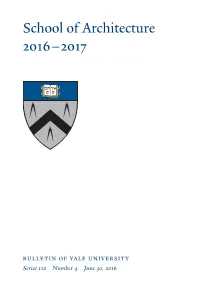
School of Architecture 2016–2017 School of Architecture School Of
BULLETIN OF YALE UNIVERSITY BULLETIN OF YALE BULLETIN OF YALE UNIVERSITY Periodicals postage paid New Haven ct 06520-8227 New Haven, Connecticut School of Architecture 2016–2017 School of Architecture 2016 –2017 BULLETIN OF YALE UNIVERSITY Series 112 Number 4 June 30, 2016 BULLETIN OF YALE UNIVERSITY Series 112 Number 4 June 30, 2016 (USPS 078-500) The University is committed to basing judgments concerning the admission, education, is published seventeen times a year (one time in May and October; three times in June and employment of individuals upon their qualifications and abilities and a∞rmatively and September; four times in July; five times in August) by Yale University, 2 Whitney seeks to attract to its faculty, sta≠, and student body qualified persons of diverse back- Avenue, New Haven CT 0651o. Periodicals postage paid at New Haven, Connecticut. grounds. In accordance with this policy and as delineated by federal and Connecticut law, Yale does not discriminate in admissions, educational programs, or employment against Postmaster: Send address changes to Bulletin of Yale University, any individual on account of that individual’s sex, race, color, religion, age, disability, PO Box 208227, New Haven CT 06520-8227 status as a protected veteran, or national or ethnic origin; nor does Yale discriminate on the basis of sexual orientation or gender identity or expression. Managing Editor: Kimberly M. Go≠-Crews University policy is committed to a∞rmative action under law in employment of Editor: Lesley K. Baier women, minority group members, individuals with disabilities, and protected veterans. PO Box 208230, New Haven CT 06520-8230 Inquiries concerning these policies may be referred to Valarie Stanley, Director of the O∞ce for Equal Opportunity Programs, 221 Whitney Avenue, 3rd Floor, 203.432.0849. -

Henselmann (Siehe Beiträge Zu Wohnungsbau Und Stadtentwicklung in Berlin Iiiplen/Vorgang/D17-2811.Pdf)
EDITORIAL Fast schien es so, als ob die Stadtdebatte zur Berliner Mitte mit den im Sommer 2016 vom Abgeordnetenhaus beschlossenen Bür- gerleitlinien ihre Erledigung gefunden hätte HENSELMANN (siehe www.parlament-berlin.de/ados/17/ BEITRÄGE ZU WOHNUNGSBAU UND StadtentwiCKLUNG IN BERLIN IIIPlen/vorgang/d17-2811.pdf). Viele fragten sich bereits, ob bzw. wann und wie es weiter- geht. Nun hat der neue rot-rot-grüne Senat von Berlin die Fortführung und Neuausrich- tung der Berliner Stadtdebatte beschlossen. Wir widmen daher unsere fünfte Ausgabe diesem Thema. Die Senatorin für Stadtentwicklung und Woh- 1/2017 nen Katrin Lompscher (DIE LINKE) erläutert uns einleitend den neuen Senatsbeschluss. Klaus Brake und Stefan Richter kommen- tieren die angekündigte Neuausrichtung der Stadtdebatte. Was Katrin Lompscher andeutet: Die Neuaufteilung der Senatsres- sorts macht die Lösung zentraler Fragen der Berliner Mitte nicht einfacher. Wir wollen einige dieser Fragen jetzt schon diskutie- ren: Thomas Flierl und Theresa Keilhacker gehen der Frage nach, ob die Zentral- und Landesbi bliothek in die Mitte der Stadt soll- te. Der Architekt Peter Meyer würdigt die den Stadtinnenraum prägenden Raumkanten, die beiden Großwohneinheiten an der Rathaus- und an der Karl-Liebknecht-Straße. Gabi Dolff-Bonekämper setzt die beiden umstrit- tenen Projekte, die Rekonstruktion der Bau- akademie Schinkels und die Errichtung des Freiheits- und Einheitsdenkmals („Wippe“), zueinander in Beziehung. Schließlich erör- tert Markus Wollina die Verkehrsfrage am Beispiel der Spandauer Straße. Der erweiterte Betrachtungsraum schafft Möglichkeiten, die Berliner Mitte stärker in ihrer Vernetzung mit der Umgebung und der Gesamtstadt zu diskutieren. Gleichzeitig geht es um Entscheidungen über die zukünf- tige Gestaltung. Wir bleiben dran! Übrigens: Ab 2018 wird „Henselmann“ mehr als einmal im Jahr erscheinen.