Die Menagerie Des Landgrafen Karl
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Simon-Louis Du Ry Als Stadtbaumeister Landgraf Friedrichs D
174 Simon-Louis du Ry als Stadtbaumeister Landgraf Friedrichs D. von Hessen-Kassel Von Hans-Kurt Boehlke Dleser AII/sarz ist dell! GediJcl1t11is des aUl 8. Mai 1958 verstorbeneH Redakteurs bti dell ~He ss/ 5dteJf Nadlrldlre"" FRIED RI CH HERBORDT gewldmet. Herbordt war cintr de, letzteJl begeisteruHgs fal,igell Kellllfr se/ll er If llrergeg(UlgenfH und "un wledererstdlfHdeH Vater. stadt "lid der Gesdddire seiHer Ju!ss isdlfU HtiJHat . Die Baugesd,icl1te Kassels hat srets 5thl beso"deres Interesse ge(ulldeu (HId in illr war aucl1 far am SilHOlf· Loufs du Ry die zen· trale F/gu,. Mit dem Beginn def Ausdehnung uber die mauerumschlossenen mittela1terlichen Stadtteile hinaus taucnt der Name du Ry gegen Ende des 17.1ahrhunderts zum erstenmal in Kassel auf. Der Hugenotte Paul du Ry ist es, def den Grundstein zur Kasseler Oberneustadt legt. Mit ihm sind es von nun an drei Generationen dieser Einwandererfamilie. die das Gesidtt der Residenzstadt bilden uod pdigen. Der Enkel Paul du Rys, Simon-Louis, br.chte die von dem Langrafen gestellte Aufgabe zum AbsdtluB. Er war ohne Frage der Bedeutendste dieser Baumeisterfamilie 1. Simon-Louis du Ry gehort einer Generation an, die zwischen den groBen kunst geschichtlidten Epochen steht. Die Ietzten - in den beiden lahrzehnten vor der Wende zum 18. 1ahrhundert geborenen - groBen deutscheo Barock-Baumeister sterben urn die Mitte des lahrhunderts oder kurz danadt: Dom. Zimmermann (1685- 1762), C. D. Asam (1686-1739), Jos. Ellner (1687-1745), Balth. Neumann (1687- 1753), K. J. Dientzenhofer (1689-1751). J. K. Schlaun (1695-1773). G. W. Knobelsdorf (1699-1753). Den Wallonen Fr. de CuviUies (1695-1768), der aus- 1 Seiner Tatigkeit als Stadtplaner und -bauer galten die Untersuchungen des Verfassers. -

Making National Museums: Comparing Institutional Arrangements, Narrative Scope and Cultural Integration (Namu)
NaMu Making National Museums: Comparing institutional arrangements, narrative scope and cultural integration (NaMu) NaMu IV Comparing: National Museums, Territories, Nation-Building and Change Linköping University, Norrköping, Sweden 18–20 February 2008 Conference Proceedings Editors Peter Aronsson and Andreas Nyblom Financed by the European Union Marie Curie Conferences and Training Courses http://cordis.europa.eu/mariecurie-actions/ NaMu. Contract number (MSCF-CT-2006 - 046067) Copyright The publishers will keep this document online on the Internet – or its possible replacement – for a period of 25 years starting from the date of publication barring exceptional circumstances. The online availability of the document implies permanent permission for anyone to read, to download, or to print out single copies for his/her own use and to use it unchanged for non- commercial research and educational purposes. Subsequent transfers of copyright cannot revoke this permission. All other uses of the document are conditional upon the consent of the copyright owner. The publisher has taken technical and administrative measures to assure authenticity, security and accessibility. According to intellectual property law, the author has the right to be mentioned when his/her work is accessed as described above and to be protected against infringement. For additional information about Linköping University Electronic Press and its procedures for publication and for assurance of document integrity, please refer to its www home page: http://www.ep.liu.se/. -

Art Museum Architecture Konstmuseiarkitektur
GÖTEBORGS KONSTMUSEUMS SKRIFTSERIE GÖTEBORGS KONSTMUSEUMS SKRIFTSERIE DETTA ÄR DET SJUNDE NUMRET AV GÖTEBORGS KONSTMUSEUMS SKRIFTSERIE SKIASCOPE Konstmuseiarkitektur Namnet är hämtat från ett instrument som den inflytelserike museimannen Art Museum Architecture Konstmuseiarkitektur Benjamin Ives Gilman utvecklade i början av 1900-talet för att ge betraktaren möjlighet att fokusera på konsten i de, enligt upphovsmannen, ofta alltför ISBN 978-91-87968-92-1 stora och tätt hängda museisalarna. Ett finns på Göteborgs konstmuseum, sannolikt inköpt av Axel L. Romdahl. Skiascopet blev aldrig någon succé. Det blev kanske obsolet genom att en glesare hängningsideologi vann mark under mellankrigstiden. Ändå kan nog Från Altes Museum och Londons National Gallery många museibesökare känna igen sig i det som Gilman beskriver som ett av till MAXXI och Louvren Abu Dhabi. I detta nummer museiväsendets grundproblemen: den museitrötthet som infinner sig redan av Skiascope undersöks konstmuse iarkitektur med efter ett par salar. Redan vid sekelskiftet stod det klart att museernas själva utgångspunkt i de sen aste decenniernas många ny- essens – att samla och ställa ut – hotade att göra dem alltför omfattande och uppförda och tillbyggda konstmuseer. Vi frågar oss omöjliga för besökarna att ta till sig. Sovring blir med tiden lika viktigt som varför konstmuseer ser ut som de gör, hur olika syn samlande. på konsten och konstmuseets roll i samhället satt Denna skriftseries ledstjärna är just fokusering. Liksom Gilmans instru- avtryck i arkitekturen. ment vill vi bidra till att rama in, lyfta fram och intensivt studera frågor som vi ser som betydelsefulla. Det kan vara enskilda verk, konstnärskap eller tidsperioder. • Demonstration av ett skiascope, ur Benjamin Ives Gilmans, Museum Ideals of Purpose and Methods, From the Altes Museum and the National Gallery THIS IS THE SEVENTH ISSUE OF SKIASCOPE Cambridge 1918, s. -
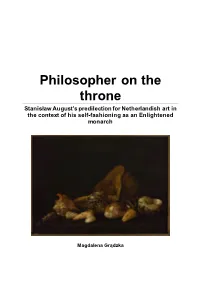
Open Access Version Via Utrecht University Repository
Philosopher on the throne Stanisław August’s predilection for Netherlandish art in the context of his self-fashioning as an Enlightened monarch Magdalena Grądzka Philosopher on the throne Magdalena Grądzka Philosopher on the throne Stanisław August’s predilection for Netherlandish art in the context of his self-fashioning as an Enlightened monarch Magdalena Grądzka 3930424 March 2018 Master Thesis Art History of the Low Countries in its European Context University of Utrecht Prof. dr. M.A. Weststeijn Prof. dr. E. Manikowska 1 Philosopher on the throne Magdalena Grądzka Index Introduction p. 4 Historiography and research motivation p. 4 Theoretical framework p. 12 Research question p. 15 Chapters summary and methodology p. 15 1. The collection of Stanisław August 1.1. Introduction p. 18 1.1.1. Catalogues p. 19 1.1.2. Residences p. 22 1.2. Netherlandish painting in the collection in general p. 26 1.2.1. General remarks p. 26 1.2.2. Genres p. 28 1.2.3. Netherlandish painting in the collection per stylistic schools p. 30 1.2.3.1. The circle of Rubens and Van Dyck p. 30 1.2.3.2. The circle of Rembrandt p. 33 1.2.3.3. Italianate landscapists p. 41 1.2.3.4. Fijnschilders p. 44 1.2.3.5. Other Netherlandish artists p. 47 1.3. Other painting schools in the collection p. 52 1.3.1. Paintings by court painters in Warsaw p. 52 1.3.2. Italian paintings p. 53 1.3.3. French paintings p. 54 1.3.4. German paintings p. -

№ 13 – the KITCHEN STAIRCASE 1. Console
№ 13 – THE KITCHEN STAIRCASE 1. Console - table. Germany. Early 18th c. 2. Vase. China. 18th c. Brass mount – Europe. 19th c. 3. Mirror. Russia. 4th quarter of the 19th c after the original of Gustave Doret, 1877 4. Unknown artist. Settlement Near the Ford. Holland. 2nd half of the 17th c. 5. Unknown artist. Abraham’s Sacrifice. Germany (?). Late 18th c. A copy 6. Unknown artist, flemish school. Spanish Cavalryman. 3rd quarter of the 17th c. 7. Unknown artist, flemish school. Spanish Cavalryman. 3rd quarter of the 17th c. 8. Console – table. A copy from the german original of early 18th c. Latvia. 1981 9. Unknown sculptor. Austrian generalissimo Ernst Gideon von Laudon (?). Latvia. 2nd half of the 18th c. 10. Wallsconces. Copies after the russian18th century pattern 11. Latern. A copy from the18th century lantern in the Kuskovo Palace, Moscow № 70 - THE ANTECHAMBER OF THE GOLD HALL 1. Cartel clock. France, Chateaudun, clockmaker Godeau. 2nd half of the 18th c. 2. Unknown artist, russian school. Elizabeth Petrovna, Empress of Russia. 18th c. 3. Jan de Bray (?). Artemisia. Netherlands. Mid of the 17th c. 4. Unknown artist. The Finding of Moses. Flanders. 17th c. 5. Unknown artist. Juno at the Corpse of Argus. Italy. Late 17th c. 6. Chairs (10). Germany/Belgium, Aachen-Liège. 18th c. 7. Thomass Huber. Painter Friedrich Wilhelm Weidemann. Germany. 1743 Chandelier. A copy from the original 18th century chandelier in the Kuskovo Palace, Russia № 74 - THE BLUE ROOM 1. Mirror. Germany. 1st quarter of the 18th c. 2. Vase. China. 18th c. 3. Console table. -

JUN 2 7 2013 JUNE 2013 LIBRAR ES 02013 Mariel A
Life behind ruins: Constructing documenta by Mariel A. Viller6 B.A. Architecture Barnard College, 2008 SUBMITTED TO THE DEPARTMENT OF ARCHITECTURE IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF ARCHVES MASTER OF SCIENCE IN ARCHITECTURE STUDIES MASSACHUSETTS INSTTE AT THE OF TECHNOLOGY MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY JUN 2 7 2013 JUNE 2013 LIBRAR ES 02013 Mariel A. Viller6. All rights reserved. The author hereby grants MIT permission to reproduce and distribute publicly paper and electronic copies of this thesis document in whole or in part in any medium now known or hereafter created. Signature of Author: Department of Architecture May 23,2013 Certified by: Mark Jarzombek, Professor of the Histo4y 7eory and Criticism of Architecture Accepted by: Takehiko Nagakura, Chair of the Department Committee on Graduate Students 1 Committee Mark Jarzombek,'Ihesis Supervisor Professor of the History, Theory and Criticism of Architecture Caroline Jones, Reader Professor of the History of Art 2 Life behind ruins: Constructing documenta by Mariel A. Viller6 B.A. Architecture Barnard College, 2008 Submitted to the Department of Architecture on May 23,2013 in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Science in Architecture Studies Abstract A transnational index of contemporary art, documenta in its current form is known in the art world for its scale, site-specificity and rotating Artistic Directors, each with their own theme and agenda. On a unique schedule, the expansive show is displayed in Kassel, Germany from June to September every five years. The origins of the exhibition-event are embedded in the postwar reconstruction of West Germany and a regenerative national Garden Show. -

ABEL, JOHN F., BILLINGTON, DAVID P., & MARK, ROBERT (Eds.) (1973): the Maillart Papers (P.NJ: PUP)
A Dictionary of Architecture and Landscape Architecture 2/e Professor James Stevens Curl SELECT BIBLIOGRAPHY The greatest part of a writer’s time is spent in reading, in order to write: a man will turn over half a library to make one book. JAMES BOSWELL (1740-95): Life of Samuel Johnson (1791), ii (6 April 1775). This provides references for individual entries, but has no pretensions to be comprehensive: it should be regarded as offering the minimum information for further reading, no more. Certain abbreviations have been adopted as follows: A Abbeville Press ACCRV A cura della Cassa di Risparmio di Vignola Aa Altamira AcG Academy Group AA Architectural Association, London, or Architectural ACGB Arts Council of Great Britain Association Publications Ad Ahmedabad AAAB American Association of AD Architectural Design Architectural Bibliographers Ad’A Académie d’Architecture AAF Alvar Aalto Foundation AdA Accademia di Architettura AAG Ages Arti Grafiche ADAE A.D.A. Edita, Tokyo Aal Astragal Ade Ariadne AAM Archives d’architecture moderne AdF Edizione della Cattedra di AA.MI Ann Arbor, MI Composizione Architettonica AAP Arts & Architecture Press della Facoltà di Architettura di Firenze A&AP Archaeology & Architecture Press ADF Aschehoug Dansk Forlag AAVP Action Artistique de la Ville de AdH L’Âge d’Homme Paris AdK Akademie der Künste Ab Abrams AdS Accademia delle Scienze AB Araris Books ADV Akad. Druck & Verlagsanstalt ABA Académie des Beaux-Arts Ae Amulree ABP Architectural Book Publishing AE Academy Editions Co. Af Aschendorff Ac. Academy AF Arkitektens or Arkitektur Forlag ACA Archives of Canadian Art Ag Aguilar ACC Antique Collectors’ Club AG Art Gallery BIBLIOGRAPHY - 1 - 31/01/2006 A.GA Atlanta, Georgia APP Andreas Papadakis Publisher Agi Angeli APS The American Philosophical Society AGP Associated General Publications APuS Architectural Publication Soc. -

Das Tote Jahrhundert Anmerkungen Zur Forschung Über Die Deutsche Malerei Des 17
Originalveröffentlichung in: Zeitschrift des Deutschen Vereins für Kunstwissenschaft 51 (1997), S. 43-70 ANDREAS TACKE Das tote Jahrhundert Anmerkungen zur Forschung über die deutsche Malerei des 17. Jahrhunderts Es ist aufschlußreich, mit der Kunstanschauung des welches neben dem Barock allerdings auch das Mit italienischen Philosophen Benedetto Croce (1866- telalter und den Manierismus mit ausschloß. Richten 1952) die für seine Zeit typische Barockverachtung wir den Blick nach Deutschland und auf die dortige schlaglichtartig darzulegen, welche wohl als Haupt Barockmalerei und lassen nun statt Croce einen deut grund für eine allzu späte wissenschaftliche Würdi schen Kronzeugen, Wilhelm von Bode (1845-1929), gung dieser Kunst auszumachen ist. Nur wenige der zu Wort kommen: »Die Geschichte der Malerei in überaus zahlreichen Autoren haben nämlich ihrer Deutschland während des siebzehnten und achtzehn Ableh nung so prägnant Ausdruck verliehen, wie es ten Jahrhunderts ist gewiß eines der unerquicklich Croce in seinem später gedruckten Vortrag vom sten Kapitel der Kunstgeschichte«2. Und weiter: 2. Februar 1925 an der Eidgenössischen Technischen »Das Todesjahr Holbein's ist die Grenzscheide, über Hochschule Zürich tat. Darin bündelt er seine Ein welche hinaus kaum ein nennenswerthes Gemälde in wände; die hier zitierten Verdammungen stehen für Deutschland mehr entstanden ist;... «3. den ganzen Text: »Sowohl das Wort als auch der Vor diesem Hintergrund wird verständlich, daß es Begriff >Barock< entstanden mit der Idee der Mißbilli im 19., aber auch noch im 20. Jahrhundert wissen gung und nicht etwa, um eine Epoche der Geistesge schaftlicher Konvention entsprach, daß, wer sich mit schichte oder eine Kunstform zu bezeichnen, son der deutschen Barockmalerei auseinandersetzte, eine dern vielmehr eine Art künstlerischer Häßlichkeit, Erklärung für die Wahl des Gegenstandes der Arbeit und, meines Erachtens, kann es nur von Nutzen sein, voranstellte. -

Katalog Roos
Museum Pfalzgalerie Kaiserslautern Johann Heinrich Roos Druckgraphik 29. September bis 3. Dezember 2006 Johann Heinrich Roos Druckgraphik Werke aus der Sammlung Dr. Hans Steinebrei 30. September – 3. Dezember 2006 MUSEUM PFALZGALERIE KAISERSLAUTERN Katalog der ausgestellten Werke Bearbeitung: Hanneke Heinemann Inhalt: Johann Heinrich Roos - Druckgraphik Bemerkungen zum Werk von Johann Heinrich Roos und zu seinem Nachruhm Seite 3 Literatur Seite 10 Katalog Seite 11 Anhang: Saaltexte Seite 69 Schautafeln Seite 76 Bilder der Ausstellung im Oberen Foyer Seite 78 2 Bemerkungen zum Werk von Johann Heinrich Roos und zu seinem Nachruhm Vorwort Der in der Pfalz geborene Maler und Radierer Johann Heinrich Roos war berühmt für seine Tierbilder, aber auch seine Porträts waren bei seinen adeligen und bürgerlichen Auftrag- gebern sehr geschätzt. Am Anfang des 19. Jahrhunderts erzielten seine Gemälde weit hö- here Preise als beispielsweise die eines Salomon van Ruysdael und eines Franz Hals. Seine Werke lagen damit auf demselben Preisniveau wie diejenigen von Jan Vermeer 1. Erst mit der zunehmend negativen Einschätzung der barocken Kunst gegen Ende des 19. Jahrhun- derts schwächt sich das Interesse an Roos’ Werk ab. Das Museum Pfalzgalerie Kaiserslautern zeigt in der Ausstellung zum 375. Geburtstag Jo- hann Heinrich Roos’ virtuos gezeichnete Radierungen, die bis weit in das 19. Jahrhundert hinein nicht nur in renommierten Sammlungen sondern auch in Künstlerateliers geschätzt und studiert wurden. Die zweite Hälfte der Ausstellung präsentiert Stiche und Kopien von ausgezeichneter Qualität nach Roos’ Werken. Sie zeigen die Rezeption seiner Gemälde und Zeichnungen bei Künstlern und Sammlern über einen Zeitraum von mehreren Jahr- hunderten. Der gekonnt aquarellierte „Braune Stier“ von Wilhelm Kobell (Katalognr. -

L'architecture FRANÇAISE EN ALLEMAGNE AU Xviiie SIÈCLE DU MEME AUTEUR
PIERRE DU COLOMBIER - L'ARCHITECTURE FRANÇAISE EN ALLEMAGNE AU XVIIIe SIÈCLE DU MEME AUTEUR ALBERT DURER Albin Michel, 1927 DECAMPS Rieder, 1928 L'ART FRANÇAIS DANS LES COURS RHENANES Renaissance du Livre, 1930 POUSSIN Crès, 1931 TABLEAU DU XXe SIECLE, LES ARTS en collaboration avec ROLAND-MANUEL, Denoël et Steele, 1933 LE STYLE HENRI IV-LOUIS XIII Larousse, 1941 HISTOIRE DE L'ART Fayard et Cie, 1942 L'ART DE LA RENAISSANCE EN FRANCE Le Prat, 1945 LES PLUS BEAUX ECRITS DES GRANDS ARTISTES La Colombe, 1946 L'ART ALLEMAND Larousse, 1946 JEAN GOUJON Albin Michel, 1949 LES CHANTIERS DES CATHÉDRALES Picard, 1953 DE VENISE A ROME aquarelles d'Yves Brayer, Arthaud, 1954 SIENNE ET LA PEINTURE SIENNOISE Arthaud, 1955 Traductions GOETHE Werther, Hermann et Dorothée, La Cité des Livres, 1930 Poésie et Vérité, Aubier, 1941 Iphigénie en Tauride, Gallimard, 1942 Les Affinités élec^ves, Gallimard, 1954 TRAVAUX ET MÉMOIRES DES INSTITUTS FRANÇAIS EN ALLEMAGNE 5 PIERRE DU COLOMBIER L'ARCHITECTURE FRANÇAISE EN ALLEMAGNE AU XVIIIe SIECLE 1 TEXTE 1956 PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE -PARIS 108, BOULEVARD S AI NT - G E RM AI N TOUS DROITS DE REPRODUCTION D'ADAPTATION CINÉMATOGRAPHIQUE, RADIOPHONIQUE OU AUTRE RÉSERVÉS POUR TOUS PAYS CLICHÉS: GRAPHISCHE KUNSTANSTALT UND KLISCHEEFABRIK HAUSSMANN • DARMSTADT IMPRIMÉ EN ALLEMAGNE • IMPRIMERIE IFI-DRUCK, WERK- UND KUNSTDRUCK GMBH - )IAYENCE TABLE DES MATIÈRES Ière PARTIE : LE MILIEU CHAPITRE I. LES COURS D'ALLEMAGNE Les cours d'Allemagne en général. Le Rhin: Margraviats de Bade. - Duché de Wurtemberg. - Électorat palatin. - Duché de Deux-Ponts. - Duché de Nassau-Sarrebruck. - Électorats de Mayence, de Trèves, de Cologne 18 Le Danube : Électorat de Bavière 38 La Weser : Landgraviats de Hesse-Cassel, de Hesse-Darmstadt. -

Report Title Abbühl, Hans-Rudolf
Report Title - p. 1 of 564 Report Title Abbühl, Hans-Rudolf (1930-2009) : Schweizer Architekt Biographie 1982 Dimitri, Franz Hohler, Kaspar Fischer, Polo Hofer, Madeleine Santschi, Isabelle Guisan, Nell Arn, Mani Planzer, Edouard Rieben, Hans-Rudolf Abbühl, Monika Coray, Daniel Leutenegger besuchen China. [CS5] Alexander, William (Maidstone, Kent 1767-1816 Maidstone, Kent) : Maler, Kurator Antiquities British Museum Biographie 1792-1794 William Alexander reist mit der britischen Gesandtschaft George Macartneys nach Beijing. Die Hindostan transportierte die Geschenke für den Kaiser im Gesamtwert von ca. 14‘000 Pfund. Alexander hat Macartneys Audienz beim Kaiser Qianlong in Chengde nicht persönlich beobachten können. Nach der Rückkehr des Kaisers nach Beijing, muss die britische Gesandtschaft Beijing verlassen. Die Reise geht nach Tianjin, Linqing bis Hangzhou, über Ningbo nach Zhushan wo die Hindostan vor Anker lag. Die Hindostan segelte nach Guangzhou, wo Alexander eine Englische Faktorei besucht und im Speisesaal Ansichten von Thomas Daniell bewundert. Dann wartete die Gesandtschaft zwei Monate in Macao. Für Alexander war dies die ergiebigste Periode der Expedition. Viele nach seinen Entwürfen radiert und gestochene Illustrationen zeigen Szenen aus dem chinesischen Laufen auf den Flüssen und Kanälen und an den Ufern. Aus seine Schriften ist bekannt, dass ihn das glänzende Gelbgold chinesischer Dachziegel auf kaiserlichen Palästen und die kräftigen Blautöne der höfischen Kleidung der Mandarine tief beeindruckt haben. [LegS1] Bibliographie : Autor 1792-1794 Alexander, William. Journal of a voyage to Pekin in China on board the "Hindostan" E.I.M., which accompanied Lord Macartney on his embassy to the emperor. ([S.l. : s.n.], 1792-1794). [MS British Museum]. [WC] 1797 Staunton, George Leonard. -

1 Adeline Rege Von Kassel Nach Stockholm, Paris Und Rom: Die Europäischen Reisen Des Kasseler Architekten Simon-Louis Du Ry (1726-1799)
1 Adeline Rege Von Kassel nach Stockholm, Paris und Rom: die europäischen Reisen des Kasseler Architekten Simon-Louis Du Ry (1726-1799) Vortrag in der Kurhessischen Gesellschaft für Kunst und Wissenschaft Kassel e.V. am 25.01.2013 in Verbindung mit der Deutsch-Italienischen Gesellschaft, dem Museumsverein, Verein für Hessische Geschichte und Landeskunde, der Museumslandschaft Hessen Kassel und der Universität Kassel Guten Abend meine Damen und Herren. Ich freue mich besonders, hier in Kassel diesen Vortrag halten zu dürfen, da die Stadt Kassel mein Leben als Studentin und Doktorandin geprägt hat. 2000-2001 habe ich meine Magisterarbeit zum Thema « Simon-Louis Du Ry: Reise nach Frankreich » geschrieben. Ich war damals Erasmus-Studentin an der Philipps- Universität Marburg. Während meiner Promotion bin ich regelmässig nach Kassel und nach Göttingen gekommen. Ich hatte jedes Mal das Glück, in der Bibliothek des Schlosses Wilhelmshöhe zu arbeiten. Es waren sehr schöne Momente, die ich sehr geschätzt habe. Ich möchte mich sehr herzlich bei den Mitarbeitern der Graphischen Sammlung und der Bibliothek bedanken für die wertvolle Hilfe, die ich bekommen habe. Ich hätte nie meine Dissertation erfolgreich schreiben können ohne die perfekten und gemütlichen Arbeitsbedingungen im Schloss Wilhelmshöhe. Es ist mir eine grosse Ehre und eine grosse Freude, von der Kurhessischen Gesellschaft für Kunst und Wissenschaft eingeladen zu sein. Ich möchte mich bei den Veranstaltern des heutigen Vortrags für die freundliche Einladung bedanken: herzlichen Dank an Herrn Gercke und die Kurhessische Gesellschaft für Kunst und Geschichte, an Herrn Döring und die Deutsch-Italienische Gesellschaft, Dank an den Museumsverein ; Dank an den Verein für hessische Geschichte und Landeskunde ; Dank an die Universität Kassel, und Dank an Frau Lukatis.