Von Johann Melchior Roos, Die Kasseler…
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
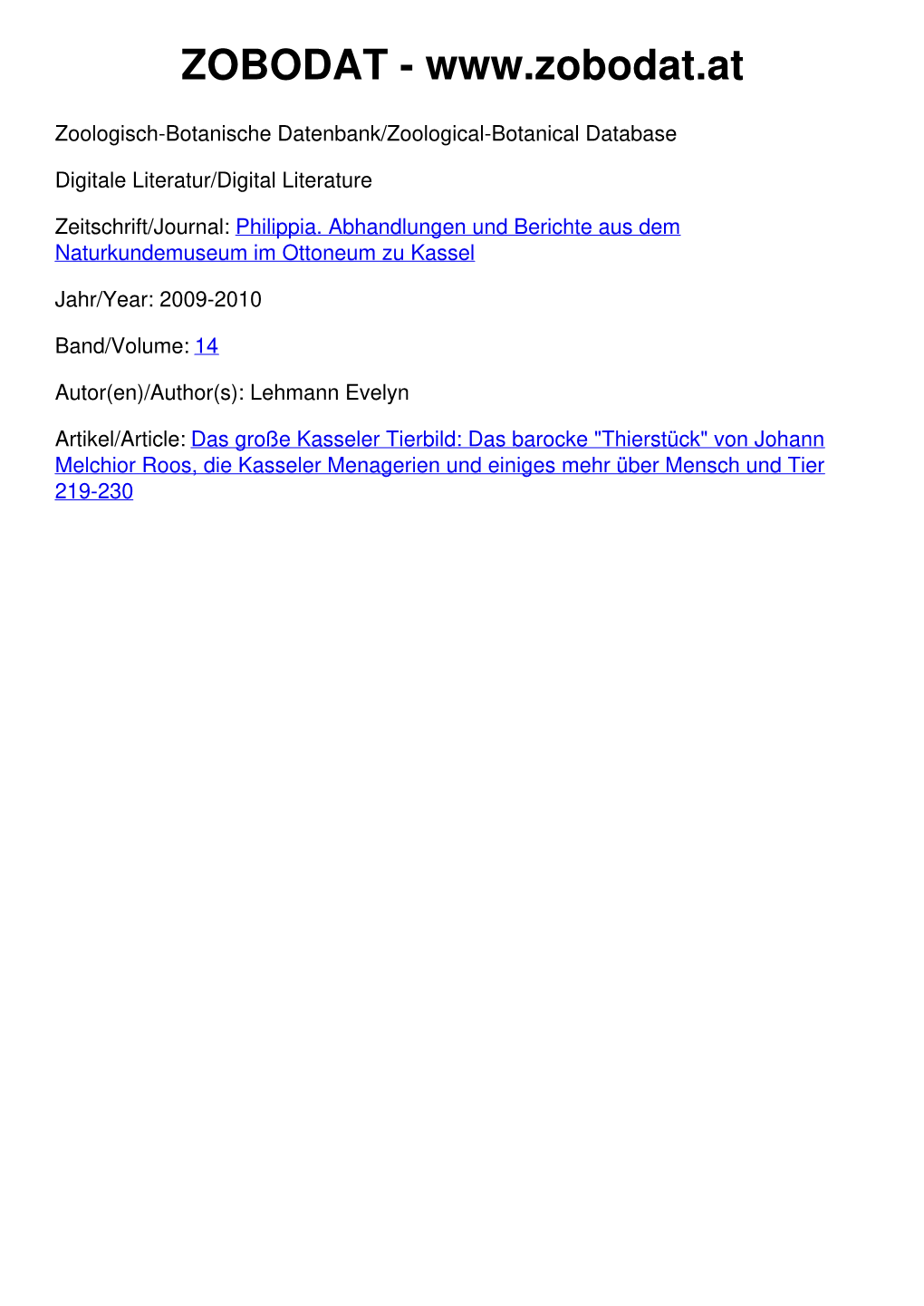
Load more
Recommended publications
-
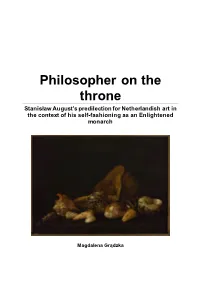
Open Access Version Via Utrecht University Repository
Philosopher on the throne Stanisław August’s predilection for Netherlandish art in the context of his self-fashioning as an Enlightened monarch Magdalena Grądzka Philosopher on the throne Magdalena Grądzka Philosopher on the throne Stanisław August’s predilection for Netherlandish art in the context of his self-fashioning as an Enlightened monarch Magdalena Grądzka 3930424 March 2018 Master Thesis Art History of the Low Countries in its European Context University of Utrecht Prof. dr. M.A. Weststeijn Prof. dr. E. Manikowska 1 Philosopher on the throne Magdalena Grądzka Index Introduction p. 4 Historiography and research motivation p. 4 Theoretical framework p. 12 Research question p. 15 Chapters summary and methodology p. 15 1. The collection of Stanisław August 1.1. Introduction p. 18 1.1.1. Catalogues p. 19 1.1.2. Residences p. 22 1.2. Netherlandish painting in the collection in general p. 26 1.2.1. General remarks p. 26 1.2.2. Genres p. 28 1.2.3. Netherlandish painting in the collection per stylistic schools p. 30 1.2.3.1. The circle of Rubens and Van Dyck p. 30 1.2.3.2. The circle of Rembrandt p. 33 1.2.3.3. Italianate landscapists p. 41 1.2.3.4. Fijnschilders p. 44 1.2.3.5. Other Netherlandish artists p. 47 1.3. Other painting schools in the collection p. 52 1.3.1. Paintings by court painters in Warsaw p. 52 1.3.2. Italian paintings p. 53 1.3.3. French paintings p. 54 1.3.4. German paintings p. -

№ 13 – the KITCHEN STAIRCASE 1. Console
№ 13 – THE KITCHEN STAIRCASE 1. Console - table. Germany. Early 18th c. 2. Vase. China. 18th c. Brass mount – Europe. 19th c. 3. Mirror. Russia. 4th quarter of the 19th c after the original of Gustave Doret, 1877 4. Unknown artist. Settlement Near the Ford. Holland. 2nd half of the 17th c. 5. Unknown artist. Abraham’s Sacrifice. Germany (?). Late 18th c. A copy 6. Unknown artist, flemish school. Spanish Cavalryman. 3rd quarter of the 17th c. 7. Unknown artist, flemish school. Spanish Cavalryman. 3rd quarter of the 17th c. 8. Console – table. A copy from the german original of early 18th c. Latvia. 1981 9. Unknown sculptor. Austrian generalissimo Ernst Gideon von Laudon (?). Latvia. 2nd half of the 18th c. 10. Wallsconces. Copies after the russian18th century pattern 11. Latern. A copy from the18th century lantern in the Kuskovo Palace, Moscow № 70 - THE ANTECHAMBER OF THE GOLD HALL 1. Cartel clock. France, Chateaudun, clockmaker Godeau. 2nd half of the 18th c. 2. Unknown artist, russian school. Elizabeth Petrovna, Empress of Russia. 18th c. 3. Jan de Bray (?). Artemisia. Netherlands. Mid of the 17th c. 4. Unknown artist. The Finding of Moses. Flanders. 17th c. 5. Unknown artist. Juno at the Corpse of Argus. Italy. Late 17th c. 6. Chairs (10). Germany/Belgium, Aachen-Liège. 18th c. 7. Thomass Huber. Painter Friedrich Wilhelm Weidemann. Germany. 1743 Chandelier. A copy from the original 18th century chandelier in the Kuskovo Palace, Russia № 74 - THE BLUE ROOM 1. Mirror. Germany. 1st quarter of the 18th c. 2. Vase. China. 18th c. 3. Console table. -

Das Tote Jahrhundert Anmerkungen Zur Forschung Über Die Deutsche Malerei Des 17
Originalveröffentlichung in: Zeitschrift des Deutschen Vereins für Kunstwissenschaft 51 (1997), S. 43-70 ANDREAS TACKE Das tote Jahrhundert Anmerkungen zur Forschung über die deutsche Malerei des 17. Jahrhunderts Es ist aufschlußreich, mit der Kunstanschauung des welches neben dem Barock allerdings auch das Mit italienischen Philosophen Benedetto Croce (1866- telalter und den Manierismus mit ausschloß. Richten 1952) die für seine Zeit typische Barockverachtung wir den Blick nach Deutschland und auf die dortige schlaglichtartig darzulegen, welche wohl als Haupt Barockmalerei und lassen nun statt Croce einen deut grund für eine allzu späte wissenschaftliche Würdi schen Kronzeugen, Wilhelm von Bode (1845-1929), gung dieser Kunst auszumachen ist. Nur wenige der zu Wort kommen: »Die Geschichte der Malerei in überaus zahlreichen Autoren haben nämlich ihrer Deutschland während des siebzehnten und achtzehn Ableh nung so prägnant Ausdruck verliehen, wie es ten Jahrhunderts ist gewiß eines der unerquicklich Croce in seinem später gedruckten Vortrag vom sten Kapitel der Kunstgeschichte«2. Und weiter: 2. Februar 1925 an der Eidgenössischen Technischen »Das Todesjahr Holbein's ist die Grenzscheide, über Hochschule Zürich tat. Darin bündelt er seine Ein welche hinaus kaum ein nennenswerthes Gemälde in wände; die hier zitierten Verdammungen stehen für Deutschland mehr entstanden ist;... «3. den ganzen Text: »Sowohl das Wort als auch der Vor diesem Hintergrund wird verständlich, daß es Begriff >Barock< entstanden mit der Idee der Mißbilli im 19., aber auch noch im 20. Jahrhundert wissen gung und nicht etwa, um eine Epoche der Geistesge schaftlicher Konvention entsprach, daß, wer sich mit schichte oder eine Kunstform zu bezeichnen, son der deutschen Barockmalerei auseinandersetzte, eine dern vielmehr eine Art künstlerischer Häßlichkeit, Erklärung für die Wahl des Gegenstandes der Arbeit und, meines Erachtens, kann es nur von Nutzen sein, voranstellte. -

Katalog Roos
Museum Pfalzgalerie Kaiserslautern Johann Heinrich Roos Druckgraphik 29. September bis 3. Dezember 2006 Johann Heinrich Roos Druckgraphik Werke aus der Sammlung Dr. Hans Steinebrei 30. September – 3. Dezember 2006 MUSEUM PFALZGALERIE KAISERSLAUTERN Katalog der ausgestellten Werke Bearbeitung: Hanneke Heinemann Inhalt: Johann Heinrich Roos - Druckgraphik Bemerkungen zum Werk von Johann Heinrich Roos und zu seinem Nachruhm Seite 3 Literatur Seite 10 Katalog Seite 11 Anhang: Saaltexte Seite 69 Schautafeln Seite 76 Bilder der Ausstellung im Oberen Foyer Seite 78 2 Bemerkungen zum Werk von Johann Heinrich Roos und zu seinem Nachruhm Vorwort Der in der Pfalz geborene Maler und Radierer Johann Heinrich Roos war berühmt für seine Tierbilder, aber auch seine Porträts waren bei seinen adeligen und bürgerlichen Auftrag- gebern sehr geschätzt. Am Anfang des 19. Jahrhunderts erzielten seine Gemälde weit hö- here Preise als beispielsweise die eines Salomon van Ruysdael und eines Franz Hals. Seine Werke lagen damit auf demselben Preisniveau wie diejenigen von Jan Vermeer 1. Erst mit der zunehmend negativen Einschätzung der barocken Kunst gegen Ende des 19. Jahrhun- derts schwächt sich das Interesse an Roos’ Werk ab. Das Museum Pfalzgalerie Kaiserslautern zeigt in der Ausstellung zum 375. Geburtstag Jo- hann Heinrich Roos’ virtuos gezeichnete Radierungen, die bis weit in das 19. Jahrhundert hinein nicht nur in renommierten Sammlungen sondern auch in Künstlerateliers geschätzt und studiert wurden. Die zweite Hälfte der Ausstellung präsentiert Stiche und Kopien von ausgezeichneter Qualität nach Roos’ Werken. Sie zeigen die Rezeption seiner Gemälde und Zeichnungen bei Künstlern und Sammlern über einen Zeitraum von mehreren Jahr- hunderten. Der gekonnt aquarellierte „Braune Stier“ von Wilhelm Kobell (Katalognr. -

Flyer 04 14.Indd
Der Landkreis Kusel lädt Sie herzlich zur 2014er Auflage des Johann Heinrich Roos - Projektes „Kunst im Grünen“ ein. Bedeutendster Tiermaler des deutschen Barock Kunst im Grünen Entdecken Sie rund um die Wasserburg in Reipoltskirchen neue Bilder in der Er ist wohl einer der bedeutendsten Künstler, den die Pfalz bis heute Landschaft. Am Taufort des Tiermalers Johann Heinrich Roos haben sich hervorgebracht hat: Der Maler und Graphiker Johann Heinrich Roos, die Künstler diesmal auf die Spuren des Tiermalers selbst gemacht. Die geboren am 29. September 1631 wohl in Otterberg, lutherisch getauft Wasserburg mit Bergfried und Malschule bildet einen adäquaten Rahmen wenig später in Reipoltskirchen. Im Laufe der Wirren des 30jährigen für die entstandenen Kunstwerke, außerdem sind in der Malschule auch Krieges verschlägt es die Familie zunächst nach Zweibrücken, später an Bilder von Johann Heinrich Roos‘ eigener Hand zu sehen. den Niederrhein und schließlich nach Amsterdam. Dort beginnt der junge Johann Heinrich 1647 eine Malerlehre bei dem Historienmaler Guilliam Über die eher vergängliche Kunst im Grünen hinaus geht unser Dujardin und wird in der Folge stark von den holländischen Meistern Auf den Spuren Skulpturenweg, der für dieses Jahr zu einem echten Rundweg ausgebaut Nicolaes Berchem und Karel Dujardin beeinflusst. wurde: Die Brücke des belgischen Künstlers Marc de Roover werden Ab 1651 ist Roos wieder in Deutschland. Es wird vermutet, dass er in von wir zusammen mit der Kunst im Grünen eröffnen. Und noch eine dieser Zeit auch nach Italien reist, belegt werden kann ein Italienaufenthalt weitere künstlerische Arbeit wartet auf ihre Enthüllung: Mit der Stele jedoch nicht. 1654 ist Roos zusammen mit seinem Bruder Theodor am des Luxemburger Bildhauers Bertrand Ney wird der Skulpturenweg zu Hof des Landgrafen Ernst von Hessen in Rheinfels nachweisbar. -

№ 13 – the KITCHEN STAIRCASE 1. Console
№ 13 – THE KITCHEN STAIRCASE 1. Console - table. Germany, early 18th c. 2. Vase. China, 18th c. Brass mount – Europe, 19th c. 3. Mirror. Russia, 4th quarter of the 19th c after the original of Gustave Doret, 1877 4. Unknown artist. Settlement Near the Ford. Holland, 2nd half of the 17th c. 5. Unknown artist. Abraham’s Sacrifice. Germany (?), late 18th c. A copy 6. Unknown artist, flemish school. Spanish Cavalryman. 3rd quarter of the 17th c. 7. Unknown artist, flemish school. Spanish Cavalryman. 3rd quarter of the 17th c. 8. Console – table. A copy from the german original of early 18th c. Latvia, 1981 9. Unknown sculptor. Austrian generalissimo Ernst Gideon von Laudon (?). Latvia, 2nd half of the 18th c. 10. Wallsconces. Copies after the russian18th century pattern 11. Latern. A copy from the18th century lantern in the Kuskovo Palace, Moscow № 70 - THE ANTECHAMBER OF THE GOLD HALL 1. Cartel clock. France, Chateaudun, clockmaker Godeau, 2nd half of the 18th c. 2. Unknown artist, russian school. Elizabeth Petrovna, Empress of Russia. 18th c. 3. Jan de Bray (?). Artemisia. Netherlands, mid of the 17th c. 4. Unknown artist. The Finding of Moses. Flanders, 17th c. 5. Unknown artist. Juno at the Corpse of Argus. Italy, late 17th c. 6. Chairs (10). Germany/Belgium, Aachen-Liège, 18th c. 7. Thomass Huber. Painter Friedrich Wilhelm Weidemann. Germany, 1743 Chandelier. A copy from the original 18th century chandelier in the Kuskovo Palace, Russia № 74 - THE BLUE ROOM 1. Mirror. Germany, 1st quarter of the 18th c. 2. Vase. China, 18th c. 3. Console table. -
Südliche Landschaft Mit Hirten Und Herde, Wohl Mitte Oder 2. Hälfte 18
Johann Heinrich Roos, Kopie von unbekannter Hand Südliche Landschaft mit Hirten und Herde, wohl Mitte oder 2. Hälfte 18. Jh. Pr645a / M – / ohne Kasten Historisches Museum Frankfurt (17.05.2021) 1 / 5 Johann Heinrich Roos Otterberg/Pfalz 1631–1685 Frankfurt Der Sohn eines Tünchers gelangte mit seinen Eltern durch die Wirren des Dreißigjährigen Krieges von der Pfalz nach Amsterdam. Hier ging er 1647/1651 bei verschiedenen Malern in die Lehre, wurde insbesondere jedoch durch die jungen Künstler ĺ Nicolaes Berchem und Karel Dujardin (um 1622–1678) beeinflusst. Fortan waren, neben hochbarocken Porträts, italianisierende Landschaften und idyllische Hirtenstücke der Schwerpunkt seines Schaffens. Ab 1653 lebte Roos in Mainz, Heidelberg und St. Goar, und ließ sich 1667 in Frankfurt nieder, wo er als Tier- und Landschaftsmaler reüssierte und 1668 als Beisasse dauerhaftes Bleiberecht erhielt (abgeliefertes Aufnahmestück: Verkündigung an die Hirten, HMF, B0003). Auch sein Bruder Theodor Roos (1638–1698) und die Söhne Philipp Peter (1657–1706) und ĺ Johann Melchior sowie weitere Nachfahren widmeten sich der Tier- und Porträtmalerei. Die Künstlerfamilie entfaltete nachhaltigen Einfluss auf die deutsche Barockmalerei und war in allen bedeutenden Gemäldesammlungen der Zeit vertreten. Johann Heinrich Roos starb an den Folgen eines Brands seines Wohnhauses auf der Frankfurter Zeil. Werke im Prehn'schen Kabinett Pr496, Pr645a,b,c Literatur Jedding 1955 (Wvz.); Jedding 1998 (auch zur Familie, mit weiterer Lit.); AKL, Bd. 99 (2018), S. 364 _____________________________ Technologischer Befund (Pr645a) Ölhaltige Malerei auf Eisen H.: 11,9 cm; B.: 13,0 cm; T.: ca. 0,08 cm Seiten mit ausgeprägten Blechscherengraten; linke Seite beschnitten. Zweischichtige, ölhaltige Grundierung; zuerst grobkörnige, ockerfarbene sehr dicke, darauf weiße, dünne Schicht. -
CAJETAN ROOS (Rome 1690 – 1770 Vienna) Noah's Ark on Canvas, with A
VP4570 CAJETAN ROOS (Rome 1690 – 1770 Vienna) Noah’s Ark On canvas, with a shaped top, 84¼ x 57½ ins. (214 x 146 cm) PROVENANCE Private Collection, France, since at least the nineteenth century NARRATIVE Cajetan Roos, or Gaetano Rosa, as he was known, came from a large family of German painters. Five generations of the family painted animals, landscapes and portraits, beginning with Johann Heinrich Roos (1631-1685) and ending with his great-great-grandson Joseph Roos II (1760-1822). The most famous family members were Johann Heinrich, the father of the dynasty, and his two elder sons Philipp Peter Roos (1657-1706) and Johann Melchior Roos (1663-1731. The author of this painting, Cajetan Roos, was the son and pupil of Philip Peter Roos. Like many artists who lived during the seventeenth century, a period when much of Europe was disrupted by wars and religious strife, the Roos family moved about frequently in pursuit of their careers. Johann Heinrich was born in Germany in 1631, but trained in Amsterdam. He specialised in idyllic pastoral scenes with herdsmen and livestock in the manner of such Dutch Italianate painters as Nicolaes Berchem and Karel Dujardin. His eldest son Philipp Peter Roos was born in Frankfurt am Main and trained with his father before going to Italy in 1677. In Rome, he became a member of the Schildersbent, the fraternity of Northern painters in Rome, and was given the nickname, “Mercurius”. In 1681, he married Maria Isabella, daughter of the painter Giacinto Brandi. Subsequently he bought a large house in Tivoli, which gave rise to his soubriquet “Rosa da Tivoli”, where he is said to have kept a menagerie of animals so that he could draw them from life. -
Engraving and Etching; a Handbook for The
CORNELL UNIVERSITY LIBRARY GIFT OF Geoffrey Steele FINE ARTS Cornell University Library NE 430.L76 1907 Engraving and etching; a handbook for the 3 1924 020 520 668 Cornell University Library The original of tiiis book is in tine Cornell University Library. There are no known copyright restrictions in the United States on the use of the text. http://www.archive.org/details/cu31924020520668 ENGRAVING AND ETCHING ENGRAVING AND ETCHING A HANDBOOK FOR THE USE OF STUDENTS AND PRINT COLLECTORS BY DR. FR. LIPPMANN LATE KEEPER OF THE PRINT ROOM IN THE ROYAL MUSEUM, BERLIN TRANSLATED FROM THE THIRD GERMAN EDITION REVISED BY DR. MAX LEHRS BY MARTIN HARDIE NATIONAL ART LIBRARY, VICTORIA AND ALBERT MUSEUM WITH 131 ILLUSTRATIONS ^ „ ' Us NEW YORK: CHARLES SCRIBNER'S SONS^;.,j^, 153—157 FIFTH AVENUE 1907 S|0 PRINTED BY HAZELL, WATSON AND VINEY, LD. LONDON AND AYLESBURY, ENGLAND. PREFACE TO THE FIRST EDITION '' I ^HE following history of the art of engraving closes -*• approximately with the beginning of the nine- teenth century. The more recent developments of the art have not been included, for the advent of steel- engraving, of lithography, and of modern mechanical processes has caused so wide a revolution in the repro- ductive arts that nineteenth-century engraving appears to require a separate history of its own and an entirely different treatment. The illustrations are all made to the exact size of the originals, though in some cases a detail only of the original is reproduced. PREFACE TO THE THIRD EDITION FRIEDRICH LIPPMANN died on October 2nd, to 1903, and it fell to me, as his successor in office, undertake a fresh revision of the handbook in preparation for a third edition. -

Old Master Paintings New Bond Street, London | 5 December 2018
Old Master Paintings New Bond Street, London | 5 December 2018 Specialists for this auction Europe Andrew McKenzie Director, Head of Department, London Caroline Oliphant Group Head of Pictures, London Lisa Greaves Department Director and Head of Sale, London Poppy Harvey-Jones Specialist, London Bun Boisseau Junior Cataloguer, London Brian Koetser Consultant, London North America Mark Fisher Director, European Paintings, Los Angeles Madalina Lazen Senior Specialist, European Paintings, New York Bonhams 1793 Limited Bonhams International Board Bonhams UK Ltd Directors Registered No. 4326560 Malcolm Barber Co-Chairman, Colin Sheaf Chairman, Gordon McFarlan, Andrew McKenzie, Registered Office: Montpelier Galleries Colin Sheaf Deputy Chairman, Harvey Cammell Deputy Chairman, Simon Mitchell, Jeff Muse, Mike Neill, Montpelier Street, London SW7 1HH Matthew Girling CEO, Emily Barber, Antony Bennett, Charlie O’Brien, Giles Peppiatt, India Phillips, Patrick Meade Group Vice Chairman, Matthew Bradbury, Lucinda Bredin, Peter Rees, John Sandon, Tim Schofield, +44 (0) 20 7393 3900 Asaph Hyman, Caroline Oliphant, Simon Cottle, Andrew Currie, Veronique Scorer, Robert Smith, James Stratton, +44 (0) 20 7393 3905 fax Edward Wilkinson, Geoffrey Davies, James Knight, Charles Graham-Campbell, Matthew Haley, Ralph Taylor, Charlie Thomas, David Williams, Jon Baddeley, Jonathan Fairhurst, Leslie Wright, Richard Harvey, Robin Hereford, Michael Wynell-Mayow, Suzannah Yip. Rupert Banner, Shahin Virani, Simon Cottle. Charles Lanning, Grant MacDougall, Old Master -

Annual Report 1991
National Gallery of Art 1991 ANNUAL REPORT IB 1991 ANNUAL REPORT 1991 ANNUAL REPORT National Gallery of Art Copyright © 1992. Board of Trustees, National Gallery of Art All rights reserved. No part of this publication may be reproduced without the written permission of the National Gallery of Art, Washington, D.C. 20565 Photographs on p. 33, © August Sander Archive; p. 46, © Robert Frank; and p. Ill, © Estate of Walker Evans This publication was produced by the Editors Office, National Gallery of Art Edited by Tarn L. Curry Designed by Susan Lehmann, Washington, D.C. Printed by Schneidereith & Sons, Baltimore, Maryland The type is Bodoni Book, set by BG Composition, Baltimore, Maryland Photo credits: Dean A. Beasom, this page and pp. 19, 20, 23, 25, 26, 29, 31, 33, 42, 46, 69, 71, 73, 78, 92,97, 111, 128 Dennis Brack, Black Star, p. 100 Kathleen Buckalew, pp. 2-3, 50, 75 Richard A. Carafelli, pp. 7, 36, 40, 57, 83, 88, 95 Jacques-Louis David, Thirius de Pautrizel, c. 1795 Philip A. Charles, pp. 8, 17, 37, 41, 48, 55, Gift of Walter H. and Leonore Annenberg, in Honor of the 86, 109 Fiftieth Anniversary of the National Gallery of Art, Jose Naranjo, p. 11 1990.47.2 James Pipkin, cover William D. Wilson, p. 106 ISBN 0-89468-174-5 Pages 2-3: Installation of "animobiles" by Alexander Calder, 1970-1976 Gift of Mrs. Paul Mellon, 1991.7.6-15 Contents President's Preface 6 Administration Director's Report 9 Protection Services 87 Publication Sales 88 Art Programs Gallery Architect 90 Acquisitions 15 Facilities Management 91 Renaissance Paintings -

Die Menagerie Des Landgrafen Karl
Die Menagerie des Landgrafen Karl Ein Beitrag zur Einheit von Natur und Kunst im Barockzeitalter Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades eines Doktors der Philosophie (Dr. phil.) an der Universität Kassel im Fachbereich Kunstwissenschaften vorgelegt von Petra Werner M. A. Datum der Disputation: 29. Januar 2013 INHALT TEIL I: EINLEITUNG...................................................................................................5 1. Zum Thema ............................................................................................................5 2. Forschungsstand ................................................................................................10 TEIL II: TIERGÄRTEN UND MENAGERIEN VON IHREN URSPRÜNGEN BIS ENDE DES 18. JAHRHUNDERTS IN EUROPA..........................................14 1. Über die Anfänge der Wildtierhaltung bis zum Ende des Mittelalters ............14 2. Exotische Tiere an den Höfen der Renaissancefürsten...................................17 3. Barocke Menagerien ...........................................................................................20 4. Ausblick: Die Gründung der Zoologischen Gärten im 19. Jahrhundert .........26 TEIL III: HÖFISCHE TIERHALTUNG IN KASSEL ...................................................29 1. Die Haltung von fremdländischen Tieren in Kassel vom 15. bis Mitte des 17. Jahrhunderts .................................................................................................29 1.1 Landgraf Philipp, der Großmütige (reg. 1518-1562)........................................29