Wie Carsharing Städte Entlastet
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Carsharing 2025 – Nische Oder Mainstream?
CarSharing 2025 – nische oder MainStreaM? Sebastian Riegler, Maria Juschten, Reinhard Hössinger, Regine Gerike, Lars Rößger Bernhard Schlag, Wilko Manz, Christoph Rentschler, Johanna Kopp Mit diesem Bericht werden die Ergebnisse einer Grundlagenstudie zu neuen Nutzungskonzepten für individuelle Mobilität zusammengefasst. Das Projekt wurde beauftragt durch das Institut für Mobilitätsforschung (ifmo) und durchgeführt vom Institut für Verkehrswesen der Universität für Bodenkultur Wien, dem Lehrstuhl für Verkehrspsychologie der Technischen Universität Dresden und der INOVAPLAN GmbH. Die Studienautoren danken allen Carsharing-Anbietern, die die Studie unterstützt und sie dadurch erst ermöglicht haben. Universität für Bodenkultur Wien, Institut für Verkehrswesen: Sebastian Riegler, Maria Juschten, Dr. Reinhard Hössinger, Prof. Regine Gerike Technische Universität Dresden, Lehrstuhl für Verkehrspsychologie: Lars Rößger, Prof. Bernhard Schlag INOVAPLAN GmbH: Dr. Wilko Manz, Christoph Rentschler Design: Bernhard Moosbauer, www.exsample.org © 2016 ifmo 4 CARShARing 2025 – nischE oDER MAinstream? 5 Inhalt Vorwort 6 Kapitel 4 Ist Carsharing für meine Wege geeignet? 71 Danksagung 7 a. Wofür wird Carsharing genutzt? 72 Executive Summary 8 Planung der Buchungen: Spontanität vs. Vorausdenker 72 Beginnzeiten der Fahrten: After-Work vs. Afternoon Tea 73 Kapitel 1 Einleitung 11 Fahrtweiten: Nahverkehr vs. Langstrecke 74 a. Grundlagen des Teilens und Nutzens 12 Start & Ziel der Fahrten: Innerstädtisch vs. Fahrten ins Grüne 76 Teilen, Nutzen, Besitz, Eigentum – Begriffsklärung 12 Fahrtzwecke: Freizeit & nach Hause vs. Einkauf & Ausflug 77 Welche Motive bedienen Eigentum und eigentumslose Nutzung? 14 Alternative zu Carsharing: zu Fuß und eigener Pkw vs. Erweiterung der Mobilität 78 b. Was unterscheidet Carsharing von anderen Formen der Pkw-Nutzung? 17 Verzicht auf Carsharing: Parkplatzproblematik vs. Umweltgedanke 80 c. Die Forschungsfrage: Was wollen wir erreichen? 19 b. -

Carsharing Boomt in Stuttgart Thomas Schwarz
KurzberichteKurzbericht Statistik und Informationsmanagement, Monatsheft 7/2015 Carsharing boomt in Stuttgart Thomas Schwarz Seit der Entwicklung des Prinzips des Abbildung 1: Fahrzeuge und Kunden der stadtmobil carsharing AG in Stuttgart 2005 bis 2015 Carsharings 1987 in Zürich, also des Teilens von Autos mit anderen Men- Fahrzeuge Kunden schen, hat diese Art der Autonutzung Anzahl Anzahl in vielen Städten und Gemeinden Ein- 400 7000 zug gehalten und die Zahl der Nutzer 360 wie die der angebotenen Fahrzeuge 6000 6060 ist rapide angestiegen. Was man 300 5000 sonst eher aus dem Urlaub kennt, ein Fahrzeug am Urlaubsort zu mieten, 200 4000 wird immer mehr auch im Alltag prak- tiziert. In Deutschland geht man aktu- 3000 ell von über 1 Mio. Carsharern aus.1 100 99 2000 2044 Grundsätzlich unterscheidet man stati- 0 0 onsbasierte und stationsunabhängige 2005 07 09 11 13 3/2015 2005 07 09 11 13 3/2015 („free floating“) Carsharing-Ange- bote. 37 Prozent der Fahrberechtigten nutzen stationäre Anbieter wie Flinkster 196 (Dt. Bahn), Stadtmobil oder Cambio2 Quelle: stadtmobil carsharing AG und 63 Prozent fl exible Anbieter wie car2go (Daimler) oder Drive Now Landeshauptstadt Stuttgart, Statistisches Amt (BMW).3 Bei der Anzahl der Fahrzeuge ist das Verhältnis mit 58 zu 42 Prozent umgekehrt. Das ergibt ein Verhältnis 2000 in eine Aktiengesellschaft um- Stuttgart ist damit nach Karlsruhe und von Fahrberechtigten je Auto von 42 gewandelt wurde. Die stadtmobil car- vor Frankfurt die deutsche Großstadt bei stationsbasierten und von 103 bei sharing AG konzentrierte sich fortan mit der zweithöchsten Carsharing- stationsunabhängigen Anbietern. Letz- auf den Ausbau des Angebots in Dichte.5 tere werden auch nur in 13 Großstäd- Stuttgart, der weiterhin existierende ten angeboten, während stationäres Verein stadtmobil e.V. -

The Impact of Carsharing on Car Ownership in German Cities
Available online at www.sciencedirect.com ScienceDirect Transportation Research Procedia 19 ( 2016 ) 215 – 224 International Scientific Conference on Mobility and Transport Transforming Urban Mobility, mobil.TUM 2016, 6-7 June 2016, Munich, Germany The Impact of Carsharing on Car Ownership in German Cities Dr. Flemming Giesel*, Dr. Claudia Nobis German Aerospace Center (DLR), Institute of Transport Research, Rutherfordstraße 2, 12489 Berlin, Germany Abstract Carsharing, currently growing strongly in Germany, is an important instrument for sustainable urban mobility. The present boom is mainly due to so-called “free-floating carsharing”. Whilst the environmental effects of station-based carsharing have been intensively studied in the German-speaking context, to date there have been hardly any empirical findings on the effect of free- floating carsharing. Using the example of DriveNow and Flinkster in Berlin and Munich, this article examines to what extent free-floating carsharing leads to a reduction of car ownership compared to station-based carsharing. Based on online surveys (n=819/227) carried out within the “WiMobil” project (9/2012 – 10/2015), descriptive analyses and two binary logistic regressions were performed. The findings show that station-based and free-floating carsharing leads to a reduction of private cars but to different degrees (DriveNow 7%; Flinkster 15%). The shedding of cars is influenced by the frequency of use of carsharing and the increasing membership of station-based carsharing providers. Furthermore, for many people of both systems carsharing is an important reason not to buy a car. But there is also a significant proportion of people planning a car purchase. This is true especially for car-savvy persons for whom car ownership is very important. -

2 Impact of Carsharing on User and Mobility Behaviour BCS Gunnar
Mobility behaviour in different car sharing variants SHARE North Webinar, 15 March 2019 Gunnar Nehrke, Bundesverband CarSharing e.V. This project has received funding from the Horizon 2020 programme under grant agreement n°769513 Car sharing in Germany Car sharing market (as of 01.01.2019) – 20.200 Car sharing cars – 2.460.000 Customers – 740 Cities with car sharing (7 big cities with free-floating services) – 165 Operators Bundesverband CarSharing e.V. – since 1998 – 151 Operators This project has received funding from the Horizon 2020 programme under grant agreement n°769513 Market segments in Germany Number of customers Biggest operators (by number of vehicles) Free-floating Roundtrip Roundtrip Free-floating Number of vehicles This project has received funding from the Horizon 2020 programme under grant agreement n°769513 Impact of car sharing on urban mobility Less space consumption: Up to 20 private cars substituted by 1 car sharing car* *Result for roundtrip car sharing in 16 inner city areas in Germany bcs 2016 This project has received funding from the Horizon 2020 programme under grant agreement n°769513 Impact of car sharing on urban mobility Change of mobility behaviour: More trips done with sustainable modes Subjective change in travel behaviour in households that got car-free directly before or after joining car sharing. Results for roundtrip car sharing in 16 inner city areas in Germany bcs 2016 This project has received funding from the Horizon 2020 programme under grant agreement n°769513 STARS case study in Germany Aim: -

Sixt SE Annual Report 2019 \\ Content 1
Annual Report 2019 Annual Report 2019 SIXT_Umschlag_Geschaeftsbericht_2019_RZ.indd 4-6 24.03.20 20:13 THE SIXT GROUP IN FIGURES in EUR million 2019 2018 Change 2019 on 2017 2018 in % Revenue 3,306 2,930 12.9 2,603 Thereof in Germany 1,717 1,621 5.9 1,515 Thereof abroad 1,590 1,308 21.5 1,088 Thereof operating1 2,945 2,599 13.3 2,309 Thereof rental revenue 2,248 1,940 15.9 1,687 Thereof leasing revenue 223 235 -5.1 227 Earnings before net finance costs and taxes (EBIT) 380 373 1.8 325 Earnings before taxes (EBT) 337 535 -36.9 287 Consolidated profit 247 439 -43.8 204 Net income per share (basic) Ordinary share (in EUR) 4.97 9.07 -45.1 4.09 Preference share (in EUR) 5.02 9.09 -44.7 4.11 Total assets 6,249 5,193 20.3 4,491 Lease assets 1,120 1,204 -7.0 1,219 Rental vehicles 3,033 2,605 16.4 2,076 Equity 1,592 1,442 10.4 1,178 Equity ratio (in %) 25.5 27.8 -2.3 points 26.2 Non-current financial liabilities 2,653 2,291 15.8 1,700 Current financial liabilities 785 449 74.8 591 Dividend per share Ordinary share (in EUR) -2 2.15 -100.0 4.00 Preference share (in EUR) 0.052 2.17 -97.7 4.02 Total dividend, net 0.82 101.3 -99.2 188.1 Number of employees3 8,748 7,540 16.0 6,685 Number of locations worldwide (31 Dec.)4 2,111 2,174 -2.9 2,211 Thereof in Germany 531 518 2.5 517 1 Revenue from rental and leasing business, excluding revenue from the sale of used vehicles 2 Proposal by the management 3 Annual average 4 Including franchise countries CONTENT A TO OUR SHAREHOLDERS 3 A.1 Letter to the shareholders 3 A.2 Report of the Supervisory Board 6 A.3 -
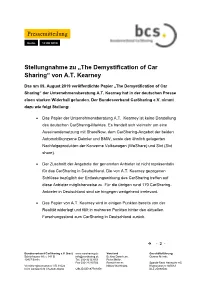
The Demystification of Car Sharing“ Von A.T
Pressemitteilung Berlin 12.08.2019 Stellungnahme zu „The Demystification of Car Sharing“ von A.T. Kearney Das am 09. August 2019 veröffentlichte Papier „The Demystification of Car Sharing“ der Unternehmensberatung A.T. Kearney hat in der deutschen Presse einen starken Widerhall gefunden. Der Bundesverband CarSharing e.V. nimmt dazu wie folgt Stellung: Das Papier der Unternehmensberatung A.T. Kearney ist keine Darstellung des deutschen CarSharing-Marktes. Es handelt sich vielmehr um eine Auseinandersetzung mit ShareNow, dem CarSharing-Angebot der beiden Automobilkonzerne Daimler und BMW, sowie den ähnlich gelagerten Nachfolgeprodukten der Konzerne Volkswagen (WeShare) und Sixt (Sixt share). Der Zuschnitt der Angebote der genannten Anbieter ist nicht repräsentativ für das CarSharing in Deutschland. Die von A.T. Kearney gezogenen Schlüsse bezüglich der Entlastungswirkung des CarSharing treffen auf diese Anbieter möglicherweise zu. Für die übrigen rund 170 CarSharing- Anbieter in Deutschland sind sie hingegen weitgehend irrelevant. Das Papier von A.T. Kearney wird in einigen Punkten bereits von der Realität widerlegt und fällt in mehreren Punkten hinter den aktuellen Forschungsstand zum CarSharing in Deutschland zurück. - 2 - Bundesverband CarSharing e.V. (bcs) www.carsharing.de Vorstand Geschäftsführung Schönhauser Allee 141 B [email protected] Bettina Dannheim, Gunnar Nehrke 10437 Berlin Tel. 030-92123353 Peter Meiler, Fax 030-22320704 Bernd Kremer, Sparda-Bank Hannover eG Vereinsregisternummer VR 31024 Niklas Wachholtz, Kontonummer 925063 beim Amtsgericht Charlottenburg USt-ID DE197701058 BLZ 25090500 - 2 - Unter anderem behaupten die Autor*innen von A.T. Kearney: CarSharing lässt sich nur in einigen dicht besiedelten Stadtteilen weniger deutscher Großstädte mit mehr als 500.000 Einwohner*innen wirtschaftlich betreiben. Diese Annahme ist durch die Realität bereits widerlegt. -

Car Sharing in Europe Business Models, National Variations and Upcoming Disruptions
Car Sharing in Europe Business Models, National Variations and Upcoming Disruptions Dawn of a new era market is committed to offering personal Uber, DriveNow and car2go have experi- Future mobility is a pervasive theme – a convenience and social improvement. enced, and are still experiencing, significant development which is still in its fledgling growth and are unquestionably among stage and has not yet reached its peak by Deloitte’s recent Global Automotive the defining phenomena of our future a long way. Mega-trends, technology-led Consumer study highlighted the fact that mobility as well as the digital era. These innovation, and regulatory conditions Gen Y (those born between 1977 and 1994) providers are changing the way individuals are changing the nature of mobility and desires connectivity and convenience move, by seamlessly connecting either bringing strategic and operational oppor- and can choose from an ever-increasing drivers to passengers (taxi, car pooling) tunities as well as challenges for the range of transportation types, alongside or passengers to cars (car sharing). The various automotive players. The sharing vehicle ownership, for getting from A to B. latter is enabled by technology and covers economy is approaching, while disruptive This 2bn strong consumer segment is the specific segments in the overall mobility technologies inspire the emergence of most influential since the Baby Boomers. market by offering a range of transport new business models and set the course The emerging mobility patterns of (young) modes, from flexible one-way journeys to for a new era of (future) mobility. Car adults are shaping an industry in which planned weekend round-trips. -

Fallstudie Car-Sharing
FALLSTUDIE Car-Sharing Fallstudie im Rahmen des Projekts Evolution2Green – Transformationspfade zu einer Green Economy Siegfried Behrendt (IZT) Februar 2017 Eine Kooperation von: Evolution2Green Fallstudie: Car-Sharing I Projektleitung adelphi research gemeinnützige GmbH Alt-Moabit 91 T +49 (0)30-89 000 68-0 www.adelphi.de 14193 Berlin F +49 (0)30-89 000 68-10 [email protected] Projektpartner Borderstep Institut für Innovation und Nachhaltigkeit gemeinnützige GmbH Clayallee 323 T: +49 (0)30 - 306 45 1000 www.borderstep.de 14169 Berlin [email protected] IZT - Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung gemeinnützige GmbH Schopenhauerstr. 26 T: +49 (0) 30 80 30 88-0 www.izt.de 14129 Berlin [email protected] Abbildung Titel:© Pixelbliss - shutterstock.com evolution2green wird gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. © 2017 adelphi, Borderstep, IZT Evolution2Green Fallstudie: Car-Sharing II Die Fallstudie im Überblick Steckbrief Titel der Fallstudie Car-Sharing Kurzbeschreibung Die vorliegende Fallstudie untersucht Car-Sharing bezüglich der Frage, wie Nischenaktivitäten Teil des Mainstreams werden konnten. Thematische Eignung Car-Sharing hat das Potential, durch eine bessere Ausnutzung von Autos Energie und Rohstoffe im Verkehr einzusparen. Innerhalb von rund 30 Jah- ren hat sich das Car-Sharing von vereinzelten Initi- ativen zu kommerziellen Angeboten entwickelt, die eine hohe Wachstumsdynamik aufweisen. Geografische Bezugsebene Deutschland Umsetzungs- bzw. Diffusionsstadium Beschleunigungsphase Geschwindigkeit Langsam -

Carsharing: Mythos, Hype, Chance Verkehrliche Und Ökonomische Bewertung
CARSHARING: MYTHOS, HYPE, CHANCE Verkehrliche und ökonomische Bewertung Von Christian Mehlert und Sylvie Grischkat Sonderdruck aus Neue Mobilität, Herbst 2019 n Deutschland nahm Carsharing bereits 1988 mit dem Pionier StattAuto in Berlin seinen Anfang. Gut zwei Jahrzehnte später betraten Autokonzerne mit car2go (Daimler, 2010) und Dri- veNow (BMW, 2011) den hauptstädtischen Mobilitätsmarkt. IInzwischen sind im Berliner Straßenbild - neben diversen Bike- und Scootersharing-Diensten – die insgesamt rund 5 000 Carsha- ring-Fahrzeuge zahlreicher Anbieter unübersehbar. Diese Entwick- lung, die dem Ridepooling-Hype in deutschen Großstädten ähnelt [1], nehmen die Autoren zum Anlass, einen Überblick über den Berliner Carsharing-Markt zu geben, die ökonomische Tragfähig- keit von Carsharing und dessen verkehrliche Wirkungen zu hinter- fragen sowie Schlussfolgerungen zur flächendeckenden Carsha- Abb. 2: Stadtmobil-Station in der Siedlung Schillerpark unterstützt den Verzicht aufs eigene Auto und fördert nachhaltige Mobilität. Quelle: C. Mehlert ring-Einführung in Stadt und Land zu ziehen. Beim freefloating Carsharing parken die Fahrzeuge stationsfrei im Ge- Begriffe, Varianten, Entwicklung schäftsgebiet des jeweiligen Anbieters. Die Nutzer orten und buchen Beim Carsharing – zu Deutsch: Autoteilen – besitzt man das Auto nicht über ihr Smartphone ein Auto und stellen dieses nach Fahrtende inner- selbst, sondern teilt es sich mit Anderen. Der Carsharing-Anbieter ist in der halb der Gebietsgrenzen wieder ab. Systembedingt sind Reservierungen Regel zugleich Halter des Autos. Bei der Anmeldung schließen die Kunden im Voraus nicht möglich. Die Fahrzeuge stehen häufig nicht verlässlich in mit dem Anbieter einen Rahmenvertrag, innerhalb dessen alle Fahrzeuge der Nähe zur Verfügung, eignen sich dafür aber auch für Spontan- und rund um die Uhr selbstständig buchbar sind. -
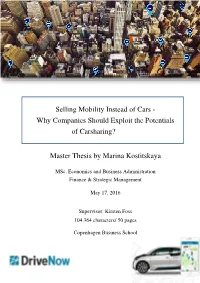
Selling Mobility Instead of Cars - Why Companies Should Exploit the Potentials of Carsharing?
Selling Mobility Instead of Cars - Why Companies Should Exploit the Potentials of Carsharing? Master Thesis by Marina Kostitskaya MSc. Economics and Business Administration Finance & Strategic Management May 17, 2016 Supervisor: Kirsten Foss 104.364 characters/ 50 pages Copenhagen Business School Abstract The following thesis has the aim to provide a practical approach on the concept of carsharing and analyse its growth potential from the perspective of a car manufacturing company. Carsharing represents an innovative and sustainable mobility solution for the future and has already been adopted by a handful of European OEMs. For the purpose of analysing the attractiveness of the carsharing industry the Porter’s 5 forces model has been applied. However, its relevance and application in dealing with an innovative business model has been considered as insufficient and therefore extended by the theory on the disruptive innovation by Clayton Christensen. Last year, the global carsharing market experienced a double-digit growth rate and is expected to grow further in the number of customers and fleet size in the years to come. A comprehensive analysis of the future macroeconomic, societal and technological trends has shown that there will be a huge demand for green, alternative and sustainable mode of transportation particularly in the emerging markets. By putting the focus on the value creation and capturing processes within the automotive industry, the differences between the traditional car sales model and the innovative approach to mobility have been presented on the example of BMW Group and its carsharing service DriveNow. Despite the contradictory approach of systematic innovation pursued by the BMW Group and disruptive innovation by DriveNow, the flawless integration of the innovative business model into the consolidated view as well as a sophisticated portfolio on complementary services enable the company to bypass all the difficulties their smaller competitors are struggling with. -
Who Will Use Electric Vehicles?
A Service of Leibniz-Informationszentrum econstor Wirtschaft Leibniz Information Centre Make Your Publications Visible. zbw for Economics Dütschke, Elisabeth; Schneider, Uta; Peters, Anja Working Paper Who will use electric vehicles? Working Paper Sustainability and Innovation, No. S6/2013 Provided in Cooperation with: Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research ISI Suggested Citation: Dütschke, Elisabeth; Schneider, Uta; Peters, Anja (2013) : Who will use electric vehicles?, Working Paper Sustainability and Innovation, No. S6/2013, Fraunhofer- Institut für System- und Innovationsforschung ISI, Karlsruhe, http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0011-n-2596916 This Version is available at: http://hdl.handle.net/10419/83048 Standard-Nutzungsbedingungen: Terms of use: Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen Documents in EconStor may be saved and copied for your Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden. personal and scholarly purposes. Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle You are not to copy documents for public or commercial Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich purposes, to exhibit the documents publicly, to make them machen, vertreiben oder anderweitig nutzen. publicly available on the internet, or to distribute or otherwise use the documents in public. Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen (insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten, If the documents have been made available under -
Jahresbericht 2011/2012
Bundesverband CarSharingJahresbericht 2011 e.V.2012 Jahresbericht 20112012 Der CarSharing-Markt in Deutsch- land differenziert sich weiter aus Inhalt Der CarSharing-Markt in Deutschland differenziert sich weiter aus 2 Zur CarSharing-Förderung gehören bessere Rahmenbedingungen – Der Nationale Ent- wicklungsplan CarSharing formuliert Erwartungen an die Politik 5 CarSharing ist auch in kleineren Städten und Gemeinden möglich 7 Buchveröffentlichung CarSharing und ÖPNV 9 Positionspapier Elektromobilität und CarSharing 10 EU-Projekt momo Car-Sharing erfolgreich abgeschlossen 11 1 Jahresbericht 20112012 Der CarSharing-Markt in Deutschland differenziert sich weiter aus Die CarSharing-Entwicklung der vergangenen 12 Monate weist zweierlei Tendenzen auf: Einerseits zeigt das klassische, stationsbasierte CarSharing weiterhin erfreuliche Zuwachsra- ten und setzt damit die Wachstumsentwicklung der letzten Jahre kontinuierlich fort. Zum anderen sind im letzten Jahr neue Angebote der Autohersteller auf den Markt gekommen, die sowohl in der öffentlichen Wahrnehmung als auch in den Anmeldezahlen eine erstaunli- che Resonanz erzielen. Das klassische, stationsbasierte CarSharing wächst solide wie bisher Zu Beginn des Jahres 2012 ist die Zahl der CarSharing-Teilnehmer in Deutschland auf 220.000 Fahrberechtigte angestiegen. Das sind 15,8 Prozent oder in absoluten Zahlen 30.000 CarSharing-Nutzer mehr als im Jahr zuvor. Damit setzt sich das erfreuliche Wachs- tum der vergangenen Jahre fort, fällt jedoch in Prozenten gerechnet etwas geringer aus als ein Jahr zuvor. Diesen Nutzern standen zum Jahres- beginn 5.600 Fahrzeuge zur Verfü- gung. Der Zuwachs betrug 12,0 Pro- zent, in absoluten Zahlen sind dies 600 Fahrzeuge mehr als im Vorjahr. Die Fahrzeuge verteilen sich bundes- weit auf 2.700 CarSharing-Stationen. Dies sind 300 Stationen mehr als ein Jahr zuvor und ein Zuwachs um 12,5 Prozent.