Linzer Frauengeschichte 100 Jahre
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Guild Gmbh Guild -Historical Catalogue Bärenholzstrasse 8, 8537 Nussbaumen/TG, Switzerland Tel: +41 52 742 85 00 - E-Mail: [email protected] CD-No
Guild GmbH Guild -Historical Catalogue Bärenholzstrasse 8, 8537 Nussbaumen/TG, Switzerland Tel: +41 52 742 85 00 - e-mail: [email protected] CD-No. Title Composer/Track Artists GHCD 2201 Parsifal Act 2 Richard Wagner The Metropolitan Opera 1938 - Flagstad, Melchior, Gabor, Leinsdorf GHCD 2202 Toscanini - Concert 14.10.1939 FRANZ SCHUBERT (1797-1828) Symphony No.8 in B minor, "Unfinished", D.759 NBC Symphony, Arturo Toscanini RICHARD STRAUSS (1864-1949) Don Juan - Tone Poem after Lenau, op. 20 FRANZ JOSEPH HAYDN (1732-1809) Symphony Concertante in B flat Major, op. 84 JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750) Passacaglia and Fugue in C minor (Orchestrated by O. Respighi) GHCD Le Nozze di Figaro Mozart The Metropolitan Opera - Breisach with Pinza, Sayão, Baccaloni, Steber, Novotna 2203/4/5 GHCD 2206 Boris Godounov, Selections Moussorgsky Royal Opera, Covent Garden 1928 - Chaliapin, Bada, Borgioli GHCD Siegfried Richard Wagner The Metropolitan Opera 1937 - Melchior, Schorr, Thorborg, Flagstad, Habich, 2207/8/9 Laufkoetter, Bodanzky GHCD 2210 Mahler: Symphony No.2 Gustav Mahler - Symphony No.2 in C Minor „The Resurrection“ Concertgebouw Orchestra, Otto Klemperer - Conductor, Kathleen Ferrier, Jo Vincent, Amsterdam Toonkunstchoir - 1951 GHCD Toscanini - Concert 1938 & RALPH VAUGHAN WILLIAMS (1872-1958) Fantasia on a Theme by Thomas Tallis NBC Symphony, Arturo Toscanini 2211/12 1942 JOHANNES BRAHMS (1833-1897) Symphony No. 3 in F Major, op. 90 GUISEPPE MARTUCCI (1856-1909) Notturno, Novelletta; PETER IILYICH TCHAIKOVSKY (1840- 1893) Romeo and Juliet -

Die Zauberflöte
June 4, 2020 – Mozart’s Die Zauberflöte On this week’s Thursday Evening Opera House I'll be presenting everyone’s favorite Mozart Singspiel, Die Zauberflöte (The Magic Flute). It was premiered on September 30, 1791 in Vienna’s Theater auf der Wieden, which was operated by librettist Emanuel Schikaneder (the first Papageno). Mozart’s penultimate opera, it is a fairy tale work overlaid with Masonic and humanist symbolism. Three Ladies (soprano Hildegard Hillebrecht, mezzo-soprano Doris Cvetka Ahlin, contralto Sieglinde Wagner) save Prince Tamino (tenor Fritz Wunderlich) from a monster and give him a portrait of Pamina (soprano Evelyn Lear), daughter of their mistress, the Queen of the Night (soprano Roberta Peters). Tamino falls in love with Pamina’s beautiful image, and the Queen charges him with rescuing her from the hands of the supposedly evil Sarastro (bass Franz Crass), the high priest of Isis. She gives him an enchanted flute to aid him through perils, and sends the bird catcher Papageno (baritone Dietrich Fischer-Dieskau) with him as a guide. On arrival at the Temple of Isis, Tamino is told by the Speaker (bass-baritone Hans Hotter) that only truth and wisdom reside within, and Sarastro bids him enter and learn. Pamina, lusted after by Sarastro’s Moorish slave Monostatos (tenor Friedrich Lenz), returns Tamino’s love, and the two agree to undergo tests to prove their virtue and constancy. Papageno is also tested and even though he makes a poor showing, is rewarded with Papagena (soprano Lisa Otto). With the aid of the magic flute, Tamino and Pamina pass through the ordeals of fire and water. -

Decca Discography
DECCA DISCOGRAPHY >>V VIENNA, Austria, Germany, Hungary, etc. The Vienna Philharmonic was the jewel in Decca’s crown, particularly from 1956 when the engineers adopted the Sofiensaal as their favoured studio. The contract with the orchestra was secured partly by cultivating various chamber ensembles drawn from its membership. Vienna was favoured for symphonic cycles, particularly in the mid-1960s, and for German opera and operetta, including Strausses of all varieties and Solti’s “Ring” (1958-65), as well as Mackerras’s Janá ček (1976-82). Karajan recorded intermittently for Decca with the VPO from 1959-78. But apart from the New Year concerts, resumed in 2008, recording with the VPO ceased in 1998. Outside the capital there were various sessions in Salzburg from 1984-99. Germany was largely left to Decca’s partner Telefunken, though it was so overshadowed by Deutsche Grammophon and EMI Electrola that few of its products were marketed in the UK, with even those soon relegated to a cheap label. It later signed Harnoncourt and eventually became part of the competition, joining Warner Classics in 1990. Decca did venture to Bayreuth in 1951, ’53 and ’55 but wrecking tactics by Walter Legge blocked the release of several recordings for half a century. The Stuttgart Chamber Orchestra’s sessions moved from Geneva to its home town in 1963 and continued there until 1985. The exiled Philharmonia Hungarica recorded in West Germany from 1969-75. There were a few engagements with the Bavarian Radio in Munich from 1977- 82, but the first substantial contract with a German symphony orchestra did not come until 1982. -

Bruckner Journal V3 3.Pdf
Bruckner ~ Journal Issued three times a year and sold by subscription Editorial and advertising: telephone 0115 928 8300 2 Rivergreen Close, Beeston, GB-Nottingham NG9 3ES Subscriptions and mailing: telephone 01384 566 383 4 Lulworth Close, Halesowen, West Midlands B63 2UJ VOLUME THREE, NUMBER THREE, NOVEMBER 1999 Editor: Peter Palmer Managing Editor: Raymond Cox Associate Editor: Crawford Howie In This Issue WORDS AND MUSIC page Concerts 2 Care is taken to ensure that this publication is Matthias Bamert 6 as informative as possible. One of our Scandinavian subscribers was so kind as to say Compact Discs 7 that he read every word. But we are under no Viewpoint 14 illusions that our words are more than a substitute for great music. Rather, what has Book: Celibidache 16 pleased the journal's producers most is the Scores 17 growing network of contacts it has helped to bring about between Bruckner lovers many miles Reflections apart. What's more, music is a performing art, by Raymond Cox 19 and interpretative questions offer rich food for Bruckner's Songs thought and discussion. Surely it is upon by Angela Pachovsky 22 thoughtful, informed debate that the future appreciation of Bruckner depends. Bruckner Letters II by Crawford Howie 26 Some recent events in the publishing world have given more power to our elbow. The Anton Feedback 34 Bruckner Complete Edition (Gesamtausgabe) is now Calendar 36 entering its final stages. Although we operate independently of the International Bruckner Society, we take the view that this Edition is Contributors: the next of immense importance. That does not, however, deadline is 15 January. -

Fliegende Hollander Konwitschny
DER FLIEGENDE HOLLÄNDER Dietrich Fischer-Dieskau Holländer, Marianne Schech Senta, Gottlob Frick Daland, Rudolf Schock Erik, Sieglinde Wagner Mary, Fritz Wunderlich Steuermann. Berliner Staatskapelle, Chor der Deutschen Staatsoper Berlin o.l.v. Franz Konwitschny BERLIN CLASSICS BC 20978-2, Opname: 1960. SCHITTERENDE OPNAME FASCINERENDE DIESKAU Franz Konwitschny's meeslepend theatrale versie sopraan klinkt wat schril, aldus haar pathologische van de Hollander is, mede door de voortreffelijke op- dweperij enigszins beklemtonend. Is zij niet altijd stem- nametechniek (opname in de Berlijnse Grüne- vast en kampt zij soms met intonatieproblemen, haar waldkirche) een feest voor het oor door zijn opvallend vertolking van Senta's ballade is beslist geen kata- transparante orkestklank, rijk aan details, intens en strofe (schitterende Hui !). Fischer-Dieskau, meester briljant in het koper, zoals je dat in een Bayreuth-op- van het Duitse lied, mist het demonische timbre van name niet snel zal horen. Vergelijk maar eens met de een George London of een Hans Hotter om de horror Nelson-versie op Philips van de bejubelde Kupfer-pro- van de vervloekte Hollander gestalte te geven maar duktie uit Bayreuth. Maar ook de Dorati-versie van kompenseert dit gebrek op uitermate overtuigende Covent Garden bijvoorbeeld (eveneens van 1960!) wijze in deze "liedhafte" interpretatie door zijn klinkt hiermee vergeleken bijzonder mat. legendarische intelligentie en geweldige zin voor artikulatie: zijn vertolking klinkt nooit gekunsteld doch De jonge Fritz Wunderlich geeft -

Livres Et Documents Sur Richard Wagner (1813-1883)
LIVRES ET DOCUMENTS SUR Richard WAGNER (1813-1883) (Mise à jour le 25 mars 2013) Médiathèque Musicale Mahler 11 bis, rue Vézelay – F-75008 Paris – (+33) (0)1.53.89.09.10 Médiathèque Musicale Mahler – Bibliographie Wagner / 2013 Livres et documents sur Richard Wagner (1813-1883) LIVRES A : Catalogues, catalogues d'expositions, programmes… 3 B : Ecrits de Richard Wagner, correspondance… 4 C: Biographies, études… 6 D : Ouvrages collectifs, colloques, symposiums… 15 E : Revues… 16 G : Analyses d'œuvres… 17 Wagner dans les ouvrages thématiques… 23 Wagner dans les biographies d'autres compositeurs… 32 PARTITIONS 36 ENREGISTREMENTS SONORES 41 REVUES 64 FONDS D'ARCHIVES 66 ARCHIVES NUMÉRISÉES 75 2 Médiathèque Musicale Mahler – Bibliographie Wagner / 2013 LIVRES BIOGRAPHIES DE RICHARD WAGNER A : catalogues… Bayreuth 1876-1976. - Bayreuth : Festspielleitung Bayreuth, 1976. - (BM WAG A14) Dossier Richard Wagner de Roger Commault. - . - (BM WAG A11 (Réserve)) Exposition Richard Wagner : Musée Galliéra, 24 juin-17 juillet 1966. - Paris : Musée Galliéra, 1966. - (BM WAG A13) Richard Wagner Kalender : Merkbüchlein über Richard Wagner's Leben, Werke und Wirken für alle Tage des Jahres. - Wien : Fromme, 1882. - (BM WAG A5 (Réserve)) Richard Wagners photographische Bildnisse. - München : Bruckmann, 1908. - (BM WAG A7) Wagner e Venezia : catalogo della mostra, Palazzo Vendramin-Calergi, 13 febbraio - 31 luglio 1983. - Venezia : Palazzo Vendramin-Calergi, 1983. - (BM WAG A10) ALLGEMEINER RICHARD-WAGNER-VEREIN. - Bayreuther Taschenkalender für das Jahr 1885. - München : Schmid, 1885. - (BM WAG A5 (Réserve)) ALLGEMEINER RICHARD-WAGNER-VEREIN. - Bayreuther Taschenkalender für das Jahr 1886. - München Leipzig : Schmid : Leede, 1886. - (BM WAG A5 (Réserve)) ASSOCIAZIONE RICHARD WAGNER DI VENEZIA. - Venezia per Wagner : progetto per la fondazione a Venezia di un museo e di un centro internazionale di studi e di ricerche dedicati a Richard Wagner. -

CHAN 3038 BOOK COVER.Qxd 22/8/07 3:26 Pm Page 1
CHAN 3038 BOOK COVER.qxd 22/8/07 3:26 pm Page 1 CHANDOS O PERA I N ENGLISH PETE MOOES FOUNDATION CHAN 3038(4) CHAN 3038 BOOK.qxd 22/8/07 3:29 pm Page 2 Richard Wagner (1813–1883) The Valkyrie AKG First Day of the Festival Play The Ring of the Nibelung Music drama in three acts Poem by Richard Wagner English translation by Andrew Porter Siegmund ....................................................................................................................Alberto Remedios tenor Hunding ............................................................................................................................Clifford Grant bass Wotan ..................................................................................................................Norman Bailey bass-baritone Sieglinde..................................................................................................................Margaret Curphey soprano Brünnhilde........................................................................................................................Rita Hunter soprano Fricka ....................................................................................................................Ann Howard mezzo-soprano Valkyries: Gerhilde ......................................................................................................................Katie Clarke soprano Ortlinde ....................................................................................................................Anne Conoley soprano Waltraute ............................................................................................................Elizabeth -
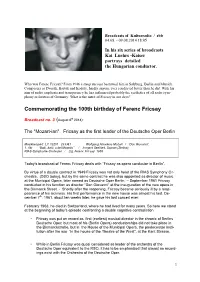
Fricsay As the First Leader of the Deutsche Oper Berlin
Broadcasts of Kulturradio / rbb 04.08. - 09.08.2014 18:05 In his six series of broadcasts Kai Luehrs -Kaiser portrays detailed the Hungarian conductor. Who was Ferenc Fricsay? From 1946 a steep success bestowed him in Salzburg, Berlin and Munich. Composers as Dvorák, Bartók and Kodály, hardly anyone ever conducted better than he did. With his aim of audio emphasis and transparency he has influenced probably the aesthetics of all radio sym- phony orchestras of Germany. What is the merit of Fricsay in our days? Commemorating the 100th birthday of Ferenc Fricsay Broadcast no. 3 (August 6th 2014): The "Mozart-ian". Fricsay as the first leader of the Deutsche Oper Berlin Musikbeispiel: LC 12281 233361 Wolfgang Amadeus Mozart / “Don Giovanni”, 1. Akt “Batti, batti, o bel Masetto” / Irmgard Seefried, Sopran (Zerlina), RIAS-Symphonie-Orchester / Ltg. Ferenc Fricsay 1958 Today's broadcast of Ferenc Fricsay deals with “Fricsay as opera conductor in Berlin”. By virtue of a double contract in 1949 Fricsay was not only head of the RIAS Symphony Or- chestra, (DSO today), but by the same contract he was also appointed as director of music at the Municipal Opera, later named as Deutsche Oper Berlin. – September 1961 Fricsay conducted in his function as director “Don Giovanni” at the inauguration of the new opera in the Bismarck Street. - Shortly after the reopening, Fricsay became seriously ill by a reap- pearance of his sickness. His first performance in the new house was almost his last. De- cember 7th. 1961, about ten weeks later, he gave his last concert ever. February 1963, he died in Switzerland, where he had lived for many years. -

Wolfgang Amadeus Mozart Die Zauberflöte - the Magic Flute • La Flute Enchantée Mp3, Flac, Wma
Wolfgang Amadeus Mozart Die Zauberflöte - The Magic Flute • La Flute Enchantée mp3, flac, wma DOWNLOAD LINKS (Clickable) Genre: Classical Album: Die Zauberflöte - The Magic Flute • La Flute Enchantée Country: Germany Released: 1964 Style: Classical, Opera MP3 version RAR size: 1628 mb FLAC version RAR size: 1798 mb WMA version RAR size: 1357 mb Rating: 4.2 Votes: 308 Other Formats: MOD AHX DTS MP2 MIDI XM AA Tracklist A1 Ouvertüre A2 Erster Aufzug 1. Bis 4. Auftritt B Zweiter Aufzug 27. Bis 30. Auftritt C Erster Aufzug 5. Bis 11. Auftritt D Zweiter Aufzug 13. Bis 26. Auftritt E Erster Aufzug 12. Bis 16. Auftritt F Zweiter Aufzug 1. Bis 12. Auftritt Credits Artwork [Booklet] – Alexander Gnirke Artwork [Box Cover] – Horst Breitkreuz Choir – RIAS-Kammerchor Chorus Master – Günther Arndt Composed By – Wolfgang Amadeus Mozart Conductor – Karl Böhm Directed By, Liner Notes – Gustav Rudolf Sellner Engineer – Günter Hermanns Liner Notes – Andreas Holschneider*, Julia-Lotte Van Dijk, Ursula Von Rauchhaupt Orchestra – Berliner Philharmoniker Photography By – Siegfried Lauterwasser Photography By [Karl Böhm] – Werner Neumeister Producer – Otto Gerdes Recording Supervisor – Wolfgang Lohse Text By – Emanuel Schikaneder Vocals [Dritte Dame] – Sieglinde Wagner Vocals [Dritter Knabe] – Raili Kostia Vocals [Dritter Priester] – Manfred Röhrl Vocals [Erste Dame] – Hildegard Hillebrecht Vocals [Erster Geharnischter Mann] – James King Vocals [Erster Knabe] – Rosl Schwaiger Vocals [Erster Priester] – Hubert Hilten Vocals [Königin Der Nacht] – Roberta Peters Vocals [Monostratos, Ein Mohr] – Friedrich Lenz Vocals [Pamina] – Evelyn Lear Vocals [Papagena] – Lisa Otto Vocals [Papageno] – Dietrich Fischer-Dieskau Vocals [Sarastro] – Franz Crass Vocals [Sprecher] – Hans Hotter Vocals [Tamino] – Fritz Wunderlich Vocals [Zweite Dame] – Cvetka Ahlin Vocals [Zweiter Geharnichter Mann] – Martti Talvela Vocals [Zweiter Knabe] – Antonia Fahberg Vocals [Zweiter Priester] – Martin Vantin Notes Subscription release (SKL catalogue Number) Grey cloth box with title printed on Spine. -

Celebrate Beethoven Catalogue Ludwig Van Beethoven (1770–1827)
CELEBRATE BEETHOVEN CATALOGUE LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770–1827) Born in Bonn in 1770, the eldest son of a singer in the Kapelle of the Archbishop-Elector of Cologne and grandson of the Archbishop’s Kapellmeister, Beethoven moved in 1792 to Vienna. There he had some lessons from Haydn and others, quickly establishing himself as a remarkable keyboard player and original composer. By 1815 increasing deafness had made public performance impossible and accentuated existing eccentricities of character, patiently tolerated by a series of rich patrons and his royal pupil the Archduke Rudolph. Beethoven did much to enlarge the possibilities of music and widen the horizons of later generations of composers. To his contemporaries he was sometimes a controversial figure, making heavy demands on listeners by both the length and the complexity of his writing, as he explored new fields of music. Beethoven’s monumental contribution to Western classical music is celebrated here in this definitive collection marking the 250th anniversary of the composer’s birth. ThisCELEBRATE BEETHOVEN catalogue contains an impressive collection of works by this master composer across the Naxos Music Group labels. Contents ORCHESTRAL .......................................................................................................................... 3 CONCERTOS ........................................................................................................................ 13 KEYBOARD ........................................................................................................................... -

Olandese Impa 2013:Layout 1 25/02/13 15:58 Pagina 1
Olandese impa 2013:Layout 1 25/02/13 15:58 Pagina 1 Manifesto per la prima esecuzione italiana de Il vascello fantasma (L’Olandese volante), Teatro Co- munale di Bologna, 14 novembre 1877 Olandese impa 2013:Layout 1 25/02/13 15:58 Pagina 2 Presidente Virginio Merola Vice Presidente Giorgio Forni Consiglieri Marcello Corvino Francesco Ernani Rino Maenza Virginiangelo Marabini Federico Rossi Giovanni Roversi Revisori dei conti Giovanni Diana Silvio Agnone Luca Mazzanti Sovrintendente Francesco Ernani Consulente artistico Nicola Sani Direttore Principale Michele Mariotti Maestro del Coro Andrea Faidutti Olandese impa 2013:Layout 1 25/02/13 15:58 Pagina 3 FONDATORI DI DIRITTO FONDATORI PRIVATI ORIGINARI Per il Comunale Olandese impa 2013:Layout 1 25/02/13 15:58 Pagina 4 Teatro Comunale di Bologna Richard Wagner Der fliegende Holländer L’Olandese volante coordinatore scientifico e responsabile editoriale Giovanni Gavazzeni In copertina Gilberto Zorio, Canoa che avanza, 2007 Collezione dell’artista / installazione Centro Galego de Arte Contemporanea CGAC Santiago de Compostela, 2010 (foto Mark Ritchie) Redazione, grafica, impaginazione Edizioni Pendragon (Roberta Scaramuzzo) Fondazione Teatro Comunale di Bologna Ufficio Editing Rossana Fioravanti Largo Respighi, 1 40126 Bologna www.comunalebologna.it © 2013 Edizioni Pendragon srl via Borgonuovo, 21/a 40125 Bologna www.pendragon.it L’editore si rende disponibile per gli eventuali aventi diritto sul materiale utilizzato chiuso in tipografia il 26 marzo 2013 dalla Tipografia MODERNA (Bologna) Olandese impa 2013:Layout 1 25/02/13 15:58 Pagina 5 Richard Wagner Der fliegende Holländer L’Olandese volante Olandese impa 2013:Layout 1 25/02/13 15:58 Pagina 6 Una potente evocazione visionaria di energie chimiche e di misteri alchemici al centro del percorso intrapreso dal piemontese Gilberto Zorio, classe 1944. -

Catalogue 2018
CATALOGUE 2018 Cast The Arthaus Musik classical music catalogue features more than 400 productions from the beginning of the 1990s until today. Outstanding conductors, such as Claudio Abbado, Lorin Maazel, Giuseppe Sinopoli and Sir Georg Solti, as well as world-famous singers like Placido Domingo, Brigitte Fassbaender, Marylin Horne, Eva Marton, Luciano Pavarotti, Cheryl Studer and Dame Joan Sutherland put their stamp on this voluminous catalogue. The productions were recorded at the world’s most renowned opera houses, among them Wiener Staatsoper, San Francisco Opera House, Teatro alla Scala, the Salzburg Festival and the Glyndebourne Festival. Unitel and Arthaus Musik are proud to announce a new partnership according to which the prestigious Arthaus Musik catalogue will now be distributed by Unitel, hence also by Unitel’s distribution partner C Major Entertainment. World Sales: All rights reserved · credits not contractual · Different territories · Photos: © Arthaus · Flyer: luebbeke.com Tel. +49.30.30306464 [email protected] Unitel GmbH & Co. KG, Germany · Tel. +49.89.673469-630 · [email protected] www.unitel.de OPERA ................................................................................................................................. 3 OPERETTA ......................................................................................................................... 35 BALLET ............................................................................................................................... 36 CONCERT...........................................................................................................................