Arbeitsm Aterialien
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Landschaftsplan Stadt Wunstorf
Landschaftsplan Wunstorf Auftraggeber Projektleitung Dipl.-Ing. D. Drangmeister Stadt Wunstorf Auftragnehmer Bearbeitung Dipl.-Ing. B. Blanke Planungsgruppe Landespflege Dipl.-Ing. D. Drangmeister Dipl.-Geol. J. Schramm Mitarbeiter Dipl.-Biol. B. Köther Dipl.-Biol. A. Suntrup (Faunistische Erfassungen Vögel) Dipl.-Biol. T. Wagner (Abia) Dipl.-Biol. D. Herrmann (Abia) (Faunistische Erfassungen Lurche) Dipl.-Biol. U. Lobenstein (Faunistische Erfass. Heuschrecken) Dr. T. Buck-Dobrick (Biolagu) Dipl.-Biol. R. Dobrick (Biolagu) (Faunistische Erfassungen Fledermäuse) Dipl.-Ing. J. Feder (Kartierung Flora und Vegetation) Hannover, im Oktober 2002 Kleine Düwelstraße 21 • 30171 Hannover • Tel. (0511) 2836820 • Fax (0511) 2836821 Planungsgruppe Landespflege Landschaftsplan Wunstorf 2002 Danksagung Für mündliche Auskünfte und die Zurverfügungstellung von Daten bedanken wir uns bei Herrn Dipl. Biol. T. BRAND (Ökologische Schutzstation Steinhuder Meer), Herrn K.-H. GIROD (Naturschutzbeauftragter der Stadt Wunstorf, Ornithologe), und den MitarbeiterInnen der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft, Wunstorf (Herrn NAGEL, Herrn KOCH, Frau WILKENING), Herrn Prof. Dr. R. LÖHMER (Tierökologe, TiHo Hannover), Herrn H. OOSTERWIJK (Ornithologe Barsinghausen), Herrn D. SCHLEGEL (Regionalbetreuer für Fledermausschutz des NLÖ). Planungsgruppe Landespflege Landschaftsplan Wunstorf 2002 Inhalt 1 Planungsauftrag und Planungsrahmen ................................................................. 1 2 Überblick über das Planungsgebiet ...................................................................... -
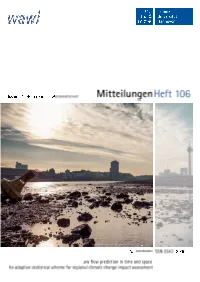
Low Flow Prediction in Time and Space
Low flow prediction in time and space An adaptive statistical scheme for regional climate change impact assessment Von der Fakultät für Bauingenieurwesen und Geodäsie der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover zur Erlangung des akademischen Grades Doktor-Ingenieurin - Dr.-Ing. - genehmigte Dissertation von Anne Fangmann, M.Sc. geboren am 26.07.1986 in Lohne 2017 Referent: Prof. Dr.-Ing. Uwe Haberlandt Korreferent: Assoc. Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Gregor Laaha Tag der Promotion: 01.12.2017 Danksagung Mein Dank richtet sich vor allem an Prof. Dr.-Ing. Uwe Haberlandt. Ohne seine Ideen, sein Wissen und die gute Betreuung während meiner Zeit am Institut für Hydrologie und Wasserwirtschaft wäre diese Arbeit nicht zustande gekommen. Vielen Dank für die Unterstützung, die ständige Motivation und neuen Anregungen, und dafür, dass ich so viel bei Ihnen lernen durfte. Außerdem möchte ich mich bei den Mitgliedern meiner Promotionskommission bedanken: bei Assoc. Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Gregor Laaha für die Übernahme des Korreferats, sowie bei Prof. Dr. rer. nat. Insa Neuweiler und Prof. Dr.-Ing. Karl-Heinz Rosenwinkel als Mitglieder des Promotionskollegiums. Ein großer Dank gilt außerdem Hannes Müller und Bastian Heinrich, die bei allen arbeitsbezogenen und privaten Sorgen zur Stelle waren und mir von Anfang an eine äußerst angenehme Zeit am Institut beschert haben. i Erklärung Hiermit versichere ich eidesstattlich, dass ich 1. die Regeln der geltenden Promotionsordnung kenne und eingehalten habe und mit einer Prüfung nach den Bestimmungen der Promotionsordnung einverstanden bin, 2. die Dissertation selbst verfasst habe, keine Textabschnitte von Dritten oder eigener Prüfungsarbeiten ohne Kennzeichnung übernommen und alle von mir benutzten Hilfsmittel und Quellen in meiner Arbeit angegeben habe, 3. -

Rkcette Nr. 87 (Februar 2013)
Nr. 87 Februar 2013 Rintelner Kanu --- Club e.V . www.rkc-rinteln.de V.i.S.d.P.:Thorsten Schnauder, Tulpenstr.3, 31737 Rinteln [email protected] - Erscheint 2 x jährlich - Druck :Paritätische Lebenshilfe Schaumburg-Weserbergland GmbH. Auflage : 125 Stück Layout : Hacky - RKC Konto: KtoNr. 524 244 282 bei Sparkasse Schaumburg BLZ 255 514 80 NEU ab 2014! IBAN: DE42 2555 1480 0524 2442 82 BIC-/SWIFT-Code: NOLADE21SHG EDITORIAL Hallo liebe Leserin und Leser, da liegt sie wieder vor Euch – die neue RKCette mit den Berichten über das vergangene Jahr. Es ist viel passiert, über das man noch einmal nachlesen kann – weitere Be- richte und Bilder erinnern auch wieder auf unserer Home- page an schönes Fahrten. Drachenbootrennen - Impressionen Der neue Veranstaltungskalender sieht ein reichhaltiges Programm für 2013 vor. Da stehen neben bewährten Fahrten auch einiges Neues oder auch Wichtiges an. So mancher wird sich über die zwei Wochenendsonderar- beitsdienste wundern. Hier sollen die schon lange geplan- ten Sanierungsarbeiten an der Nord- und Ostseite des Bootshauses und weitere größere Aktionen durchgeführt werden. Der Vorstand würde sich über viele hilfreiche Hände freuen. Auch mal wieder im Programm sind die Elbe-Elster-Tour – als Gegenbesuch beim KV Harmonie Elster, die Wildwas- serwoche NRW und Nds. und das Städtekulturwochenen- de, wahrscheinlich in Düsseldorf. Ich bin schon gespannt, wie diese neuen (für einige schon mal dagewesenen) Ver- Um die RKC Mitgliedschaft anstaltungen angenommen werden. haben sich Thomas Eichner, Elke und In und um Rinteln wird man wieder über uns sprechen, wenn die Kinder beim Ferienspaß mit Olli unterwegs sind – Jasmin Kellner sowie Erwin Löhr be- worben. -

EG-Wasserrahmenrichtlinie
EG-Wasserrahmenrichtllinie Bewirtschaftungsplan 2009 für die Flussgebietseinheit Weser EG-Wasserrahmenrichtlinie für dieFlussgebietseinheit Weser 2009 Bewirtschaftungsplan Vorwort Der hier vorliegende Bewirtschaftungsplan für die Flussgebietseinheit Weser ist ein Produkt der en- gen fachlichen und umweltpolitischen Zusammenarbeit der sieben Anrainerländer, die sich in der Flussgebietsgemeinschaft Weser zusammengeschlossen haben, um sich länderübergreifend der Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (EG-WRRL) zu widmen. Rechtlich umgesetzt ist diese Richtlinie über das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) sowie die einzelnen Landeswassergeset- ze- und -verordnungen. Im Rahmen der Einbeziehung der Öffentlichkeit haben die Länder in den vergangenen Jahren auf allen Ebenen (Flussgebietsgemeinschaft – Länderebene – Planungseinheiten) einen ganz erheblichen Aufwand betrieben, um abgestimmte Informationen zusammenzustellen, aufzubereiten und mit Hilfe von Veranstaltungen und Broschüren zu erläutern. Der Bewirtschaftungsplan selbst hat sich vom 22.12.08 - 22.06.09 in der öffentlichen Anhörung befunden. Relevante Änderungswünsche wurden berücksichtigt. Darüber hinaus wurde zusätzlich versucht, den Bericht an verschiedenen Stellen ver- ständlicher zu formulieren und zu gestalten. Der Bericht stellt für die Flussgebietsgemeinschaft Weser einen zusammenfassenden Überblick über die Untersuchungsprogramme, den Ist-Zustand der Wasserkörper, die abgeleiteten Zielvorstellungen sowie das Maßnahmenprogramm dar. Damit wird der Bewirtschaftungsrahmen bei -

Bewirtschaftungsplan Weser
Anhang A - Oberflächenwasserkörper 1 Anhang A - Oberflächenwasserkörper Um eine wasserkörperscharfe Betrachtung herstellen zu können, sind in Tab. A6 die in der Flussgebietseinheit Weser liegenden Oberflächenwasserkörper mit den für sie zutreffenden Attributen sowie zusammenfassenden Angaben zu Ausnahmen aufgeführt. Da für textuelle Einträge bezüglich der Einstufung von Wasserkörpern als erheblich verändert kein ausreichender Platz zur Verfügung steht, ist in der nachfolgenden Tab. A1 die verwendete Abkürzung ange- geben. Tab. A1: Einstufung als erheblich veränderter Wasserkörper (HMWB) Signifikante negative Auswirkung Abkürzung Umwelt im weiteren Sinne 1 Schifffahrt, inkl. Häfen 2 Freizeitnutzung 3 Wasserspeicherung zur Trinkwassernutzung 3 Wasserspeicherung zur Stromerzeugung 4 Wasserspeicherung zur Bewässerung 5 Sonstige Wasserspeicherung 6 Wasserregulierung 7 Hochwasserschutz 8 Landentwässerung 9 Wichtige nachhaltige Entwicklungstätigkeiten des Menschen 10 Andere wichtige nachhaltige Entwicklungstätigkeiten des Menschen: Landwirtschaft 11 Andere wichtige nachhaltige Entwicklungstätigkeiten des Menschen: urbane Nutzung und Infrastruktur 12 Andere wichtige nachhaltige Entwicklungstätigkeiten des Menschen: Landesverteidigung 13 Andere wichtige nachhaltige Entwicklungstätigkeiten des Menschen: Erschließung von Braunkohleabbaugebieten 14 Sonstige wichtige nachhaltige Entwicklungstätigkeiten des Menschen 15 Freistaat Bayern ◆ Freie Hansestadt Bremen ◆ Hessen ◆ Niedersachsen ◆ Nordrhein-Westfalen ◆ Sachsen-Anhalt ◆ Freistaat Thüringen 2 Bewirtschaftungsplan -

Der Niedersächsische Gewässerwettbewerb 2018 Impressum
Der Niedersächsische Gewässerwettbewerb 2018 Impressum Herausgeber Kommunale Umwelt-AktioN UAN Projekt „Wasserrahmenrichtlinien-InfoBörse“ Arnswaldtstraße 28 30159 Hannover Telefon: +49 (0) 511-302 85-60 Fax: +49 (0) 511-302 85-56 E-Mail: [email protected] www.uan.de Redaktion Dr. Katrin Flasche Dr. Nikolai Panckow M. Sc. Nora Schmidt Titelseite Die Fotos auf der Titelseite stammen von (von oben links nach rechts unten): 1. Walter Willemsen, 2. und 3. Maike Hoberg, 4. Walter Mielke Bildnachweise Die verwendeten Fotos stammen, sofern keine andere Quelle benannt wurde, aus den jeweiligen Projekten bzw. von der UAN Layout LA LOUP Medienagentur www.laloup.de Druck Gutenberg Beuys Feindruckerei GmbH www.feindruckerei.de Gedruckt auf 100% Recyclingpapier 2 Träger des Wettbewerbs in Zusammenarbeit mit: 3 Inhalt Grußworte 6 Vorwort 8 Der Wettbewerb 8 Die Teilnehmenden 9 Übersichtskarte der Teilnehmenden 10 Der zeitliche Ablauf 12 Die Bewertungskriterien der Jury 13 Die Bereisung 14 Die Jurymitglieder 15 Die Preisträger 16 Die Preisträger 18 Renaturierung des Beckstedter Bachs 20 Seitengewässer am Mersbach 24 Strukturverbesserungsmaßnahmen in und an der Este 28 Renaturierung des Borgloher Baches 34 Ökologische Umgestaltung des Schierenbachs 38 Gewässerentwicklung und Umweltbildung am Altonaer Mühlbach 42 Lauf-Lopau-Lauf 46 Die Teilnehmenden 50 Mehr biologische Vielfalt an der Ems 51 Renaturierung des Hackenbaches 54 Naturnaher Ausbau des oberen Laher Grabens 57 Der Löninger Mühlenbach fließt in die Zukunft 60 Renaturierung der Ofener Bäke 63 Grüne Flächenbewirtschaftung