Windows Versus Linux: Großstädtische Migrationsprojekte Im Vergleich
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Diplomarbeit Limux
Diplomarbeit LiMux Ist Open-Source-Software eine Alternative für die öffentliche Verwaltung? Überprüfung des Migrationsprozesses der Stadt München von Windows auf Linux anhand eines Kriterienkatalogs Erstellt am: Arbeitsbereich Softwaretechnik Departement Informatik MIN Fakultät Universität Hamburg Erstbetreuer: Dr. Wolf-Gideon Bleek Zweitbetreuer: Prof. Dr.-Ing. Bernd Page Abgabedatum: 02.05.2007 Erstellt von: Benjamin Stukenberg Matrikelnummer: 5498671 Studiengang: Wirtschaftsinformatik Adresse: Rantzaustr. 85, 22926 Ahrensburg Diplomarbeit: LiMux Seite 3 von 65 Danksagung Ich danke meinem Erstbetreuer Dr. Bleek für die Betreuung und für Anregungen für meine Diplomarbeit und meinem Zweitbetreuer Prof. Dr.-Ing. Page für die Zweitbetreu- ung. Ich danke der Stadt München dafür, dass sie auf Open-Source-Software umsteigt und mir somit das Thema meiner Diplomarbeit ermöglicht hat. Insbesondere danke ich dem stellvertretenden Projektleiter des LiMux-Projekts Herrn Lubig-Konzett für das In- terview. Des weiteren danke ich allen Entwicklern von Open-Source-Software, ohne sie wäre diese Diplomarbeit nicht möglich gewesen, d. h. ohne sie hätte ich nicht über dieses Thema schreiben können. Insbesondere danke ich den Entwicklern von OpenOffice.org und Linux, denn ich habe diese Diplomarbeit mit OpenOffice.org unter Linux ohne einen einzigen Absturz verfassen können. Diplomarbeit: LiMux Seite 4 von 65 Inhaltsverzeichnis Tabellenverzeichnis...........................................................................................................6 -

One of the Biggest Aims of Limux Was to Make the City More Independent.”
FEATURE MUNICH Munich city council has migrated 15,000 workers from Windows to Linux. Mike Saunders and Graham Morrison visited the city and learned just how upset Steve Ballmer was… “One of the biggest aims of LiMux was to make the city more independent.” irschgarten, in the west of the last decade. Migrating workers of Munich, is one of Europe’s biggest Germany’s third-largest city was no easy Hbeer gardens, with over 8,000 task and there were plenty of hurdles along places to sit. It’s a spectacular sight in the way, but by and large the project has summer: hundreds of benches as far as been a storming success. the eye can see, trees providing some We’ve been following the progress of shelter from the heat, and a vast number LiMux (Linux in Munich) for years, and now of people relaxing and enjoying the city’s that the project is effectively complete, we famous beers. decided to visit the city and talk to the man But while 8,000 is an impressive number, in charge of it. Read on to discover how it it’s not as impressive as 15,000. That’s all started, how Microsoft tried to torpedo how many people the Munich city council it, and whether other cities in the world can has switched from Windows to Linux over follow Munich’s lead… 52 www.linuxvoice.com MUNICH FEATURE Humble beginnings Cast your mind back to 2001, and the state of Linux at the time. It was well established as a server OS and fairly well known among computing hobbyists, but still a small fish in the desktop pond. -
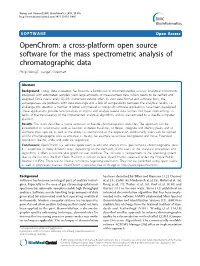
Openchrom: a Cross-Platform Open Source Software for the Mass Spectrometric Analysis of Chromatographic Data Philip Wenig*, Juergen Odermatt
Wenig and Odermatt BMC Bioinformatics 2010, 11:405 http://www.biomedcentral.com/1471-2105/11/405 SOFTWARE Open Access OpenChrom: a cross-platform open source software for the mass spectrometric analysis of chromatographic data Philip Wenig*, Juergen Odermatt Abstract Background: Today, data evaluation has become a bottleneck in chromatographic science. Analytical instruments equipped with automated samplers yield large amounts of measurement data, which needs to be verified and analyzed. Since nearly every GC/MS instrument vendor offers its own data format and software tools, the consequences are problems with data exchange and a lack of comparability between the analytical results. To challenge this situation a number of either commercial or non-profit software applications have been developed. These applications provide functionalities to import and analyze several data formats but have shortcomings in terms of the transparency of the implemented analytical algorithms and/or are restricted to a specific computer platform. Results: This work describes a native approach to handle chromatographic data files. The approach can be extended in its functionality such as facilities to detect baselines, to detect, integrate and identify peaks and to compare mass spectra, as well as the ability to internationalize the application. Additionally, filters can be applied on the chromatographic data to enhance its quality, for example to remove background and noise. Extended operations like do, undo and redo are supported. Conclusions: OpenChrom is a software application to edit and analyze mass spectrometric chromatographic data. It is extensible in many different ways, depending on the demands of the users or the analytical procedures and algorithms. It offers a customizable graphical user interface. -

Information Economy Report 2012: the Software Industry and Developing Countries
UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT INFORMATION ECONOMY REPORT 2012 The Software Industry and Developing Countries New York and Geneva 2012 ii INFORMATION ECONOMY REPORT 2012 PREFACE iii NOTE PREFACE Within the UNCTAD Division on Technology and Logistics, the ICT Analysis Section carries out policy-oriented Information and communications technologies continue to transform our society. In recent years we have seen analytical work on the development implications of information and communication technologies (ICTs). It is dramatically improved access to mobile telephones, the Internet and broadband connectivity throughout the responsible for the preparation of the Information Economy Report. The ICT Analysis Section promotes international developing world. These trends are gradually helping to dismantle barriers towards the goal of an “information dialogue on issues related to ICTs for development, and contributes to building developing countries’ capacities to society for all” agreed by world leaders at the World Summit on the Information Society. measure the information economy and to design and implement relevant policies and legal frameworks. Such a society depends on software. The growing emphasis on ICTs in the delivery of government, healthcare, In this Report, the terms country/economy refer, as appropriate, to territories or areas. The designations education and other goods and services demands customized applications. Countries therefore need the employed and the presentation of the material do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part capacity to adopt, adapt and develop relevant software. Such capacity is also important to facilitate successful of the Secretariat of the United Nations concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its technology transfer. -

국내 SW생태계 견실화 저해요인 및 개선 방안 연구 (A Study on Improving Restraints of SW Industry)
방송통신정책연구 14-진흥-021 국내 SW생태계 견실화 저해요인 및 개선 방안 연구 (A study on improving restraints of SW industry) 임춘성/이현승/양병석/김윤명/김준연/이수현 2014. 12 연구기관 : 소프트웨어정책연구소 - i - 이 보고서는 2014년도 미래창조과학부 방송통신발전기금 방송통신 정책연구사업의 연구결과로서 보고서 내용은 연구자의 견해이며, 미래창조과학부의 공식입장과 다를 수 있습니다. 제 출 문 미래창조과학부 장관 귀하 본 보고서를 『국내 SW생태계 견실화 저해요인 및 개선방 안 연구』의 연구결과보고서로 제출합니다. 2014년 12월 연구기관 : 소프트웨어정책연구소 총괄책임자 : 임춘성 참여연구원: 이현승 양병석 김윤명 김준연 이수현 - i - 목 차 제1장 서 론 ······················································································································1 제1절 SW생태계의 현황 ······························································································· 1 1. 생태계 관점의 SW ································································································· 1 2. 분야별 SW생태계의 현황 ······················································································ 2 제2절 연구의 필요성과 목적 ························································································· 3 1. SW생태계 경쟁력 확보의 필요성 ·········································································· 3 2. SW생태계 경쟁력 확보의 목적 ·············································································· 3 제2장 공공SW의 무상서비스 개선방안 연구 ····································································4 제1절 연구배경 ·············································································································· 4 1. 공공SW의 무상서비스에 대한 문제제기 ································································ 4 2. 행정안전부의 온나라시스템 사례 ··········································································· -

OSOR OSS Procurement Guideline
IDABC Dissemination of Good Practice in Using Open Source Software (GPOSS) OSOR Guidelines Public procurement and Open Source Software public draft version 1.0: 10 October 2008 Contractors: Unisys Belgium UNU-MERIT Authors: Rishab Aiyer Ghosh Ruediger Glott Patrice-Emmanuel Schmitz Abdelkrim Boujraf OSOR Guideline on Public Procurement and Open Source Software - public draft v1.0 P. 1 Table of Contents 1. Introduction................................................................................................................3 2. OSOR guideline for open source procurement..........................................................7 2.1 Public sector needs: transparency, sustainability, cost-effectiveness..................7 2.1 Defining a policy...............................................................................................12 2.2 Determining acquisition needs.........................................................................14 2.2.1 Defining IT architecture.............................................................................14 2.2.2 Determining requirements.........................................................................15 2.2.3 Examining costs and benefits.....................................................................20 2.2.4 Download or purchase?..............................................................................25 2.3 Downloading open source software...................................................................26 2.3.1 Sources of software....................................................................................27 -

Debian GNU/Linux Das Umfassende Handbuch Auf Einen Blick
Heike Jurzik Debian GNU/Linux Das umfassende Handbuch Auf einen Blick Auf einen Blick TEIL I Installation und Konfiguration 1 Was ist Debian GNU/Linux? .............................................................. 33 2 Installationsvorbereitungen .............................................................. 39 3 Debian GNU/Linux installieren ........................................................ 63 4 Das grafische System ........................................................................... 99 5 Debians Paketverwaltung ................................................................... 121 6 Netzwerk und Internet ........................................................................ 163 7 Drucken ..................................................................................................... 201 TEIL II Debian GNU/Linux als Desktopsystem 8 GNOME ..................................................................................................... 227 9 KDE SC 4 .................................................................................................... 253 10 Alternative Desktopumgebungen ................................................... 277 11 Alternative Windowmanager ............................................................ 303 12 Wichtige Internetprogramme ........................................................... 309 13 Debian fürs Büro .................................................................................... 373 14 Multimedia ............................................................................................. -
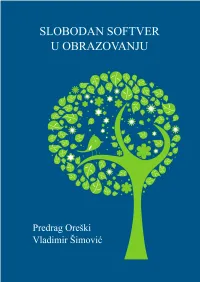
Slobodan Softver U Obrazovanju
I SVEUČILIŠTE U ZAGREBU UČITELJSKI FAKULTET Slobodan softver u obrazovanju Predrag Oreški Vladimir Šimović Zagreb, 2013. II Izdavač Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Savska cesta 77, Zagreb Za izdavača dr. sc. Ivan Prskalo, redoviti profesor Urednik dr. sc. Vladimir Šimović, redoviti profesor Recenzenti dr. sc. Nenad Prelog, redoviti profesor dr. sc. Ljubica Bakić Tomić, izvanredni profesor dr. sc. Dragutin Kermek, izvanredni profesor Lektorica Zdenka Župan Milković, prof. Ilustracija na naslovnici: Vector Open Stock Team, http://www.vectoropenstock.com/963-Vector-abstract-tree-vector Attribution No Derivatives 3.0 Unported License Prijelom: Nataša Rogulja Naklada 200 tiskanih primjeraka + online izdanje UDK 004.4.057.8:37 373.3:004 ISBN 978-953-7210-63-2 Tisak dovršen u 2013. Ovo djelo je dano na korištenje pod licencijom Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno-Bez prerada 3.0 nelokalizirana licencija. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.hr III IV Sadržaj Predgovor ....................................................................................................................... VII Sažetak ......................................................................................................................... VIII 1. Uvod .............................................................................................................................. 1 2. Intelektualno vlasništvo ................................................................................................ 8 2.1. Intelektualno vlasništvo -

One of the Biggest Aims of Limux Was to Make the City More Independent.”
FEATURE MUNICH Munich city council has migrated 15,000 workers from Windows to Linux. Mike Saunders and Graham Morrison visited the city and learned just how upset Steve Ballmer was… “One of the biggest aims of LiMux was to make the city more independent.” irschgarten, in the west of the last decade. Migrating workers of Munich, is one of Europe’s biggest Germany’s third-largest city was no easy Hbeer gardens, with over 8,000 task and there were plenty of hurdles along places to sit. It’s a spectacular sight in the way, but by and large the project has summer: hundreds of benches as far as been a storming success. the eye can see, trees providing some We’ve been following the progress of shelter from the heat, and a vast number LiMux (Linux in Munich) for years, and now of people relaxing and enjoying the city’s that the project is effectively complete, we famous beers. decided to visit the city and talk to the man But while 8,000 is an impressive number, in charge of it. Read on to discover how it it’s not as impressive as 15,000. That’s all started, how Microsoft tried to torpedo how many people the Munich city council it, and whether other cities in the world can has switched from Windows to Linux over follow Munich’s lead… 52 www.linuxvoice.com LV002 052 Feature Munich.indd 52 06/03/2014 11:52 MUNICH FEATURE Humble beginnings Cast your mind back to 2001, and the state of Linux at the time. -

Open Source Software in Strategic IT Management
MASTER THESIS submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of „Master of Science in Engineering“ Open Source Software in strategic IT management: Application and strategic economic contribution of Open Source Software to business success by Wolfgang Rogner A-2351 Wr. Neudorf, Reisenbauerring 1/5/23 Main Advisor: DI.DDr. Walter Jaburek Co-advisor: Mag. Edmund Humenberger Wr. Neudorf, 15.5.2011 Eidesstattliche Erklärung „Ich erkläre hiermit an Eides Statt, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig angefertigt habe. Die aus fremden Quellen direkt oder indirekt übernommenen Gedanken sind als solche kenntlich gemacht (Anführungszeichen, kursive Schrift, im Originaldokument als eigener Schriftstil definiert). Eigenleistungen wurde grau unterlegt. Die Arbeit wurde bisher weder in gleicher noch in ähnlicher Form einer anderen Prüfungsbehörde vorgelegt und auch noch nicht veröffentlicht.“ Acceptance of liability „I declare that this thesis was written completely by myself. References to external sources (including my own previous work) have been denoted explicitly (quotation marks text in italic, unique style sheet in the original document). Own contributions are shaded grey. This paper has not been published in part or full previously or submitted to a different board.“ ____________________ _________________________ Ort, Datum Unterschrift Kurzfassung Die vorliegende Arbeit beschreibt die Situation in welcher sich IT Abteilungen und IT Manager aufgrund globalisierter, gesättigter Märkte und steigendem Erfolgsdrucks auf Unternehmen befinden. Die Ursachen für immer geringere Nutzenbeiträge der IT zum Gesamtunternehmen werden identifiziert. Open Source Software (OSS) wird als möglicher Ausweg aus dem Dilemma sinkender IT-Budgets und steigender Geschäftsanforderungen angeboten. Die Arbeit untersucht den strategischen Nutzenbeitrag von OSS zum Unternehmen aus wirtschaftlicher Sicht. -
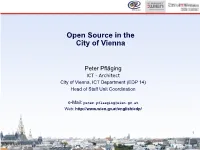
Open Source for the City of Vienna
Open Source in the City of Vienna Peter Pfläging ICT - Architect City of Vienna, ICT Department (EDP 14) Head of Staff Unit Coordination e-Mail: [email protected] Web: http://www.wien.gv.at/english/edp/ 1 Agenda • The City of Vienna in ICT - numbers • History of Open Source in Vienna • OSS on servers • OSS on the desktop – Study STOSS – WIENUX & OpenOffice.org2 • Examples • Legal aspects • Lessons learned • Questions? © City of Vienna - Peter Pfläging 2 The city of Vienna in ICT numbers • 62.000 civil servants • 470 employees in the ICT department • 1 Host system (IBM zOS) • 3 SAP systems (SAP, Oracle, AIX and RedHat i386) • 700 application- & fileservers (Unix/Linux or Windows 2003 Server) • 300 connected networks = locations in Vienna • 20.000 PC‘s as workstations & 12.000 PC‘s in schools • 7.500 network printers • 900 notebooks • Ca. 350 applications (8.000 components) • 40.000 telephones & 1.100 cell phones © City of Vienna - Peter Pfläging 3 History of Open Source in Vienna 1989: Start of working with Unix & Open Source for development 1991: City of Vienna in the internet with TCP/IP Development environment for Unix with GNU Open Source 1993: First internal webservers 1994: Samba as fileservers for the City of Vienna 1998: Start migration FreeBSD -> Linux (Kernel v.2) © City of Vienna - Peter Pfläging 4 History of Open Source in Vienna II 1999: Stepwise migration from FreeBSD to Linux. Some development workstations with Linux 2003: First large open source project from the City of Vienna (vieW4 - web collaboration) 2004: Study STOSS => Linux on workstations. -
Debian - the Universal Operating System? Do We Provide What Users Need? Do Users Get What They Really Want?
Debian - The Universal Operating System? Do we provide what users need? Do users get what they really want? Andreas Tille 22. June 2007 Abstract Debian GNU/Linux is a Linux distribution that is heavily used as a base for several derivatives - there is no other distribution that has such a large number of derived distributions. This is one reason to make us proud because we are considered solid and rock stable. But the question remains: Why do these people not use plain Debian instead of building their own distribution? Debian wants to be “The Universal Operating System” - at least the title of the homepage says so. What means universal? One of WordNet answers is “adapted to various purposes, sizes, forms, operations”. If we agree to this definition we have to experience: Debian is not really adapted to various purposes but it is perfectly adaptable. It is not really bad if Debian is adaptable to various purposes and the fact that Debian and even its derivatives are used as a base for adaptations makes us proud. It is a good sign that Debian is an unspecialised base system which is not really modified for a particular purpose or function which makes it attractive for adaptation to any purpose because it is known to be very robust and stable. So in short: We do a quite good job but it does not really qualify for the attribute “universal”. The first question is: Do we really want to be universal? If we answer this with yes, the next question is: Can we as a group of more or less independent maintainers afford this? My answer to this question is yes and the method to do this are Custom Debian Distributions.