Debian GNU/Linux Das Umfassende Handbuch Auf Einen Blick
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Diplomarbeit Limux
Diplomarbeit LiMux Ist Open-Source-Software eine Alternative für die öffentliche Verwaltung? Überprüfung des Migrationsprozesses der Stadt München von Windows auf Linux anhand eines Kriterienkatalogs Erstellt am: Arbeitsbereich Softwaretechnik Departement Informatik MIN Fakultät Universität Hamburg Erstbetreuer: Dr. Wolf-Gideon Bleek Zweitbetreuer: Prof. Dr.-Ing. Bernd Page Abgabedatum: 02.05.2007 Erstellt von: Benjamin Stukenberg Matrikelnummer: 5498671 Studiengang: Wirtschaftsinformatik Adresse: Rantzaustr. 85, 22926 Ahrensburg Diplomarbeit: LiMux Seite 3 von 65 Danksagung Ich danke meinem Erstbetreuer Dr. Bleek für die Betreuung und für Anregungen für meine Diplomarbeit und meinem Zweitbetreuer Prof. Dr.-Ing. Page für die Zweitbetreu- ung. Ich danke der Stadt München dafür, dass sie auf Open-Source-Software umsteigt und mir somit das Thema meiner Diplomarbeit ermöglicht hat. Insbesondere danke ich dem stellvertretenden Projektleiter des LiMux-Projekts Herrn Lubig-Konzett für das In- terview. Des weiteren danke ich allen Entwicklern von Open-Source-Software, ohne sie wäre diese Diplomarbeit nicht möglich gewesen, d. h. ohne sie hätte ich nicht über dieses Thema schreiben können. Insbesondere danke ich den Entwicklern von OpenOffice.org und Linux, denn ich habe diese Diplomarbeit mit OpenOffice.org unter Linux ohne einen einzigen Absturz verfassen können. Diplomarbeit: LiMux Seite 4 von 65 Inhaltsverzeichnis Tabellenverzeichnis...........................................................................................................6 -
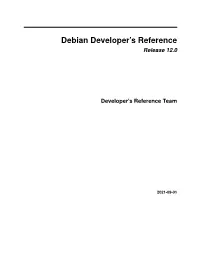
Debian Developer's Reference Version 12.0, Released on 2021-09-01
Debian Developer’s Reference Release 12.0 Developer’s Reference Team 2021-09-01 CONTENTS 1 Scope of This Document 3 2 Applying to Become a Member5 2.1 Getting started..............................................5 2.2 Debian mentors and sponsors......................................6 2.3 Registering as a Debian member.....................................6 3 Debian Developer's Duties 9 3.1 Package Maintainer's Duties.......................................9 3.1.1 Work towards the next stable release............................9 3.1.2 Maintain packages in stable .................................9 3.1.3 Manage release-critical bugs.................................. 10 3.1.4 Coordination with upstream developers............................ 10 3.2 Administrative Duties.......................................... 10 3.2.1 Maintaining your Debian information............................. 11 3.2.2 Maintaining your public key.................................. 11 3.2.3 Voting.............................................. 11 3.2.4 Going on vacation gracefully.................................. 12 3.2.5 Retiring............................................. 12 3.2.6 Returning after retirement................................... 13 4 Resources for Debian Members 15 4.1 Mailing lists............................................... 15 4.1.1 Basic rules for use....................................... 15 4.1.2 Core development mailing lists................................. 15 4.1.3 Special lists........................................... 16 4.1.4 Requesting new -

One of the Biggest Aims of Limux Was to Make the City More Independent.”
FEATURE MUNICH Munich city council has migrated 15,000 workers from Windows to Linux. Mike Saunders and Graham Morrison visited the city and learned just how upset Steve Ballmer was… “One of the biggest aims of LiMux was to make the city more independent.” irschgarten, in the west of the last decade. Migrating workers of Munich, is one of Europe’s biggest Germany’s third-largest city was no easy Hbeer gardens, with over 8,000 task and there were plenty of hurdles along places to sit. It’s a spectacular sight in the way, but by and large the project has summer: hundreds of benches as far as been a storming success. the eye can see, trees providing some We’ve been following the progress of shelter from the heat, and a vast number LiMux (Linux in Munich) for years, and now of people relaxing and enjoying the city’s that the project is effectively complete, we famous beers. decided to visit the city and talk to the man But while 8,000 is an impressive number, in charge of it. Read on to discover how it it’s not as impressive as 15,000. That’s all started, how Microsoft tried to torpedo how many people the Munich city council it, and whether other cities in the world can has switched from Windows to Linux over follow Munich’s lead… 52 www.linuxvoice.com MUNICH FEATURE Humble beginnings Cast your mind back to 2001, and the state of Linux at the time. It was well established as a server OS and fairly well known among computing hobbyists, but still a small fish in the desktop pond. -

The Digital Nexus: Identity, Agency, and Political Engagement Edited by Raphael Foshay Thethe Digitaldigital Nexusnexus
The Digital Nexus Cultural Dialectics Series editor: Raphael Foshay The difference between subject and object slices through subject as well as through object. —Theodor W. Adorno Cultural Dialectics provides an open arena in which to debate questions of culture and dialectic—their practices, their theoretical forms, and their relations to one another and to other spheres and modes of inquiry. Approaches that draw on any of the following are especially encouraged: continental philosophy, psychoanalysis, the Frankfurt and Birmingham schools of cultural theory, deconstruction, gender theory, postcoloniality, and interdisciplinarity. Series Titles Northern Love: An Exploration of Canadian Masculinity Paul Nonnekes Making Game: An Essay on Hunting, Familiar Things, and the Strangeness of Being Who One Is Peter L. Atkinson Valences of Interdisciplinarity: Theory, Practice, Pedagogy Edited by Raphael Foshay Imperfection Patrick Grant The Undiscovered Country: Essays in Canadian Intellectual Culture Ian Angus The Letters of Vincent van Gogh: A Critical Study Patrick Grant “My Own Portrait in Writing”: Self-Fashioning in the Letters of Vincent van Gogh Patrick Grant Speaking Power to Truth: Digital Discourse and the Public Intellectual Edited by Michael Keren and Richard Hawkins The Digital Nexus: Identity, Agency, and Political Engagement Edited by Raphael Foshay TheThe DigitalDigital NexusNexus Identity, Agency, and Political Engagement edited by RAFAEL FOSHAY Copyright © 2016 Raphael Foshay Published by AU Press, Athabasca University 1200, 10011 – 109 Street, Edmonton, AB T5J 3S8 ISBN 978-1-77199-129-2 (print) 978-1-77199-130-8 (pdf) 978-1-77199-131-5 (epub) doi: 10.15215/aupress/9781771991292.01 A volume in Cultural Dialectics series: ISSN 1915-836X (print) 1915-8378 (digital) Cover design by Marvin Harder Interior design by Sergiy Kozakov Printed and bound in Canada by Friesens The appendix, “Do Machines Have Rights? Ethics in the Age of Artificial Intelligence,” is a reprint of Paul Kellogg’s interview of David J. -
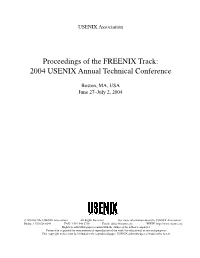
Proceedings of the FREENIX Track: 2004 USENIX Annual Technical Conference
USENIX Association Proceedings of the FREENIX Track: 2004 USENIX Annual Technical Conference Boston, MA, USA June 27–July 2, 2004 © 2004 by The USENIX Association All Rights Reserved For more information about the USENIX Association: Phone: 1 510 528 8649 FAX: 1 510 548 5738 Email: [email protected] WWW: http://www.usenix.org Rights to individual papers remain with the author or the author's employer. Permission is granted for noncommercial reproduction of the work for educational or research purposes. This copyright notice must be included in the reproduced paper. USENIX acknowledges all trademarks herein. Managing Volunteer Activity in Free Software Projects Martin Michlmayr Department of Computer Science and Software Engineering University of Melbourne Victoria, 3010, Australia Centre for Technology Management University of Cambridge Mill Lane Cambridge, CB2 1RX, UK [email protected] Abstract high amount of parallelization in the debugging process. Due to the open nature of the source code in free soft- During the last few years, thousands of volunteers ware projects, anyone can review the code, find defects have created a large body of free software. Even though and contribute bug fixes. Raymond suggested that this this accomplishment shows that the free software devel- ‘bazaar’ model, in which a large number of volunteers opment model works, there are some drawbacks asso- review the code and contribute feedback and patches, ciated with this model. Due to the volunteer nature of is the reason for the success and high quality of many most free software projects, it is impossible to fully rely free software projects. This suggestion meshes well with on participants. -
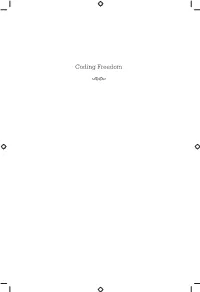
Coleman-Coding-Freedom.Pdf
Coding Freedom !" Coding Freedom THE ETHICS AND AESTHETICS OF HACKING !" E. GABRIELLA COLEMAN PRINCETON UNIVERSITY PRESS PRINCETON AND OXFORD Copyright © 2013 by Princeton University Press Creative Commons Attribution- NonCommercial- NoDerivs CC BY- NC- ND Requests for permission to modify material from this work should be sent to Permissions, Princeton University Press Published by Princeton University Press, 41 William Street, Princeton, New Jersey 08540 In the United Kingdom: Princeton University Press, 6 Oxford Street, Woodstock, Oxfordshire OX20 1TW press.princeton.edu All Rights Reserved At the time of writing of this book, the references to Internet Web sites (URLs) were accurate. Neither the author nor Princeton University Press is responsible for URLs that may have expired or changed since the manuscript was prepared. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Coleman, E. Gabriella, 1973– Coding freedom : the ethics and aesthetics of hacking / E. Gabriella Coleman. p. cm. Includes bibliographical references and index. ISBN 978-0-691-14460-3 (hbk. : alk. paper)—ISBN 978-0-691-14461-0 (pbk. : alk. paper) 1. Computer hackers. 2. Computer programmers. 3. Computer programming—Moral and ethical aspects. 4. Computer programming—Social aspects. 5. Intellectual freedom. I. Title. HD8039.D37C65 2012 174’.90051--dc23 2012031422 British Library Cataloging- in- Publication Data is available This book has been composed in Sabon Printed on acid- free paper. ∞ Printed in the United States of America 1 3 5 7 9 10 8 6 4 2 This book is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE !" We must be free not because we claim freedom, but because we practice it. -

Debian 1 Debian
Debian 1 Debian Debian Part of the Unix-like family Debian 7.0 (Wheezy) with GNOME 3 Company / developer Debian Project Working state Current Source model Open-source Initial release September 15, 1993 [1] Latest release 7.5 (Wheezy) (April 26, 2014) [±] [2] Latest preview 8.0 (Jessie) (perpetual beta) [±] Available in 73 languages Update method APT (several front-ends available) Package manager dpkg Supported platforms IA-32, x86-64, PowerPC, SPARC, ARM, MIPS, S390 Kernel type Monolithic: Linux, kFreeBSD Micro: Hurd (unofficial) Userland GNU Default user interface GNOME License Free software (mainly GPL). Proprietary software in a non-default area. [3] Official website www.debian.org Debian (/ˈdɛbiən/) is an operating system composed of free software mostly carrying the GNU General Public License, and developed by an Internet collaboration of volunteers aligned with the Debian Project. It is one of the most popular Linux distributions for personal computers and network servers, and has been used as a base for other Linux distributions. Debian 2 Debian was announced in 1993 by Ian Murdock, and the first stable release was made in 1996. The development is carried out by a team of volunteers guided by a project leader and three foundational documents. New distributions are updated continually and the next candidate is released after a time-based freeze. As one of the earliest distributions in Linux's history, Debian was envisioned to be developed openly in the spirit of Linux and GNU. This vision drew the attention and support of the Free Software Foundation, who sponsored the project for the first part of its life. -

Free/Open Source Software Development
Free/Open Source Software Development Stefan Koch IDEA GROUP PUBLISHING Free/Open Source Software Development Stefan Koch Vienna University of Economics and Business Administration, Austria IDEA GROUP PUBLISHING Hershey • London • Melbourne • Singapore Acquisitions Editor: Mehdi Khosrow-Pour Senior Managing Editor: Jan Travers Managing Editor: Amanda Appicello Development Editor: Michele Rossi Copy Editor: Jane Conley Typesetter: Sara Reed Cover Design: Lisa Tosheff Printed at: Yurchak Printing Inc. Published in the United States of America by Idea Group Publishing (an imprint of Idea Group Inc.) 701 E. Chocolate Avenue, Suite 200 Hershey PA 17033 Tel: 717-533-8845 Fax: 717-533-8661 E-mail: [email protected] Web site: http://www.idea-group.com and in the United Kingdom by Idea Group Publishing (an imprint of Idea Group Inc.) 3 Henrietta Street Covent Garden London WC2E 8LU Tel: 44 20 7240 0856 Fax: 44 20 7379 3313 Web site: http://www.eurospan.co.uk Copyright © 2005 by Idea Group Inc. All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopy- ing, without written permission from the publisher. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Free/open source software development / Stefan Koch, Editor. p. cm. ISBN 1-59140-369-3 -- ISBN 1-59140-370-7 (pbk.) -- ISBN 1-59140-371-5 (ebook) 1. Computer software--Development. 2. Open source software. I. Koch, Stefan. QA76.76.S46F74 2004 005.1--dc22 2004003748 British Cataloguing in Publication Data A Cataloguing in Publication record for this book is available from the British Library. -
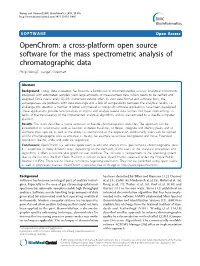
Openchrom: a Cross-Platform Open Source Software for the Mass Spectrometric Analysis of Chromatographic Data Philip Wenig*, Juergen Odermatt
Wenig and Odermatt BMC Bioinformatics 2010, 11:405 http://www.biomedcentral.com/1471-2105/11/405 SOFTWARE Open Access OpenChrom: a cross-platform open source software for the mass spectrometric analysis of chromatographic data Philip Wenig*, Juergen Odermatt Abstract Background: Today, data evaluation has become a bottleneck in chromatographic science. Analytical instruments equipped with automated samplers yield large amounts of measurement data, which needs to be verified and analyzed. Since nearly every GC/MS instrument vendor offers its own data format and software tools, the consequences are problems with data exchange and a lack of comparability between the analytical results. To challenge this situation a number of either commercial or non-profit software applications have been developed. These applications provide functionalities to import and analyze several data formats but have shortcomings in terms of the transparency of the implemented analytical algorithms and/or are restricted to a specific computer platform. Results: This work describes a native approach to handle chromatographic data files. The approach can be extended in its functionality such as facilities to detect baselines, to detect, integrate and identify peaks and to compare mass spectra, as well as the ability to internationalize the application. Additionally, filters can be applied on the chromatographic data to enhance its quality, for example to remove background and noise. Extended operations like do, undo and redo are supported. Conclusions: OpenChrom is a software application to edit and analyze mass spectrometric chromatographic data. It is extensible in many different ways, depending on the demands of the users or the analytical procedures and algorithms. It offers a customizable graphical user interface. -

Information Economy Report 2012: the Software Industry and Developing Countries
UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT INFORMATION ECONOMY REPORT 2012 The Software Industry and Developing Countries New York and Geneva 2012 ii INFORMATION ECONOMY REPORT 2012 PREFACE iii NOTE PREFACE Within the UNCTAD Division on Technology and Logistics, the ICT Analysis Section carries out policy-oriented Information and communications technologies continue to transform our society. In recent years we have seen analytical work on the development implications of information and communication technologies (ICTs). It is dramatically improved access to mobile telephones, the Internet and broadband connectivity throughout the responsible for the preparation of the Information Economy Report. The ICT Analysis Section promotes international developing world. These trends are gradually helping to dismantle barriers towards the goal of an “information dialogue on issues related to ICTs for development, and contributes to building developing countries’ capacities to society for all” agreed by world leaders at the World Summit on the Information Society. measure the information economy and to design and implement relevant policies and legal frameworks. Such a society depends on software. The growing emphasis on ICTs in the delivery of government, healthcare, In this Report, the terms country/economy refer, as appropriate, to territories or areas. The designations education and other goods and services demands customized applications. Countries therefore need the employed and the presentation of the material do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part capacity to adopt, adapt and develop relevant software. Such capacity is also important to facilitate successful of the Secretariat of the United Nations concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its technology transfer. -

국내 SW생태계 견실화 저해요인 및 개선 방안 연구 (A Study on Improving Restraints of SW Industry)
방송통신정책연구 14-진흥-021 국내 SW생태계 견실화 저해요인 및 개선 방안 연구 (A study on improving restraints of SW industry) 임춘성/이현승/양병석/김윤명/김준연/이수현 2014. 12 연구기관 : 소프트웨어정책연구소 - i - 이 보고서는 2014년도 미래창조과학부 방송통신발전기금 방송통신 정책연구사업의 연구결과로서 보고서 내용은 연구자의 견해이며, 미래창조과학부의 공식입장과 다를 수 있습니다. 제 출 문 미래창조과학부 장관 귀하 본 보고서를 『국내 SW생태계 견실화 저해요인 및 개선방 안 연구』의 연구결과보고서로 제출합니다. 2014년 12월 연구기관 : 소프트웨어정책연구소 총괄책임자 : 임춘성 참여연구원: 이현승 양병석 김윤명 김준연 이수현 - i - 목 차 제1장 서 론 ······················································································································1 제1절 SW생태계의 현황 ······························································································· 1 1. 생태계 관점의 SW ································································································· 1 2. 분야별 SW생태계의 현황 ······················································································ 2 제2절 연구의 필요성과 목적 ························································································· 3 1. SW생태계 경쟁력 확보의 필요성 ·········································································· 3 2. SW생태계 경쟁력 확보의 목적 ·············································································· 3 제2장 공공SW의 무상서비스 개선방안 연구 ····································································4 제1절 연구배경 ·············································································································· 4 1. 공공SW의 무상서비스에 대한 문제제기 ································································ 4 2. 행정안전부의 온나라시스템 사례 ··········································································· -
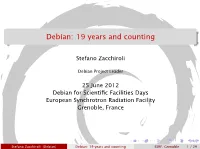
Debian: 19 Years and Counting
Debian: 19 years and counting Stefano Zacchiroli Debian Project Leader 25 June 2012 Debian for Scientific Facilities Days European Synchrotron Radiation Facility Grenoble, France Stefano Zacchiroli (Debian) Debian: 19 years and counting ESRF, Grenoble 1 / 29 Outline 1 Debian and Wheezy 2 Specialties 3 Derivatives 4 Contribute Stefano Zacchiroli (Debian) Debian: 19 years and counting ESRF, Grenoble 2 / 29 Prelude — the notion of “distribution” distributions are meant to ease software management key notion: the abstraction of package offer coherent collections of software killer application: package managers Stefano Zacchiroli (Debian) Debian: 19 years and counting ESRF, Grenoble 3 / 29 Outline 1 Debian and Wheezy 2 Specialties 3 Derivatives 4 Contribute Stefano Zacchiroli (Debian) Debian: 19 years and counting ESRF, Grenoble 4 / 29 Debian: once upon a time Fellow Linuxers, This is just to announce the imminent completion of a brand-new Linux release, which I’m calling the Debian Linux Release. [. ] Ian A Murdock, 16/08/1993 comp.os.linux.development make GNU/Linux competitive with commercial OS easy to install built collaboratively by software experts 1st major distro developed “openly in the spirit of GNU” FSF-supported for a while Stefano Zacchiroli (Debian) Debian: 19 years and counting ESRF, Grenoble 5 / 29 Debian: the operating system flagship product: Debian stable binary distribution Source packages Binary packages 30000 completely Free (DFSG) 25000 released every 24 months (≈) 20000 15000 a dozen architectures 10000 archive-wide security support 5000 0 (3-3.5 years) 2.0 2.1 2.2 3.0 3.1 4.0 5.0 6.0 renowned for one of the largest GNU/Linux ports, stability, packaging system, porting platforms old hardware support, documentation, smooth upgrades, i18n/l10n, the testing suite, runs anywhere, technical policy, package choice, .