Laudatio Auf Wim
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

B BOOM099 Parlementaire Geschiedenis 2014 Binnenwerk.Indd
Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2014 Het geld regeert Redactie: Carla van Baalen Hans Goslinga Alexander van Kessel Jan Ramakers Hilde Reiding Jouke Turpijn Centrum voor Parlementaire Geschiedenis Nijmegen Boom – Amsterdam B_BOOM099 parlementaire geschiedenis 2014 binnenwerk.indd 3 28-10-14 16:29 Foto omslag: Minister van Financiën, Jeroen Dijsselbloem, op weg van het ministerie van Algemene Zaken om de begroting aan te bieden aan de Tweede Kamer, 17 september 2013. [Foto: anp/Evert-Jan Daniëls] Vormgeving: Boekhorst design, Culemborg © 2014 Centrum voor Parlementaire Geschiedenis, Nijmegen Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. No part of this book may be reproduced in any way whatsoever without the written permission of the publisher. isbn 978 90 8953 374 6 nur 680 www.uitgeverijboom.nl B_BOOM099 parlementaire geschiedenis 2014 binnenwerk.indd 4 28-10-14 16:29 Inhoud Ten geleide 7 Artikelen Arjo Klamer en Paul Teule, Van kwantiteit naar kwaliteit. Hoe één enkel cijfer zo 13 machtig werd en wat de politiek daaraan moet doen Peter van Griensven en Johan van Merriënboer, De vinger aan de pols. Parlement en 23 begrotingsrecht 1814-2014 Christianne Smit, Van ‘de hatelijkste aller belastingen’ tot een ‘daad van 35 rechtvaardigheid’. De strijd om een inkomstenbelasting in Nederland, 1842-1893 Eric Janse de Jonge, Het budgetrecht in de Verenigde Staten, Engeland en Nederland. 45 Betekenis en actuele stand van zaken Hilde Reiding, Compromis en confrontatie. -

Jo Ritzen IZA Policy Paper No.44 Can Theuniversitysaveeurope? of Labor Institute for Thestudy Zur Zukunft Der Arbeit Forschungsinstitut
IZA Policy Paper No. 44 Can the University Save Europe? Jo Ritzen P O L I C Y P A P E R S I P A P Y I C O L P July 2012 Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit Institute for the Study of Labor Can the University Save Europe? Jo Ritzen Maastricht University and IZA Policy Paper No. 44 July 2012 IZA P.O. Box 7240 53072 Bonn Germany Phone: +49-228-3894-0 Fax: +49-228-3894-180 E-mail: [email protected] The IZA Policy Paper Series publishes work by IZA staff and network members with immediate relevance for policymakers. Any opinions and views on policy expressed are those of the author(s) and not necessarily those of IZA. The papers often represent preliminary work and are circulated to encourage discussion. Citation of such a paper should account for its provisional character. A revised version may be available directly from the corresponding author. IZA Policy Paper No. 44 July 2012 ABSTRACT * Can the University Save Europe? Higher education is in the position to save Europe by rendering a substantial contribution to sustainable economic growth. For that purpose higher education must strengthen its innovative power in entrepreneurship education and by focusing research more on societal problems, while being better empowered and enabled by Governments. Universities must show leadership in resolving or channeling the major societal questions. More European competition between universities in education and research would be helpful. Universities can contribute to recreating hope and optimism through more innovation in the economy. JEL Classification: D31, F55, I22, I23, I24, I25, I28, J24, O31, O47, O52 Keywords: hope, attitudes, Europe, economic growth, higher education, labor market, innovation, competition Corresponding author: Jo Ritzen Keizer Karelplein 19 6211 TC Maastricht The Netherlands E-mail: [email protected] * Jo Ritzen is former minister of education, former vice president of the Human Development Network at the World Bank and former president of Maastricht University. -

European Universities in the Aftermath of the Economic Crisis
INTERNATIONAL HIGHER EDUCATION Number 87: Fall 2016 3 al search for talent, and position themselves beyond their sions as a result of it. The road ahead is an arduous one, own borders. The Bologna Process offered a framework for but a European Higher Education Area without the United shared solutions to shared problems. Kingdom would be everybody’s loss. While it was hailed as a landmark reform, achieving in only 10 years what many national governments had failed to achieve in several decades, the Bologna Process did not evolve along equal paths in the different countries and in- stitutions, and there was significant variation in the pace of change and degree of success in implementation of the European Universities in the action lines. These trends were magnified by the even faster pace of globalization that was creating previously unknown Aftermath of the Economic levels of instability and volatility in the economic and politi- Crisis cal environments of the different EU member states, even though the universities themselves were firm believers in— Jo Ritzen and strong benefiters of—European cooperation. Jo Ritzen is professor of international economics of science, technology, and higher education, Maastricht University, Maastricht, the Nether- A key question raised is whether the lands. E-mail: [email protected]. British exit from the European Union fter a seven-year period, the economic crisis seemed to (EU) will also lead to a brain exit from Abe over in 2015: economic growth was picking up again the United Kingdom. in most European Union (EU) countries. During the crisis, economic growth fell, fewer taxes were collected, banks were rescued with public money, government debt levels rose and How Do We Move Forward? (youth) unemployment increased. -

Educational Pathways and Skills: Past, Present and Future Educational Pathways and Skills: Past, Present and Future Alison Cathles
Educational Pathways and Skills: Past, Present and Future and Skills: Past, Educational Pathways Educational Pathways and Skills: Past, Present and Future Alison Cathles 223 UNU MERIT MGS o G Alison Cathles 2019 Alison Cathles Cover v0.indd 1-3 29-3-2019 09:45:29 Educational Pathways and Skills: Past, Present, and Future DISSERTATION to obtain the degree of Doctor at the Maastricht University, on the authority of the Rector Magnificus Prof. Dr. Rianne M. Letschert, in accordance with the decision of the Board of Deans, to be defended in public on Wednesday, 17 April 2019, at 14:00 hours by Alison Cathles Author: Alison Cathles Illustration cover: Melanie Waidler Layout and printing: Proefschriftmaken ISBN: 978-94-6380-434-9 Educational Pathways and Skills: Past, Present, and Future by Alison Cathles Supervisors Prof. Dr. Jo Ritzen (Promoter) Prof. Dr. Adam Szirmai Assessment Committee Prof. Dr. Bart Verspagen (Chair) Dr. Elena Arias Ortiz (Education Specialist, IDB) Prof. Dr. Joop Hartog (Emeritus Professor of Economics at Amsterdam University) Prof. Dr. Henriëtte Maassen van den Brink Prof. Dr. Rolf van der Velden Dr. Stéphan Vincent-Lancrin (Senior Analyst, OECD) Acknowledgements The path that led to and through my PhD was a non-linear one. Along my path I was influenced by a series of people to whom I am forever grateful. My two supervisors formed an excellent team. Prof. Jo Ritzen, my promoter, is someone who I believe is an academic entrepreneur. He is enthusiastically supportive of new ideas, but always seems to have a back-up card to play if an idea does not blossom according to expectation. -

Sectoral Cognitive Skills, R&D, and Productivity
DISCUSSION PAPER SERIES IZA DP No. 10457 Sectoral Cognitive Skills, R&D, and Productivity: A Cross-Country Cross-Sector Analysis Simone Sasso Jo Ritzen DECEMBER 2016 DISCUSSION PAPER SERIES IZA DP No. 10457 Sectoral Cognitive Skills, R&D, and Productivity: A Cross-Country Cross-Sector Analysis Simone Sasso UNU-MERIT, Maastricht University Jo Ritzen IZA and UNU-MERIT, Maastricht University DECEMBER 2016 Any opinions expressed in this paper are those of the author(s) and not those of IZA. Research published in this series may include views on policy, but IZA takes no institutional policy positions. The IZA research network is committed to the IZA Guiding Principles of Research Integrity. The IZA Institute of Labor Economics is an independent economic research institute that conducts research in labor economics and offers evidence-based policy advice on labor market issues. Supported by the Deutsche Post Foundation, IZA runs the world’s largest network of economists, whose research aims to provide answers to the global labor market challenges of our time. Our key objective is to build bridges between academic research, policymakers and society. IZA Discussion Papers often represent preliminary work and are circulated to encourage discussion. Citation of such a paper should account for its provisional character. A revised version may be available directly from the author. IZA – Institute of Labor Economics Schaumburg-Lippe-Straße 5–9 Phone: +49-228-3894-0 53113 Bonn, Germany Email: [email protected] www.iza.org IZA DP No. 10457 DECEMBER 2016 ABSTRACT Sectoral Cognitive Skills, R&D, and Productivity: A Cross-Country Cross-Sector Analysis1 We focus on human capital measured by education outcomes (skills) and establish the relationship between human capital, R&D investments, and productivity across 12 OECD economies and 17 manufacturing and service industries. -
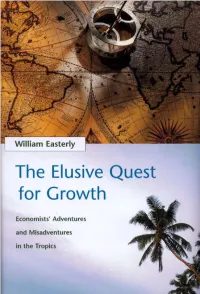
William Easterly's the Elusive Quest for Growth
The Elusive Quest for Growth Economists’ Adventures and Misadventures in the Tropics William Easterly The MIT Press Cambridge, Massachusetts London, England 0 2001 Massachusetts Institute of Technology All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form by any electronic or mechanical means (including photocopying, recording, or information storage and retrieval) without permission in writing from the publisher. Lyrics from ”God Bless the Child,” Arthur Herzog, Jr., Billie Holiday 0 1941, Edward B. Marks Music Company.Copyright renewed. Used by permission. All rights reserved. This book was set in Palatino by Asco Typesetters, Hong Kong, in ’3B2’ Printed and bound in the United States of America. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Easterly, William. The elusive quest for growth :economists’ adventures and misadventures in the tropics /William Easterly. p. cm. Includes bibliographical references and index. ISBN 0-262-05065-X (hc. :alk. paper) 1. Poor-Developing countries. 2. Poverty-Developing countries. 3. Developing countries-Economic policy. I. Title. HC59.72.P6 E172001 338.9’009172’4-dc21 00-068382 To Debbie, Rachel, Caleb, and Grace This Page Intentionally Left Blank Contents Acknowledgments ix Prologue: The Quest xi I Why Growth Matters 1 1 To Help the Poor 5 Intermezzo: In Search of a River 16 I1 Panaceas That Failed 21 2 Aid for Investment 25 Zntermezzo: Parmila 45 3 Solow’s Surprise: Investment Is Not the Key to Growth 47 Intermezzo: DryCornstalks 70 4 Educated for What? 71 Intermezzo: Withouta -

Ook Bij De Overheid Heerst Een Graaicultuur
OOK BIJ DE OVERHEID HEERST EEN GRAAICULTUUR (Onder Economen. DDL 11 juli 2003) door Hans van Mierlo Niet alleen in het bedrijfsleven lopen de managersalarissen uit de hand. Ook in de publieke sector en in de non-profit sector komt steeds meer kritiek op schaamteloze zelfverrijking. De directeur van het eerste het beste perifere streekziekenhuis verdient meer dan onze premier. Dat is de omgekeerde wereld. Wat er aan te doen? Om te beginnen volsterkte openbaarheid van topinkomens, zegt econoom Van Mierlo. Hij begint als eerste met zijn eigen inkomen, want daar is niets geheims aan. De exorbitante salarissen van topbestuurders van grote bedrijven staan steeds meer ter discussie sinds Wim Kok dat een paar jaar geleden diskwalificeerde als ‘exhibionistische zelfverrijking’. In deze tijden van economische neergang zwelt de kritiek verder aan, nu dat ook nog eens gepaard blijkt te gaan met riante gouden handdrukken bij gedwongen vertrek die vaak al bij aantreden zijn afgesproken. Zo vullen de managers twee keer hun zakken. Doen zij het goed, dan verdienen zij door de bonusregeling een riant inkomen. Doen zij het slecht, dan verdienen zij door de vertrekregeling nog een keer extra premie. Feitelijk betekent dat een beloning op slecht functioneren, want er is geen malusregeling. De commissie-Tabaksblatt komt terecht met voorstellen om daar wat aan te doen. Aan ‘goed ondernemingsbestuur’ wordt dus gewerkt, maar het kan nog gekker: vooral in de non-profit sector blijken de topsalarissen eveneens compleet uit de hand te lopen. Bij ziekenhuizen, onderwijsinstellingen, woningcorporaties en verzelfstandigde bedrijven wordt goed verdiend. Enkele voorbeelden uit een recent onderzoek van het blad Intermediair. -

0. Om in De Agenda Te Noteren
Stichting Vrienden van de Onderwijsinspectie Postbus 2730 3500 GS Utrecht [email protected] bankrek.nr. NL65RABO0356537129 KvK 851660277 Nieuwsbrief nr. 16 - juni 2017 0. Om in de agenda te noteren Beste mensen, Juni 2017, we staan aan het begin van een nieuwe zomer. Het voorjaar met al het ontluikende leven en de zachte groene kleuren is voorbij. Kleuren worden weer feller en harder en de natuur heeft zich weer gesetteld. Onder het badkamerraam van het huis waarin we enkele weken mochten vertoeven zaten twee nesten, waarin het getsjilp van de jonge vogels niet van de lucht was, met moeder vogel op een boomtak in de buurt. Ze zijn gezond en wel uitgevlogen, het leven tegemoet. Maar niet altijd brengt het voorjaar de vreugde van nieuw leven. Zelfs in de lente is er ook sprake van ziekte en zelfs van naderende eindes. Ook onder ons zijn er oud- collega's die dat zelf of in familiekring momenteel meemaken. Onze gedachten gaan naar hen uit. Wij wensen hen en hun dierbaren erg veel sterkte toe. Het voorjaar was ook de tijd van de examens, waar wij als gepensioneerden van een afstand naar hebben gekeken. We herinneren ons de drukte en de zorg die wij zelf in ons werkzame leven in die examentijden hadden, zowel professioneel als in onze rollen als ouders. En dan sta je toch met een zekere verbazing te kijken naar wat er nu allemaal gebeurt, naar alle klachten die naar voren zijn gebracht: bijna tweehonderdduizend ingediende klachten. En dan weet ik ook wel dat een behoorlijk aantal niet serieus te nemen is, maar toch. -

Download the Working Paper
Working Paper Series #2016-002 New variables for vocational secondary schooling: Patterns around the world from 1950‐2010 Alison Cathles Maastricht Economic and social Research institute on Innovation and Technology (UNU‐MERIT) email: [email protected] | website: http://www.merit.unu.edu Maastricht Graduate School of Governance (MGSoG) email: info‐[email protected] | website: http://www.maastrichtuniversity.nl/governance Boschstraat 24, 6211 AX Maastricht, The Netherlands Tel: (31) (43) 388 44 00 UNU-MERIT Working Papers ISSN 1871-9872 Maastricht Economic and social Research Institute on Innovation and Technology UNU-MERIT Maastricht Graduate School of Governance MGSoG UNU-MERIT Working Papers intend to disseminate preliminary results of research carried out at UNU-MERIT and MGSoG to stimulate discussion on the issues raised. New Variables for Vocational Secondary Schooling: Patterns around the World from 1950-2010* Alison Cathles† Abstract Projections in Europe and the United States suggest job vacancies will soon be concentrated in positions that require vocational training. This has spurred policy discussions about how vocational education can optimally complement or substitute for general education and highlighted the need to understand more precisely how the mix of skills in a workforce impacts economic growth. Macroeconomic growth literature has traditionally incorporated measures for human capital based on the length of time spent in educational institutions. The need to measure the skills acquired through different kinds of education has been appreciated. Specifically, the insights that might be obtained by comparing the macroeconomic growth of countries with different amounts of vocational education has been apparent, but the long-time series of internationally comparable data required has not been readily available. -

Coalition Politics & Peaceful Foreign Policy
2017 Coalition Politics & Peaceful Foreign Policy A COMPREHENSIVE ANALYSIS OF THE DUTCH DECISION-MAKING PROCESS WITH REGARD TO THE GULF CRISIS (1990-1991) Master thesis Luca Schmidt 3928152 International Relations in Historical Perspective Supervisor: Lorena De Vita Utrecht University 1 June 2017 2 Abstract On 2 August 1990 Iraq invaded Kuwait. Four days later the Iraqi government announced that Kuwait had been annexed as the nineteenth province of Iraq. These actions precipitated an international crisis that culminated in a war led by the United States against Iraq in January and February 1991. Why would states wage war against each other? And why wouldn’t they? This study is an attempt to fill an important gap in two distinct yet closely related theories: the democratic peace theory and coalition cabinet theories. On the general level, the study examines the influence of coalition party ideas on foreign policy. By looking at the Dutch decision-making process with regard to the Gulf crisis (1990-1991) this research will give interesting insights on how ideas shape foreign policy. Moreover, this research contains new information about the debates and the decision-making process with regard to the Gulf crisis in the Netherlands. It will be argued that ideas of parties in coalition governments play an important role in shaping peaceful foreign policy. 3 4 Inhoudsopgave Abstract 3 Introduction 9 Historiographical Debate 10 Research question 13 Demarcation 14 Method 15 Relevance 15 Research outline 16 Chapter 1: Ideas on Peace and Security in the Netherlands (1945-1989) 19 1.1. Thoughts on international security in Dutch foreign politics (1945-1989) 20 1.2. -

Law Scenarios to 2030 Help Prepare Politicians, Corporate Executives and Societal Leaders for the Legal Challenges Posed by Global Developments
Law of the Future Joint Action Programme The Law of the Future Joint Action Programme, initiated by HiiL in 2010, joins creative thinkers from academia and practice to reflect on alternative futures for law and legal systems and aims to provide both policy recommendations, research agendas and recommendation for legal training. It is based on the premise that prospective thinking about law is not only desirable but also required in order to ensure that law and legal systems do not become obsolete, ineffective or unjust. The Law of the Future Joint Action Programme is set up as a multi-stakeholder, multi-year process. HiiL actively seeks interaction with relevant and interested parties. One of the instruments in the Joint Action Programme is scenario building, a common strategy tool in business and academic disciplines such as economy and security studies, but uncommon in the field of law. The Law Scenarios to 2030 help prepare politicians, corporate executives and societal leaders for the legal challenges posed by global developments. The Law Scenarios to 2030 are linked to the Law of the Future Forum and the Law of the Future Monitoring Mechanism. The Law Scenarios to 2030, one of the first outcomes of the Law of the Future Joint Action Programme, will be exclusively presented at the Law of the Future Conference on 23 & 24 June 2011. www.lawofthefuture.org Hague Institute for the Internationalisation of Law Signposting the legal space of the future Anna van Saksenlaan 51 P.O. Box 93033, 2509 AA The Hague, The Netherlands T +31 70 349 -

Download (305Kb)
DOCUMENTATIECENTRUM NEDERLANDSE POLITIEKE PARTIJEN 120 Regeren is vooruitzien U en ik bereiden ons voor op een spannende verkiezingscampagne. W ij hebben tijdens het congres waarop ons verkiezingsprogramma werd vastgesteld al een voorproefje gehad. Zowel de sfeer als de aandacht van de media waren bemoedigend. De VVD is terug in de race en geeft leiding in de politieke discussie. Toen ons verkiezingsprogramma in september 1993 verscheen, zei iedereen dat de VVD zich dreigde te isoleren. 17 miljard bezuinigen, dat was toch niet van deze tijd. Zes maanden later is de kritiek verstomd. Want wij krijgen van alle kanten gelijk. Ten eerste hebben de kroonleden van de Sociaal-Economische Raad onze analyse onderschreven dat ombuigingen van 15 tot 20 miljard onont koombaar zijn om de banenmachine weer op gang te brengen. Het tweede punt waarop we gelijk zullen krijgen is het ombuigingsbedrag. In kringen van het CDA wordt al gesproken over een ombuiging van 17 miljard. Ik voorspel u dat ook D66 en PvdA hun ombuigingen aanzien lijk zullen ophogen. Dat isolement van ons wordt dus nog reuze gezel lig. De PvdA heeft ons plan van inzet van enkele tienduizenden werk lozen en arbeidsongeschikten in de sfeer van de criminaliteitsbestrijding vrijwel letterlijk overgenomen. Dat de PvdA onze ideeën overneemt, neem ik ze niet kwalijk. W at ik de PvdA wel kwalijk neem, is dat zij (en het CDA) niet thuis gaven toen de VVD- fractie al in 1992 bepleitte de politiesterkte met 10.000 mannen en vrouwen uit te breiden.(zie hiervoor VVD Expresse 79 en 80) In vier jaar regeren zijn er amper 300 politieagenten bijgekomen.