Hinein in Den KONSUMVEREIN
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

German Politics and the 'Jewish Question', 1914-1919
German Politics and the 'Jewish Question', 1914-1919 Lucia Juliette Linares Darwin College Dissertation submitted for the degree of Doctor of Philosophy August 2019 PREFACE I hereby declare that this dissertation is the result of my own work and includes nothing which is the outcome of work done in collaboration except as declared in the preface and specified in the text. It is not substantially the same as any other work that I have submitted, or, is being concurrently submitted for a degree or diploma or other qualification at the University of Cambridge or any other university or similar institution except as declared in the preface and specified in the text. I further state that no substantial part of my dissertation has already been submitted, or, is being concurrently submitted for any such degree, diploma or other qualification at the University of Cambridge or any other university or similar institution except as declared in the preface and specified in the text. It does not exceed the prescribed word limit for the Faculty of History. All translations are my own unless specified in the text. i ABSTRACT German Politics and the 'Jewish Question', 1914-1919 Lucia Juliette Linares The First World War confronted German politicians with a range of unprecedented, vital questions in the spheres of domestic as well as foreign policy. As the fortunes of war shifted, so did borders, populations and national allegiances. In a period of acute and almost constant political crisis, the German government faced issues concerning citizenship, minority rights, religious identity, nationhood and statehood. My dissertation analyses these issues through the prism of the so-called 'Jewish Question'. -

Einsicht 18 Bulletin Des Fritz Bauer Instituts
Einsicht 18 Bulletin des Fritz Bauer Instituts , »Volk«, »völkisch«, »Volksgemeinschaft« – Fritz Bauer Institut Kampfbegriffe der politischen Rechten Geschichte und bis zur Gegenwart Wirkung des Holocaust MMitit BBeiträgeneiträgen vvonon JJörnörn RRetterath,etterath, An-Institut der Goethe-Universität Frankfurt am Main HHajoajo FFunkeunke undund SteffenSteffen KailitzKailitz Psychosozial-Verlag Editorial Henri Parens Wolfgang Hegener Heilen nach dem Holocaust Heilige Texte Erinnerungen eines Psychoanalytikers Psychoanalyse und talmudisches Judentum 319 Seiten 251 Seiten Liebe Leserinnen und Leser, die mentalen Prägungen der »Volksgemeinschaft« waren allerdings Broschur • € 34,90 Broschur • € 32,90 nicht über Nacht getilgt. Zähe Kämpfe gegen eine strafrechtliche Auf- ISBN 978-3-8379-2731-3 ISBN 978-3-8379-2653-8 es bedurfte nicht der Forderung der AfD- arbeitung der NS-Vergangenheit in den 1950er Jahren zeugen ebenso Parteivorsitzenden nach einer positiven von solchen Kontinuitäten wie der schubweise auftretende Rechts- Besetzung des Begriffes »völkisch«, um radikalismus der folgenden Jahrzehnte. Bis heute sieht Funke diese Henri Parens schildert ein- Ausgehend von der Traum- hellhörig zu werden. Schon bevor sich mentalen Traditionen wirksam, nicht zuletzt in der AfD, die sich wieder drücklich seine Lebensge- deutung und der Anmer- Frauke Petry im Herbst 2016 in diesem der Begriffe »Volk«, »völkisch« und »Volksgemeinschaft« bedient. schichte, die von den Schre- kung Freuds, er behandle Sinne äußerte, war der Slogan »Wir Die »Ethnisierung« des Volksbegriffs, die die völkische Rechte cken des Holocaust bestimmt den Traum »wie einen hei- sind das Volk!«, der vermutlich auf die im frühen 20. Jahrhundert vorantrieb und die in der NS-Weltanschau- ist. Nicht zuletzt aufgrund ligen Text«, skizziert Wolf- Zeit des Vormärz zurückgeht und den ung gipfelte, beschreibt Steffen Kailitz in seinem Beitrag. -
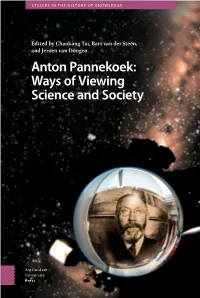
Anton Pannekoek: Ways of Viewing Science and Society
STUDIES IN THE HISTORY OF KNOWLEDGE Tai, Van der Steen & Van Dongen (eds) Dongen & Van Steen der Van Tai, Edited by Chaokang Tai, Bart van der Steen, and Jeroen van Dongen Anton Pannekoek: Ways of Viewing Science and Society Ways of Viewing ScienceWays and Society Anton Pannekoek: Anton Pannekoek: Ways of Viewing Science and Society Studies in the History of Knowledge This book series publishes leading volumes that study the history of knowledge in its cultural context. It aspires to offer accounts that cut across disciplinary and geographical boundaries, while being sensitive to how institutional circumstances and different scales of time shape the making of knowledge. Series Editors Klaas van Berkel, University of Groningen Jeroen van Dongen, University of Amsterdam Anton Pannekoek: Ways of Viewing Science and Society Edited by Chaokang Tai, Bart van der Steen, and Jeroen van Dongen Amsterdam University Press Cover illustration: (Background) Fisheye lens photo of the Zeiss Planetarium Projector of Artis Amsterdam Royal Zoo in action. (Foreground) Fisheye lens photo of a portrait of Anton Pannekoek displayed in the common room of the Anton Pannekoek Institute for Astronomy. Source: Jeronimo Voss Cover design: Coördesign, Leiden Lay-out: Crius Group, Hulshout isbn 978 94 6298 434 9 e-isbn 978 90 4853 500 2 (pdf) doi 10.5117/9789462984349 nur 686 Creative Commons License CC BY NC ND (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0) The authors / Amsterdam University Press B.V., Amsterdam 2019 Some rights reserved. Without limiting the rights under copyright reserved above, any part of this book may be reproduced, stored in or introduced into a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise). -

Examensarbeit Ina Seibel
Wissenschaftliche Hausarbeit für das Lehramt an Haupt- und Realschule eingereicht dem Amt für Lehrerausbildung. Thema: Frauenbewegung, Sozialdemokratie und Judentum Henriette Fürth als Randseiterin (1861-1938) Fach: Sozialkunde Dozent: Prof. Dr. Gerhard Wagner Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main Verfasserin: Ina Seibel E-Mail: [email protected] 1 Inhaltsverzeichnis Einleitung……………………………………………………………………………….. 4 I. Der Zeitkontext……………………………………………………………….… 7 1. Das Deutsche Reich…………………………………………………………….. 7 1.1 Die außenpolitische Dimension von der Gründung bis zum Ende…………. 7 1.2 Die innenpolitische Dimension mit den Konfliktlinien…………………….. 9 1.2.1 Protestanten und Katholiken…………………………………..……… 10 1.2.2 Alte und Junge………………………………………………………... 12 1.2.3 Christen und Juden…………………………………………………..... 13 1.2.4 Kapitalisten und Sozialisten………………………………………...… 16 1.2.5 Männer und Frauen………………………………………………..….. 18 1.2.6 Militär und Zivilgesellschaft…………………………………..……… 20 1.2.7 Fazit………………………..................…………………………...….. 22 2. Die Weimarer Republik……………………………………………..………….. 22 2.1 Die außenpolitische Dimension…………………………………….………. 22 2.2. Die innenpolitische Dimension…………………………………….………. 24 2.2.1 Protestanten und Katholiken…………………………………………. 27 2.2.2 Alte und Junge……………………………………………………….. 28 2.2.3 Christen und Juden……………………………………………...….… 29 2.2.4 Kapitalisten und Sozialisten…………………………………….……. 31 2.2.5 Männer und Frauen……………………………………………..……. 32 2.2.6 Militär und Zivilgesellschaft……………………………….………… 33 2.2.7 Fazit……………………………………………………………..……. -

Frank-Walter Steinmeier „Vorkämpfer Unserer Republik“
Frank-Walter Steinmeier „Vorkämpfer unserer Republik“ Zur Geschichte der Demokratie in Deutschland Texte und Reden 2018/2019 Frank-Walter Steinmeier „Vorkämpfer unserer Republik“ Zur Geschichte der Demokratie in Deutschland Texte und Reden 2018/2019 2 3 Frank-Walter Steinmeier „Vorkämpfer unserer Republik“ Zur Geschichte der Demokratie in Deutschland Texte und Reden 2018/2019 2 3 Inhalt Vorwort des Bundespräsidenten S. 4 „Es lebe unsere Demokratie“ S. 6 Rede bei der Gedenkstunde des Deutschen Bundestages zum 9. November 2018 9. November 2018, Berlin „Es ist an uns, diese historischen Errungenschaften S. 18 mit Leben zu füllen“ Rede beim Festakt „225 Jahre Mainzer Republik“ 19. März 2018, Mainz „Selbstverständlich war die Demokratie in diesem S. 28 Lande nie“ Namensbeitrag in der Wochenzeitung Die Zeit 14. März 2019 „Wir sollten die Weimarer Republik nicht länger nur von S. 36 ihrem Ende her betrachten“ Rede beim Festakt „100 Jahre Weimarer Reichsverfassung“ 6. Februar 2019, Weimar „100 Jahre Frauenwahlrecht sind Anlass zur Freude – S. 46 nicht nur für die Frauen“ Rede bei der Matinee „100 Jahre Frauenwahlrecht in Deutschland. Titelbild: Die verfassunggebende Deutsche Nationalversammlung im Nationaltheater Parität in der Politik“ in Weimar – Blick auf die Abgeordneten und den ersten Rang mit den Pressevertretern, Juni 1919 15. Januar 2019, Schloss Bellevue 4 5 Sie alle gilt es heute ebenso wiederzuentdecken wie die Revolutionäre von 1848, die Mütter und Väter unseres Grundgesetzes oder die Bürgerrechtlerinnen und Bürgerrechtler in der damaligen DDR. Denn sie alle sind Vorkämpfer unserer Republik. Sie führen uns vor Augen, was Einzelne zu leisten vermögen und was wir als Demokraten gemeinsam bewegen können. Vorwort des Bundespräsidenten Ich bin mir sicher: Aus der Geschichte unserer Demokratie können wir Mut und Zuversicht schöpfen. -

Das Ehe- Und Familienleitbild Der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands
Das Ehe- und Familienleitbild der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades einer Doktorin der Philosophie (Dr. phil.) am Fachbereich Politik- und Sozialwissenschaften Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaft der Freien Universität Berlin vorgelegt von Brigitte Unger-Soyka im April 2009 Erstgutachterin: Prof. Dr. Barbara Riedmüller Zweitgutachterin: PD Dr. Karin Schulze Buschoff Tag der mündlichen Prüfung: 7. Juli 2009 INHALTSVERZEICHNIS Einleitung .................................................................................................... 1 KAPITEL I THEORETISCHE AUSFÜHRUNGEN 1. Das Leitbild als wissenschaftlicher Begriff 1.1 Definitionen ......................................................................................... 7 1.2 Die Funktionen des Leitbildes............................................................ 10 1.3 Das Leitbild in Abgrenzung zu den Begriffen Ideal, Utopie, Ideologie und 13 Weltbild 1.4 Die Entwicklung des Leitbildes........................................................... 17 1.5 Die Institution als organisierte Verwirklichung von Leitbildern............ 19 2. Das Familienleitbild 2.1 Die historische Betrachtung des Familienbegriffs........................................ 26 2.2 Wissenschaftliche Ansätze zur Definition von Familie................................. 29 3. Die Familie in ihrem Verhältnis zur Gesellschaft .................................... 35 3.1 Das Verhältnis von Familie zu Gesellschaft bei Tyrell................................. -

Anton Pannekoek: Ways of Viewing Science and Society
UvA-DARE (Digital Academic Repository) Anton Pannekoek: Ways of Viewing Science and Society Tai, C.; van der Steen, B.; van Dongen, J. DOI 10.2307/j.ctvp7d57c 10.1515/9789048535002 Publication date 2019 Document Version Final published version License CC BY-NC-ND Link to publication Citation for published version (APA): Tai, C., van der Steen, B., & van Dongen, J. (Eds.) (2019). Anton Pannekoek: Ways of Viewing Science and Society. (Studies in the History of Knowledge). Amsterdam University Press. https://doi.org/10.2307/j.ctvp7d57c, https://doi.org/10.1515/9789048535002 General rights It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open content license (like Creative Commons). Disclaimer/Complaints regulations If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You will be contacted as soon as possible. UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl) Download date:26 Sep 2021 STUDIES IN THE HISTORY OF KNOWLEDGE Tai, Van der Steen & Van Dongen (eds) Dongen & Van Steen der Van Tai, Edited by Chaokang Tai, Bart van der Steen, and Jeroen van Dongen Anton Pannekoek: Ways of Viewing Science and Society Ways of Viewing ScienceWays and Society Anton Pannekoek: Anton Pannekoek: Ways of Viewing Science and Society Studies in the History of Knowledge This book series publishes leading volumes that study the history of knowledge in its cultural context. -

The Weimar Republic and the War of Memory
Southern Methodist University SMU Scholar The Larrie and Bobbi Weil Undergraduate Research Award Documents Fondren Library Spring 2020 The Weimar Republic and the War of Memory Madeline Dixon Southern Methodist University, [email protected] Follow this and additional works at: https://scholar.smu.edu/weil_ura Part of the European History Commons, and the Political History Commons Recommended Citation Dixon, Madeline, "The Weimar Republic and the War of Memory" (2020). The Larrie and Bobbi Weil Undergraduate Research Award Documents. 11. https://scholar.smu.edu/weil_ura/11 This document is brought to you for free and open access by the Fondren Library at SMU Scholar. It has been accepted for inclusion in The Larrie and Bobbi Weil Undergraduate Research Award Documents by an authorized administrator of SMU Scholar. For more information, please visit http://digitalrepository.smu.edu. The Weimar Republic and the War of Memory Madeline Dixon HIST 4300: Junior Seminar Dr. Hochman April 27, 2019 Dixon 2 This paper is about the havoc World War I unleashed on Germany and its impact on the Weimar Republic. While the war dismantled Imperial Germany, a second war soon began to brew within the newly-formed republic. This war over the memory of the Great War was a key player in Weimar’s destruction, and was rooted in differing interpretations of the war’s meaning, which existed as soon as the declarations of August 1914. The first of such narratives was the “Spirit of 1914,” an exuberant celebration of the war’s conception that took hold of Germans and drove them and their celebrations into the streets. -

JGA SEPT-OCT 2013.E$S ///JGA NOV/DEC 07
Volume 25, Number 6 Atlanta, Georgia September-October 2013 FREE Rabbi Emanual Feldman Shanah Tovah Rabbi Emeritus Congregation Beth Jacob (Photo: Cuba Family Archives for Southern Jewish History Collection at The Breman Museum) More Than Historic Space, Enduring Thanks The Jews of Anniston Resettling Refugees A Trip to Huntsville Marking Time New Face Its Jewish community has In retirement, Irwin grown smaller, but Atlanta’s Dale Schwartz is A vibrant Jewish communi- The Jewish calendars that Rabbi Rachael Bregman is Lowenstein continues to Anniston, Alabama, boasts the new national chair of ty is an essential part of the guide our lives are also fas- the new rabbi of acknowledge the people a financially stable congre- the Hebrew Immigrant Aid thriving city of Huntsville, cinating historical artifacts. Brunswick’s Temple Beth who made his career so gation that recently cele- Society. Alabama. Tefilloh. gratifying. brated its 125th anniversary. By Janice Rothschild By David Geffen By Mason Stewart By Rubin Stanley By Dr. Stuart Rockoff By Carolyn Gold Blumberg Page 25 Page 7 Page 4 Page 8 Page 21 Page 38 Page 2 THE JEWISH GEORGIAN September-October 2013 September-October 2013 THE JEWISH GEORGIAN Page 3 Page 4 THE JEWISH GEORGIAN September-October 2013 the Jewish community. In some towns, Understanding, compassion, and civility this fund covered bad checks given to are non-factors; resolution of problems is Update your GPS non-Jewish merchants and business estab- not a motivating force; imposing one’s lishments. position takes precedence. It is an accepted fact that an automo- Thank goodness things have changed In our life cycle, this is the period bile owner needs to have the vehicle tuned substantially, although we still have more when Judaism reminds us that it is time to and serviced at regular intervals to opti- work to do. -
Southern Jewish History
SOUTHERNSOUTHERN JEWISHJEWISH HISTORYHISTORY JOURNAL OF THE SOUTHERN JEWISH HISTORICAL SOCIETY VOLUME 22 1999 PERMISSION STATEMENT Consent by the Southern Jewish Historical Society is given for private use of articles and images that have appeared in Southern Jewish History. Copying or distributing any journal, article, image, or portion thereof, for any use other than private, is forbidden without the written permission of Southern Jewish History. To obtain that permission, contact the editor, Mark K. Bauman, at [email protected] or the managing editor, Bryan Edward Stone, at [email protected]. SOUTHERN JEWISH HISTORY Journal of the Southern Jewish Historical Society Mark K. Bauman, Editor Rachel B. Heimovics, Managing Editor 1999 Volume 2 Southern Jewish History proof page (i) (blind folio) Southern Jewish History Mark K. Bauman, Editor Rachel B. Heimovics, Managing Editor Editorial Board Solomon Breibart Leonard Rogoff Micah D. Greenstein Dale Rosengarten Patricia M. LaPointe Jason Silverman Bobbie S. Malone Ellen M. Umansky Raphael Medoff Saul Viener Lee Shai Weissbach Southern Jewish Historical Society OFFICERS: Bruce Beeber, President; Catherine C. Kahn, President-Elect; Patricia M. LaPointe, Secretary; Bernard Wax, Treasurer. BOARD OF TRUSTEES: Sandra Friedland, Juliet George, Mark Greenberg, Marcus Rosenbaum, Deborah Weiner, Hollace Weiner. Correspondence concerning author’s guidelines, contributions, and all editorial matters should be addressed to the Editor, Southern Jewish History, 2517 Hartford Dr., Ellenwood, GA 30294. The journal is interested in un- published articles pertaining to the Jewish experience in the American South. Southern Jewish History (SJH), is a publication of the Southern Jewish His- torical Society. Subscriptions are a benefit of membership. Send memberships ($30, $50, or $100 a year, $1000 for life) to PO Box 5024, Atlanta, GA 30302. -

CHAPTER VI Anti-Semitismrelevantofthetreitschke the National Prussian-German for Was Our Liberty Seewonproblem
CHAPTERVI "1 1. Treitschke'stheTreitschkeical Nationalliberalism. was politicalLiberty Anti-Bismarckian won Party,over,development likeby the so in manysuccess epitomizedthe constitutional Liberals of Bismarck's the with trend conflict whom ofmilitary German of he the joinedsolution 1860's, polit- in Soziologieanti-Semitismrelevantof Ofthe thePrussian-German for extensive der our deutschen seeproblem. Rosenberg,literature national Forakademischen theon Arthur: question.sociologicalTreitschke Reaktion,""Treitscbke two implications studies Die und Gesellschaft are dieof particularlyTreitschke's Juden. (Ber- Zur ofdoctrines")."Fremde'Treitschke'slin, Social 1930), Research, al vol. Schopfer(UnpublishedPrussia-cult II,pp. New 78völkischer York.)if.is manuscriptAgiven psychological Lehren" in Wolfgang in the (" interpretation 'Aliens'possession Hailgarten'sas creators of thethe studySaxonian Instituteof racial on 3.2. Treitschke,Oncompanywantedp.Jahrbücher, 4. occasion, the became Heinrich vols.emancipation however, 44 apparent andvon: Stoecker 45, "Em law 1879,at therevoked. Wortdid Separatabdruck,time side über of withHow unserthe the ill-at-ease"Anti-Semites' Judentum,"racial 3rd ed. anti-Semites he(Berlin, wasPreussische Petition." in 1880), theirwho 4. SpeechvincednamehadLiberal signed among noof opponents Marchone the the and petition. signers,4, damaged in1881, parliament went HeChristlich hisfirst into reputation. questioneddenied an Sozial, excited it and,bc. Stoecker "explanation" cit., then,p. whenas113. to whichwhether shown con- -

Political Parties, 4
Kitchener 2001 Batoche Books 52 Eby Street South Kitchener, Ontario N2G 3L1 Canada email: [email protected] Table of Contents Author's Preface. .................................................................................................... 5 Chapter 1. Democratic Aristocracy and Aristocratic Democracy .............. 7 Chapter 2. The Ethical Embellishment of Social Struggles. .................... 13 Part One / Leadership in Democratic Organizations. ........................................... 19 A. Technical and Administrative Causes of Leadership. ..................................... 19 Chapter 1. Introductory — The Need for Organization. .......................... 19 Chapter 2: Mechanical and Technical Impossibility of Direct Government by the Masses. .............................................................................. 20 Chapter 3: The Modern Democratic Party as a Fighting Party, Dominated by Militarist Ideas and Methods. .................................................. 31 B. Psychological Causes of Leadership. .............................................................. 33 Chapter 1. The Establishment of a Customary Right to the Office of Delegate. ...................................................................................... 33 Chapter 2. The Need for Leadership Felt by the Mass. ............................ 35 Chapter 3. The Political Gratitude of the Masses. ................................... 41 Chapter 4. The Cult of Veneration Among the Masses. .......................... 42 Chapter