Sportfunktionäre Und Jüdische Differenz
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Rapport Annuel 2012 Rapport Annuel 012 2
Rapport annuel 2012 Rapport annuel 2 012 Vue d’ensemble Avant-propos du Président central 04 Présidents centraux de l’ASF 05 Table des matières 06 Les partenaires 08 L’Association Suisse de Football (ASF) 10 Le football en Suisse 18 Rapports 28 Finances 58 Clubs et joueurs 86 Statistiques 92 Distinctions 126 Décès 140 03 Avant-propos du Président central Des évolutions réjouissantes, des chiffres et des faits impressionnants L’année 2012 a été marquée par deux événements de taille pour le monde du sport: l’UEFA EURO 2012™ en Pologne et en Ukraine, et les Jeux Olympiques de Londres. La phase finale de l’EURO s’est malheureusement déroulée sans la Suisse. Le 1er juillet, lorsque l’Espagne a battu l’Italie à Kiev par 4 buts à 0, je pensais au fait que la Suisse est le pays qui avait infligé sa dernière défaite à l’Espagne. Notre victoire par 1:0 le 16 juin 2010 à Durban durant la Coupe du Monde de la FIFA 2010™ en Afrique du Sud revêt par là-même une tout autre dimension. Aujourd’hui, quand je regarde le début des qualifications pour la prochaine Coupe du Monde, en 2014 au Brésil, j’ai bon espoir que nous jouions à nouveau un rôle important. Dix points en quatre matches, c’est un bon début: la Suisse est sur la bonne voie. Nous savons que le chemin vers le Brésil est encore long et semé d’embûches, mais nous savons aussi qu’Ottmar Hitzfeld, l’entraîneur de notre équipe nationale, dispose d’une sélection qui incarne le «bon dosage», comme on a pu l’entendre de joueurs jeunes et chevronnés, qui a développé une remarquable mentalité de gagnant et qui affiche une grande solidarité. -

Matthias Sindelar, El Mozart Del Fútbol
Cuadernos de Fútbol Revista de CIHEFE https://www.cihefe.es/cuadernosdefutbol Matthias Sindelar, el Mozart del fútbol. Autor: Vicente Martínez Calatrava Cuadernos de fútbol, nº 15, noviembre 2010. ISSN: 1989-6379 Fecha de recepción: 05-10-2010, Fecha de aceptación: 17-10-2010. URL: https://www.cihefe.es/cuadernosdefutbol/2010/11/matthias-sindelar-el-mozart-del-futbol/ Resumen Matthias Sindelar está considerado por muchos como el futbolista austriaco más grande de todos los tiempos. Nació el 10 de febrero de 1903 en la región de Moravia, que actualmente se encuentra integrada en la República Checa, y a los dos años de edad su familia se trasladó a Viena con la esperanza... Date : 1 noviembre 2010 Matthias Sindelar está considerado por muchos como el futbolista austriaco más grande de todos los tiempos. Nació el 10 de febrero de 1903 en la región de Moravia, que actualmente se encuentra integrada en la República Checa, y a los dos años de edad su familia se trasladó a Viena con la esperanza de encontrar en la capital del imperio Austro-húngaro un futuro más próspero del que les esperaba en su tierra natal. Sin embargo la pérdida de su padre durante la Primera Guerra Mundial, le obligó a trabajar como aprendiz de cerrajero para ajudar económicamente a su familia. Fue en las calles y plazas vienesas donde el joven Matthias comenzó a dar muestras de sus facultades futbolísticas y allí, jugando con sus amigos, fue descubierto por Karl Wiemann, quien fascinado por sus habilidades hizo todo lo posible por incorporarlo a la plantilla del filial del Hertha de Viena, cuando aún no había cumplido los dieciseis años. -

AUSWÄRTSFAHRT: MIT DEM BUS NACH EBREICHSDORF! (Seite 12) Restik H Erbert T Oto: Oto: F
AUSGABE #14 - 13. 5. 2016 WWW.WIENERSPORTKLUB.AT Saison alszeilen 2015/16 DAS SCHWARZ-WEISSE STADIONMAGAZIN AUSWÄRTSFAHRT: MIT DEM BUS NACH EBREICHSDORF! (seite 12) restik T erbert H oto: oto: F DAS ZIEL: BUNDESLIGA SPONSORENVERLOSUNG: INTERVIEW MIT SV horn- LOS KAUFEN OBMANN RUDOLF LAUDON UND GEWINNEN! (SEITEN 10 & 11) (SEITE 8) SPIELBERICHTE: AUSTRIA (A) & HORN (SEITEN 4 & 5) Hauptsponsor Co-Sponsoren EIS UM TE A R B TROMAYERwww.tromayerbau.at BAUges.m.b.h. Partner Mitglieder EVA BIELER VERLAG Förderer Anhängervereinigung Fotoevent Juwelier Holzhammer Mag. Peter-Erik Sas Baldinger & Partner Hauptstadt.at Jimmy Müller Sigi Chips Corn foto Oliver Heiß Music Ticket Silver Server digidruck Christian Hetterich Michael Orou Dr. Kurt Stürzenbecher Edelschrott Josef Hruby Volker Piesczek Karl Sveda Einkaufsstraße Hernalser Gai Jäger Dr. Klemens Pospischil Turbofanny Hauptstraße WORTE VOM PRÄSE LAYOUT UND PRODUKTION DER STADIONZEITUNG IST EINE EHRENAMTLICHE LEISTUNG DER FHT FÜR DEN WIENER SK IM RAHMEN DER INITIATIVE COME TOGETHER - WORK TOGETHER ofer H Impressum Herausgeber und Medieninhaber Christian Wiener SK, Alszeile 19, 1170 Wien oto: F ZVR 3611 62422 Redaktion Manfred TROMAYER Christian Orou (Präsident) Texte Zed Eisler, fht, Chris Peterka, Christian Orou, Adi Solly, Michael Strausz, Manfred Tromayer, Peter Wackerlig erte Sportklubfreundinnen und -freunde! Artdirektion & Layout erte Fans! Christian Orou, Dario Sommer w Fotos Christian Hofer (www.FOTObyHOFER.at), Günther Pfefferkorn, Jetzt schon die Weichen stellen Alex Prückler, Christian Sokop, Adi Solly, SV Horn, Herbert Trestik, Peter Wackerlig, Fotoarchiv Wiener SK Der Zug in Richtung Rückführung hat wieder Fahrt aufgenom- Lektorat men. Ende des nächsten Spieljahres kann es zu einer Fusion Peter Wackerlig kommen, der Fußball in Dornbach spielt dann wieder mit „C“. -

Diplomarbeit
Diplomarbeit Titel der Diplomarbeit „Mythos Rapid - Fankommunikation und kollektives Gedächtnis im modernen Fußball“ Verfasser Martin Hell angestrebter akademischer Grad Magister der Philosophie (Mag. phil.) Wien, im Juli 2009 Matrikelnummer: 0001299 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A301 300 Studienrichtung lt. Studienblatt: Publizistik- und Kommunikationswissenschaft Betreuer: Ao. Univ.-Prof. Dr. Peter Vitouch Danksagung Ich danke allen Menschen, die ich kennen lernen durfte und mich in meinem Leben beeinflusst haben. Es liegt an uns Fans dass zu bewahren, was Rapid wirklich ausmacht: TRADITION, KAMPFGEIST & LEIDENSCHAFT! (GO WEST, Fanzine der UR – 1/08, vom 27.2.2008) Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung ................................................................................................................................1 2 Themenabgrenzung .................................................................................................................4 2.1 Das System des modernen Fußballs .................................................................................4 2.2 Der Fan .............................................................................................................................6 2.3 Rassismus und Gewalt......................................................................................................8 3 Gruppensoziologie.................................................................................................................11 3.1 Die Gruppe – Definition und Klassifikation ..................................................................11 -

Bibliothekskatalog
Bibliothekskatalog ABADI, M. (1960). Renacimiento de edipo. Buenos Aires ; edition nova ABELIN, E. (1971). Esquisse d'une théorie éthiopathogenique unifiée des schizophrénies. ABEND, S.; PORDER, M. S. & WILLICK, MARTI S. (1983). Borderline Patients - Psychoanalytic Perspectives. ; International Universities Press (IUP) ABRAHAM, H. (1976). Karl Abraham. Muenchen ; Kindler ABRAHAM, H. C. & FREUD, ERNST L. (1965). Sigmund Freud - Karl Abraham - Briefe 1907-1926. Frankfurt ; Fischer ABRAHAM, KARL (1909). Traum und Mythos. Wien ; Deuticke ABRAHAM, KARL (1924). Versuch einer Entwicklungsgeschichte der Libido auf Grund der Psychoanalyse seelischer Stoerungen. Zuerich ; Verlag Internationale Psychoanalyse ABRAHAM, KARL (1925). ed. Klinische Beitraege zur Psychoanalyse aus den Jahren 1907-1921. Zuerich ; Verlag Internationale Psychoanalyse ABRAHAM, KARL (1925). Psychoanalytische Studien zur Charakterbildung. Zuerich ; Verlag Internationale Psychoanalyse ABRAHAM, KARL (1949). Selected Papers of Karl Abraham. London ; Hogarth Press ABRAHAM, KARL (1971). Psychoanalytische Studien - Gesammelte Werke. Band 1/2. Frankfurt ; Fischer ADLER, A. (1910). Ueber den Selbstmord, insbesondere den Schuelerselbstmord. Wiesbaden ; Bergmann ADLER, A. (1912/1919). Ueber den nervoesen Charakter. Wiesbaden ; Bergmann ADLER, A. (1920). Praxis und Theorie der Individualpsychologie. Muenchen ; Bergmann ADLER, A. (1935). Ueber den Sinn des Lebens. Wien ; Passer ADLER, A. & FURTMUELLER, C. (1914). Heilen und Bilden. Muenchen ; Reinhardt ADLER, G. (1934). Entdeckung der Seele. Zuerich ; Rascher ADLER, G. (1985). Borderline Psychopathology and Its Treatment. New York ; Aronson AEPPLI, E. (1943). Der Traum und seine Deutung. Erlenbach bei Zuerich ; Rentsch AICHHORN, AUGUST (1925/1931//1951/1957). Verwahrloste Jugend. Zuerich/Bern ; Verlag Internationale Psychoanalyse/Huber AICHHORN, AUGUST (1959). Erziehungsberatung und Erziehungshilfe. Bern ; Huber AICHHORN, AUGUST (1976). Wer war August Aichhorn? - Briefe, Dokumente... Wien ; Loecker und Woegenstein AISENSTEIN, M.; FINE, A. -

Bibliography Publications of the Institute Vienna Circle 1991–2018
FAKULTÄT FÜR PHILOSOPHIE UND 1991–2018 BILDUNGSWISSENSCHAFT VERZEICHNIS VERÖFFENTLICHUNGEN DES INSTITUTS WIENER KREIS 1991–2018 BIBLIOGRAPHY PUBLICATIONS OF THE INSTITUTE VIENNA CIRCLE 1991–2018 Inhaltsverzeichnis / Table of Contents Abkürzungsverzeichnis / List of Abbreviations….………………………………………...2 ÜBERSICHT DER BUCHREIHEN / OVERVIEW OF BOOK SERIES Institut Wiener Kreis Jahrbuch / Vienna Circle Institute Yearbook………….………..…3 Institut Wiener Kreis Bibliothek / Vienna Circle Institute Library………………….…….4 Veröffentlichungen des Instituts Wiener Kreis / Publications of the Institute Vienna Circle……………………………………………..….4 Veröffentlichungen des Instituts Wiener Kreis/Sonderbände / Publications of the Institute Vienna Circle/Special Volumes…:…………………………5 Wissenschaftliche Weltauffassung und Kunst / Scientific World Conception and Art………………………………………………….…….6 Weitere ausgewählte Veröffentlichungen / Further selected publications……………..6 Editionen/Weitere Reihen / Editions/Further Series………...……………….…………..7 INHALT DER BÜCHER / CONTENT OF BOOKS Artikel / Articles……………………………………………………………………………...10 Rezensionsartikel / Review Essays………………………..…………………….…….....64 Rezensionen / Reviews…………………………………………………………………….65 Berichte/Dokumente / Report/Documentation.……………………………………...…...71 Veröffentlichte Wiener Kreis Vorlesungen / Published Vienna Circle Lectures………74 Impressum…………………………………………………………………………………...75 1 Abkürzungsverzeichnis / List of Abbreviations VCIYB – Vienna Circle Institute Yearbook (Springer Verlag) VCIL – Vienna Circle Institute Library (Springer -

Pinchbet / Spreadsheet 2015 - 2017 (24 March '15 - 31 January '17) ROI TOT.: 5.9 % B TOT.: 6,520 TOT
ROI October '16: 9.27% (398 bets), ROI November '16: -4.22% (688 bets), ROI December '16: 2.11% (381bets), ROI January 2.11% (565bets) '16: -1.05% (688bets), ROI December (398bets),-4.22% '17: ROI November 9.27% '16: '16: ROI October (283bets) -3.0% '16: (262bets), ROI September (347bets), 3.10% ROI August 6.39% (405bets), ROI July'16: 6.9% (366bets),'16: ROI JuneROI May 0.5% '16: '16: (219bets), ROI January 4.9% (642bets), ROI February '15: 7.8% (460bets) ROI December (512bets), ROI March (325bets), 0.9% ROI April-6.1% 1.4% '16: '16: '16: (323bets) (269bets), 8.5% ROI November 9.6% '15: '15: (386bets), ROI October 4.1% '15: (337bets), ROI September ROI August7.5% '15: (334bets) 24% (72 bets), ROI July 2.7% (304bets), '15: (227bets), ROI June (49ROI MayROI March9.9% bets), ROI April0.4% '15: 20.3% '15: '15: '15: ROI TOT.: 5.9 % BROI DAY:TOT.: 5.9 % EUR / 11.1 AVG. B 6,153 TOT.: 6,520 TOT.RETURN: PinchBet / SpreadSheet 2015 - 2017 PinchBet - 2017 / SpreadSheet 2015 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 0 1 228 455 682 909 1136 1363 1590 1817 2044 2271 '17) January - 31 March'15 (24 2498 2725 2952 3179 3406 3633 3860 Return (EUR) Return 4087 4314 4541 4768 4995 5222 5449 5676 5903 6130 6357 6584 6811 7038 7265 7492 7719 7946 Trend line Return (EUR) No. Bets Return (EUR) January '17 January '17 December '16 December '16 November '16 November '16 October '16 October '16 September '16 September '16 August '16 August '16 July '16 July '16 June '16 June '16 May '16 May '16 April '16 April '16 March '16 March'16 February '16 February '16 No. -

(2019). the Rings and the Swastika: Political Ambiguity in Sport Before and During Second World War
This file was dowloaded from the institutional repository Brage NIH - brage.bibsys.no/nih Goksøyr, M. (2019). The Rings and the Swastika: Political Ambiguity in Sport before and during Second World War. International Journal of the History of Sport, 36(11), 998-1012. https://doi.org/10.1080/09523367.2019.1687448 Dette er siste tekst-versjon av artikkelen, og den kan inneholde små forskjeller fra forlagets pdf-versjon. Forlagets pdf-versjon finner du her: https://doi.org/10.1080/09523367.2019.1687448 This is the final text version of the article, and it may contain minor differences from the journal's pdf version. The original publication is available here: https://doi.org/10.1080/09523367.2019.1687448 MAIN DOCUMENT The Rings and the Swastika: Political Ambiguity in Sport before and during WWII Keywords: Olympics, Nazism, war, sports, politics Abstract: As WWII emerged and eventually unfolded, sport's context changed from a sense of normalcy to increased political tension and eventually to war. In this article, I will discuss the role of sport and how sports organizations responded to the increasing hostilities. What happens to the claimed ‘un-political sport’ when the context in which it takes place becomes ever more politicized? Should sport take a stand or should it stick to the favourite position of Western sporting officials in the 1930s that ‘sport and politics should not mix’? What can be sport’s main contribution in times of conflict and war? Although I shall here have a particular emphasis on the small, occupied nations in Europe, I shall also discuss the attitudes and politics of the IOC and other international sports organizations in the critical years leading up to and into the war: Was it possible to keep the Olympics going? Based on recent research with primary and secondary sources, archive materials from the IOC and other organizations, as well as international research literature, I conclude that sport’s symbolic ambiguity as it related to peace and war was reflected in the different ways in which sportspeople and organizations reacted to WWII. -
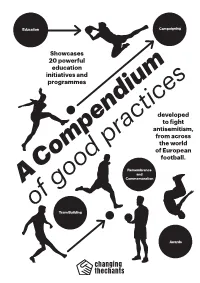
A Compendium of Good Practices
1 Education Campaigning Showcases 20 powerful education initiatives and programmes developed to fight antisemitism, from across the world of European football. CompendiumRemembrance and A Commemoration of good practices Team Building Awards 2 What are you reading ? This Compendium of good practices showcases 20 power- ful education initiatives and programmes, developed to fight antisemitism, from across the world of European football. The Compendium is not the definitive list of all noteworthy initiatives, nor is it an evaluation of a selection of programmes which are considered to be the best which exist; its aim is, rather, to highlight some of the existing practices - from workshops to commemoration plaques and remembrance trips to online campaigns – in the hope they might spark interest and motivate clubs, associations, fan groups and other stakeholders within or associated with the football community to develop their own practices. The initiatives were selected as a result of research conducted by a group of eight researchers and experts from across Europe who were all part of the Changing the Chants project. They conducted desk research and interviewed stake- holders connected to these initiatives. As a result, for every initiative the Compendium provides project background and context and an overview of what took place. Due to the limited scope of this Compendium, it has not been possible to analyse all these good practices in great depth and, as such, readers of this Compendium are invited and encouraged to seek out further information where further detail has not been provided. Categorization The practices have been categorised against five overarching themes: Campaigning (1), Education (2), Remembrance and com- memoration (3), Network building (4) and Awards (5). -

Obituary: W. Ernest Freud (1914 –2008)
International PSYCHOANALYSIS News Magazine of the International Psychoanalytical Association Volume 17, December 2008 Obituary: W. Ernest Freud (1914 –2008) W. Ernest Freud is best known as the 18-month-old child that Sigmund Freud observed playing ‘fort, da’ and described in Beyond the Pleasure Principle (1920). What is less known is that he was also Freud’s only grandchild to become a psychoanalyst. Once, when asked when his psychoanalytic training began, W. Ernest Freud replied, ‘In my mother’s belly.’ Ernest was the son of Freud’s second daughter, Sophie Freud, and Max Halberstadt, a portrait photographer. He was born Ernst Wolfgang Halberstadt on 11 March 1914 in Hamburg, Germany, but changed his name to W. Ernest Freud after the Second World War, partly because he felt his German sounding name would be a liability in post-war England and partly because he always felt closer to the Freud side of his family. When Ernest was born, Freud sent a note to Sandor Ferenczi: ‘Dear friend, Tonight (10th/11th) at 3 o’clock a little boy, my first grandchild! Very strange! An oldish feeling, respect for the wonders of sexuality!’ (Brabant, 1993, p. 545) Ernest’s life was full of tragedy and courage, love and work. He enjoyed a blissful infancy with his mother, while his father was at war; and when his father returned, Ernest experienced him as an unwelcome intruder. When Ernest was four, his brother, Heinerle, was born and he too was experienced as an intruder. After the war, Sophie became pregnant again but contracted the Spanish Flu and died, with her third baby in her womb. -

PDF Downloaden
Quellen- und Literaturverzeichnis Archivbestände Arquivo Publico do Estado do Rio de Janeiro [Öffentliches Archiv des Staates Rio de Janeiro] Einzelakten Bundespolizeidirektion (BPD) Wien, Büro für Vereins-, Versammlungs- und Medienrechtsangelegenheiten Vereinsakten Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (DÖW) Datenbank Namentliche Erfassung der österreichischen Holocaustopfer Einzelakten Archiv der Israelitischen Kultusgemeinde Wien (IKG Wien) Bestand Wien Bestand Jerusalem Matriken der Israelitischen Kultusgemeinde Wien (IKG Wien) Geburtsmatriken Heiratsmatriken Library of Congress, Washington Einzelakten National Archives of Australia (NAA) Einzelakten National Archives, Riverside California (NARA) Einzelakten Österreichisches Staatsarchiv (ÖStA) Archiv der Republik (AdR) Bundeskanzleramt, Bundeskanzleramt-Inneres (BKA BKA-I) Bundesministerium für Justiz 2. Republik (1945–2004) (Justiz BMJ 2Rep Präs) Bundesministerium für Handel und Verkehr, 1918–1941 (Vk BMfHuV) Bundesministerium für Soziale Verwaltung, Volksgesundheit (AuS BMfsV VG Präs) Entschädigungs- und Restitutionsangelegenheiten, Finanzlandesdirektion (E-uReang FLD) Entschädigungs- und Restitutionsangelegenheiten, Hilfsfonds (AdR E-uReang Hilfsfonds) Entschädigungs- und Restitutionsangelegenheiten, Vermögensverkehrsstelle (E-uReang VVSt) Zivilakten der NS-Zeit, Stillhaltekommissar Wien (ZNsZ Stiko Wien) Haus-, Hof- und Staatsarchiv (HHStA) Staatsnotariat, Staatssiegelamt, Oberster Verwalter des Hofärars (HA OVdHÄ) Open Access. © 2019 Bernhard Hachleitner, Matthias -

Wien NSDAP Und Staatliche Verwaltung
25 E‘ 3 Die NSDAP.- Gaule'itung Wien Sitz der Gauleitung: Wien I]1, Gauhaus, Joseph-Biirckel-Ring 3, Ruf 5 05 60. 10 Kreise, 315 Ortsgruppen. Gauleiter: Reichsleiter Baldur von Schirach, Ill, Gauhans, Joseph-Biimkel-Ring 3, Rui 'R5 05 60. Adjutant: Reichshauptstellenleiter Franz W i e s h 0 f e r, I/ 1, Gauhaus, Joseph-Biirckel-Ring 3, Ruf R 5 05 60. Stellvertretender Gauleiter: H-Brigadefiihrer Karl S e h a r i z e r, Ill, Gauhaus, Joseph-Biirckel-Ring 3, Ruf R 5 0'5 60. Adjutant: Gauhauptstellenleite'r Franz ‘E m h 0 f e r, Ill, Gauhaus, Joseph-Biirckel-Ring 3, Ruf R 5 05 60. Gauiimter: Amt fiir Kriegsopfer der NSDAP. (NSKOV.): Dr. Albrecht M a i e r. , Gaugeschaftsfiihrer: Heinrich L a u b e, I/1, Gauhaus, NSD.-Studentenbund: Hubert F r e i s l e b e n, Iii/66, Kolin- Rut R 5 05 60. _ ‘ - gasse 19, Ruf A 1 85 30. Gauins ektion I nnd H: Erich Rothe, Ill, Gauhaus, NSD.-D0zentenbnnd: Dr. Kurt K n 0 ll, Ill, Universitiit, Ru R 5 05 60. Ruf A 2 00 72. Gauorganis'ationsamt: Dr. Raimund GruB, I/1, Ganhaus, Ruf R 5 05 60. Amt fiir Technik (NS.-Bund Deutscher Technik):,Ingenieur Gaupersonalamt: mit der Leitung beauftragt: Emil Wilhelm A n s elm, I/1, Eschenbachgasse 9, Rut B 2 35 50. V 01k m e r, Ill, Gauhaus, Ruf R 5 05 60. Gaugericht: Dr. Karl N 0 s k 0, Ill, Gauhaus, Ruf R 5 05 60.