L-G-0003899472-0006661161.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
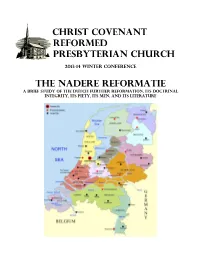
Nadere Reformatie Lecture 1
CHRIST COVENANT Reformed PRESBYTERIAN CHURCH 2013-14 WINTER CONFERENCE THE NADERE REFORMATIE A Brief Study of the Dutch Further Reformation, its doctrinal integrity, its piety, its men, and its Literature Nadere Reformatie Lectures-Pastor Ruddell’s Notes 1) The Name: Nadere Reformatie a) The name itself is a difficult term. It has been translated as: i) Second Reformation: As a name, the second reformation has something to be said for it, but it may give the impression that it is something separate from the first reformation, it denies the continuity that would have been confessed by its adherents. ii) Further Reformation: This is the term that is popular with Dutch historians who specialize in this movement. This term is preferred because it does set forth a continuity with the past, and with the Protestant Reformation as it came to the Netherlands. Its weakness is that it may seem to imply that the original Reformation did not go far enough—that there ought to be some noted deficiency. iii) The movement under study has also been called “Dutch Precisianism” as in, a more precise and exacting practice of godliness or piety. The difficulty here is that there are times when that term “precisionist” has been used pejoratively, and historians are unwilling to place a pejorative name upon a movement so popular with godly Dutch Christians. iv) There are times when the movement has been referred to as “Dutch Puritanism”. And, while there is much to commend this name as well, Puritanism also carries with it a particular stigma, which might be perceived as unpopular. -

Literaturverzeichnis in Auswahl1
Literaturverzeichnis in Auswahl1 A ADAMS, THOMAS: An Exposition upon the Second Epistle General of St. Peter. Herausgegeben von James Sherman. 1839. Nachdruck Ligonier, Pennsylvania: Soli Deo Gloria, 1990. DERS.: The Works of Thomas Adams. Edinburgh: James Nichol, 1862. DERS.: The Works of Thomas Adams. 1862. Nachdruck Eureka, California: Tanski, 1998. AFFLECK, BERT JR.: „The Theology of Richard Sibbes, 1577–1635“. Doctor of Philosophy-Dissertation: Drew University, 1969. AHENAKAA, ANJOV: „Justification and the Christian Life in John Bunyan: A Vindication of Bunyan from the Charge of Antinomianism“. Doctor of Philosophy-Dissertation: Westminster Theological Seminary, 1997. AINSWORTH, HENRY: A Censure upon a Dialogue of the Anabaptists, Intituled, A Description of What God Hath Predestinated Concerning Man. & c. in 7 Poynts. Of Predestination. pag. 1. Of Election. pag. 18. Of Reprobation. pag. 26. Of Falling Away. pag. 27. Of Freewill. pag. 41. Of Originall Sinne. pag. 43. Of Baptizing Infants. pag. 69. London: W. Jones, 1643. DERS.: Two Treatises by Henry Ainsworth. The First, Of the Communion of Saints. The Second, Entitled, An Arrow against Idolatry, Etc. Edinburgh: D. Paterson, 1789. ALEXANDER, James W.: Thoughts on Family Worship. 1847. Nachdruck Morgan, Pennsylvania: Soli Deo Gloria, 1998. ALLEINE, JOSEPH: An Alarm to the Unconverted. Evansville, Indiana: Sovereign Grace Publishers, 1959. DERS.: A Sure Guide to Heaven. Edinburgh: Banner of Truth Trust, 1995. ALLEINE, RICHARD: Heaven Opened … The Riches of God’s Covenant of Grace. New York: American Tract Society, ohne Jahr. ALLEN, WILLIAM: Some Baptismal Abuses Briefly Discovered. London: J. M., 1653. ALSTED, JOHANN HEINRICH: Diatribe de Mille Annis Apocalypticis ... Frankfurt: Sumptibus C. Eifridi, 1627. -

Hidden Lives: Asceticism and Interiority in the Late Reformation, 1650-1745
Hidden Lives: Asceticism and Interiority in the Late Reformation, 1650-1745 By Timothy Cotton Wright A dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in History in the Graduate Division of the University of California, Berkeley Committee in charge: Professor Jonathan Sheehan, chair Professor Ethan Shagan Professor Niklaus Largier Summer 2018 Abstract Hidden Lives: Asceticism and Interiority in the Late Reformation, 1650-1745 By Timothy Cotton Wright Doctor of Philosophy in History University of California, Berkeley Professor Jonathan Sheehan, Chair This dissertation explores a unique religious awakening among early modern Protestants whose primary feature was a revival of ascetic, monastic practices a century after the early Reformers condemned such practices. By the early seventeenth-century, a widespread dissatisfaction can be discerned among many awakened Protestants at the suppression of the monastic life and a new interest in reintroducing ascetic practices like celibacy, poverty, and solitary withdrawal to Protestant devotion. The introduction and chapter one explain how the absence of monasticism as an institutionally sanctioned means to express intensified holiness posed a problem to many Protestants. Large numbers of dissenters fled the mainstream Protestant religions—along with what they viewed as an increasingly materialistic, urbanized world—to seek new ways to experience God through lives of seclusion and ascetic self-deprival. In the following chapters, I show how this ascetic impulse drove the formation of new religious communities, transatlantic migration, and gave birth to new attitudes and practices toward sexuality and gender among Protestants. The study consists of four case studies, each examining a different non-conformist community that experimented with ascetic ritual and monasticism. -

Title Page R.J. Pederson
Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/22159 holds various files of this Leiden University dissertation Author: Pederson, Randall James Title: Unity in diversity : English puritans and the puritan reformation, 1603-1689 Issue Date: 2013-11-07 UNITY IN DIVERSITY: ENGLISH PURITANS AND THE PURITAN REFORMATION 1603-1689 Proefschrift ter verkrijging van de graad van Doctor aan de Universiteit Leiden, op gezag van Rector Magnificus prof. mr. Carel Stolker volgens besluit van het College voor promoties te verdedigen op 7 November 2013 klokke 15:00 uur door Randall James Pederson geboren te Everett, Washington, USA in 1975 Promotiecommissie Promotores: Prof. dr. Gijsbert van den Brink Prof. dr. Richard Alfred Muller, Calvin Theological Seminary, Grand Rapids, Michigan, USA Leden: Prof. dr. Ernestine van der Wall Dr. Jan Wim Buisman Prof. dr. Henk van den Belt Prof. dr. Willem op’t Hof Dr. Willem van Vlastuin Contents Part I: Historical Method and Background Chapter One: Historiographical Introduction, Methodology, Hypothesis, and Structure ............. 1 1.1 Another Book on English Puritanism? Historiographical Justification .................. 1 1.2 Methodology, Hypothesis, and Structure ...................................................................... 20 1.2.1 Narrative and Metanarrative .............................................................................. 25 1.2.2 Structure ................................................................................................................... 31 1.3 Summary ................................................................................................................................ -

TMSJ 5/1 (Spring 1994) 43-71
TMSJ 5/1 (Spring 1994) 43-71 DOES ASSURANCE BELONG TO THE ESSENCE OF FAITH? CALVIN AND THE CALVINISTS Joel R. Beeke1 The contemporary church stands in great need of refocusing on the doctrine of assurance if the desirable fruit of Christian living is to abound. A relevant issue in church history centers in whether or not the Calvinists differed from Calvin himself regarding the relationship between faith and assurance. The difference between the two was quantitative and method- ological, not qualitative or substantial. Calvin himself distinguished between the definition of faith and the reality of faith in the believer's experience. Alexander Comrie, a representative of the Dutch Second Reformation, held essentially the same position as Calvin in mediating between the view that assurance is the fruit of faith and the view that assurance is inseparable from faith. He and some other Calvinists differ from Calvin in holding to a two-tier approach to the consciousness of assurance. So Calvin and the Calvinists furnish the church with a model to follow that is greatly needed today. * * * * * Today many infer that the doctrine of personal assurance`that is, the certainty of one's own salvation`is no longer relevant since nearly all Christians possess assurance in an ample degree. On the contrary, it is probably true that the doctrine of assurance has particular relevance, because today's Christians live in a day of minimal, not maximal, assurance. Scripture, the Reformers, and post-Reformation men repeatedly 1Joel R. Beeke, PhD, is the Pastor of the First Netherlands Reformed Congregation, Grand Rapids, Michigan, and Theological Instructor for the Netherlands Reformed Theological School. -

Post-Reformation Reformed Sources and Children1
Post-Reformation Reformed sources 1 and children A C Neele Jonathan Edwards Center Yale University (USA) Abstract This article suggests that the topic “children” received considerable attention in the post-Reformation era – the period of CA 1565-1725. In particular, the author argues that the post-Reformation Reformed sources attest of a significant interest in the education and parenting of children. This interest not only continued, but intensified during the sixteenth-century Protestant Reformation when much thought was given to the subject matter. This article attempts to appraise the aim of post-Reformation Reformed sources on the topic “children.” 1. INTRODUCTION The theology of the post-Reformation era, which includes Puritanism, German Pietism and the Nadere Reformatie – a Dutch intra-ecclesiastical movement – has been appraised as a period of theological divergence from the sixteenth- century Protestant Reformation (Corley, Lemke & Lovejoy 2002:119).2 More precise, its theology has been characterized as dogmatic mostly rigid and polemic; that is an abstract doctrine with little or no regard for practical significance. Furthermore, the post-Reformation concern for doctrine has been regarded as leading to the relapse to Scholasticism and the neglect of the vitality of the Reformers’ humanism, such as John Calvin (1509-1564) (Ritschl 1880:86; Van der Linde 1976:47; Van’t Spijker 1993:13-14 & Graafland 1961:66). In addition, these and other scholars note an aberration in the theology of the Nadere Reformatie from the sixteenth-century 1 This article is based on a paper presented at the annual meeting of Church Historians of Southern Africa, University of Stellenbosch, 16-18 January, 2006. -

Scholasticism and the Problem of Intellectual Reform
Tilburg University Introduction Wisse, P.M.; Sarot, M. Published in: Scholasticism reformed Publication date: 2010 Link to publication in Tilburg University Research Portal Citation for published version (APA): Wisse, P. M., & Sarot, M. (2010). Introduction: Reforming views of reformed scholasticism. In P. M. Wisse, M. Sarot, & W. Otten (Eds.), Scholasticism reformed: Essays in honour of Willem J. van Asselt (Published on the occasion of the retirement of Willem J. van Asselt from Utrecht University) (pp. 1-27). (Studies in theology and religion; No. 14). Brill. General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research. • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Download date: 30. sep. 2021 Reforming Views of Reformed Scholasticism Introduction Maarten Wisse and Marcel Sarot 1 Introduction The title of the present work is intentionally ambiguous: Scholasticism Reformed. It may be read, firstly, as a simple reversion of “Reformed scholasticism,” as indeed some of the contributions to this volume study aspects of the type of theology between the early Reformation and the Enlightenment that continued to use the traditional methods rooted in the medieval period. -

Titelgegevens / Bibliographic Description
Titelgegevens / Bibliographic Description Titel From pure church to pious culture. The further Reformation in the sevemteenth-century Dutch Republic / Fred A. van Lieburg. Auteur(s) Lieburg, F.A. van In Later calvinism. International perspectives / red.: W. Fred Graham. (Kirksville, Sixteenth Century Journal Publisher, 1994), p. 409-429. (Sixteenth century essays & studies; 22). Copyright 2006 / F.A. van Lieburg | Sixteenth Century Journal Publisher | Claves pietatis. Producent Claves pietatis / 2007.08.30; versie 1.0 Bron / Source Onderzoeksarchief / Research Archive Nadere Reformatie Website Sleutel tot de Nadere Reformatie Nummer B98013607 De digitale tekst is vrij beschikbaar voor The digital text is free for personal use, persoonlijk gebruik, voor onderzoek en for research and education. Each user onderwijs. Respecteer de rechten van de has to respect the rights of the copyright rechthebbenden. Commercieel gebruik holders. Commercial use is prohibited. is niet toegestaan. Het 'Onderzoeksarchief Nadere The 'Research Archive Nadere Reformatie' bevat digitale documenten Reformatie' contains digital documents over het gereformeerd Piëtisme en de about reformed Pietism and the Nadere Nadere Reformatie in Nederland tot Reformatie in the Netherlands until 1800. Het is doorzoekbaar met de 1800. These can be retrieved by 'Bibliografie van het gereformeerd searching the 'Bibliography of the Piëtisme in Nederland (BPN)' op de reformed Pietism in the Netherlands website 'Sleutel tot de Nadere (BPN)' database at the 'Sleutel tot de Reformatie'. Nadere Reformatie' website. 408 Later Calvinism The Netherlands 1550 Chapter 20 From Pure Church to Pious Culture: The Further Reformation in the Seventeenth-Century Dutch Republic Fred A. van Lieburg The Further Reformation was a pietistic movement within the Dutch Reformed Church during the seventeenth century. -

MEILICHA DÔRA Poems and Prose in Greek from Renaissance and Early Modern Europe Societas Scientiarum Fennica
Commentationes Humanarum Litterarum 138 2020 MEILICHA DÔRA Poems and Prose in Greek from Renaissance and Early Modern Europe Edited by Mika Kajava, Tua Korhonen and Jamie Vesterinen Societas Scientiarum Fennica The Finnish Society of Sciences and Letters MEILICHA DÔRA Poems and Prose in Greek from Renaissance and Early Modern Europe Societas Scientiarum Fennica The Finnish Society of Sciences and Letters Address: Pohjoinen Makasiinikatu 7 A 6, FI – 00130 Helsinki In Swedish: Finska Vetenskaps-Societeten, Norra Magasinsgatan 7 A 6, FI – 00130 Helsingfors In Finnish: Suomen Tiedeseura, Pohjoinen Makasiinikatu 7 A 6, FI – 00130 Helsinki Commentationes Humanarum Litterarum The series, founded in 1923, publishes monographs or other studies on antiquity and its tradition. Editor: Prof. Mika Kajava Address: Department of Languages, P. O. Box 24, FI – 00014 University of Helsinki. Requests for Exchange: Exchange Centre for Scientific Literature, Snellmaninkatu 13, FI – 00170 Helsinki, or at the Secretary of the Society. Distribution and Sale: Tiedekirja, Snellmaninkatu 13, FI – 00170 Helsinki; [email protected], www.tsv.fi. Other series published by the Society: Commentationes Physico-Mathematicae Commentationes Scientiarum Socialium Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk The History of Learning and Science in Finland 1828-1918 Årsbok – Vuosikirja (Yearbook), serie A sarja Sphinx (Årsbok – Vuosikirja, serie B sarja) Commentationes Humanarum Litterarum 138 2020 MEILICHA DÔRA Poems and Prose in Greek from Renaissance and Early Modern Europe -

Adobe Photoshop
Migration and Religion Christian Transatlantic Missions, Islamic Migration to Germany Chloe Beihefte zum Daphnis Herausgegeben von Barbara Becker-Cantarino – Mirosława Czarnecka Franz Eybl – Klaus Garber – Ferdinand van Ingen Knut Kiesant – Ursula Kocher – Wilhelm Kühlmann Wolfgang Neuber – Hans-Gert Roloff – Alexander Schwarz Ulrich Seelbach – Robert Seidel – Jean-Marie Valentin Helen Watanabe-O’Kelly BAND 46 Amsterdam - New York, NY 2012 Migration and Religion Christian Transatlantic Missions, Islamic Migration to Germany Edited by Barbara Becker-Cantarino Cover Photo: Persian Tile. Photo by Vicente Calabuig Cantarino The paper on which this book is printed meets the requirements of “ISO 9706:1994, Information and documentation - Paper for documents - Requirements for permanence”. ISBN: 978-90-420-3536-2 E-Book ISBN: 978-94-012-0811-6 © Editions Rodopi B.V., Amsterdam - New York, NY 2012 Printed in The Netherlands CONTENTS Preface…………………………………………………………………………1 Barbara Becker-Cantarino: Religion and Migration: Christian Missionaries in North America, Muslim Populations in Germany……………………………………………………….5 Wolfgang Breul: Theological Tenets and Motives of Mission: August Hermann Francke, Nikolaus Ludwig von Zinzendorf……………………………………………41 Pia Schmid: Indians Observed: Moravian Missionary John Heckewelder’s Account of the History, Manners, and Customs of the Indian Nations (1819)….….……..…61 Ulrike Gleixner: Remapping the World: The Vision of a Protestant Empire in the Eighteenth Century……………………………………………………………………….77 Ulrike Strasser: From “German -

Titelgegevens / Bibliographic Description
Titelgegevens / Bibliographic Description Titel Embracing Leer and Leven: the theology of Simon Oomius in the context of Nadere Reformatie orthodoxy / by Gregory D. Schuringa. Auteur(s) Schuringa, G.D. Details Grand Rapids, Michigan, [s.n.], 2003. IX, 349 p. Copyright 2007 / G.D. Schuringa | Claves pietatis. Producent Claves pietatis / 2007.08.30; versie 1.0 Bron / Source Onderzoeksarchief / Research Archive Nadere Reformatie Annotatie(s) Proefschrift Calvin Theological Seminary. Website Sleutel tot de Nadere Reformatie Nummer B06002127 De digitale tekst is vrij beschikbaar voor The digital text is free for personal use, persoonlijk gebruik, voor onderzoek en for research and education. Each user onderwijs. Respecteer de rechten van de has to respect the rights of the copyright rechthebbenden. Commercieel gebruik holders. Commercial use is prohibited. is niet toegestaan. Het 'Onderzoeksarchief Nadere The 'Research Archive Nadere Reformatie' bevat digitale documenten Reformatie' contains digital documents over het gereformeerd Piëtisme en de about reformed Pietism and the Nadere Nadere Reformatie in Nederland tot Reformatie in the Netherlands until 1800. Het is doorzoekbaar met de 1800. These can be retrieved by 'Bibliografie van het gereformeerd searching the 'Bibliography of the Piëtisme in Nederland (BPN)' op de reformed Pietism in the Netherlands website 'Sleutel tot de Nadere (BPN)' database at the 'Sleutel tot de Reformatie'. Nadere Reformatie' website. CALVIN THEOLOGICAL SEMINARY EMBRACING LEER AND LEVEN: THE THEOLOGY OF SIMON OOMIUS IN THE CONTEXT OF NADERE REFORMATIE ORTHODOXY A DISSERTATION SUBMITTED TO THE FACULTY OF CALVIN THEOLOGICAL SEMINARY IN CANDIDACY FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY BY GREGORY D. SCHURINGA GRAND RAPIDS, MICHIGAN MAY 2003 Copyright © 2003 by Gregory D. -

Causality and Morality in Politics
Causality and Morality in Politics The Rise of Naturalism in Dutch Seventeenth-Century Political Thought HansW.Blom Causality and morality in politics Causality and morality in politics The rise of naturalism in Dutch seventeenth-century political thought Hans Willem Blom Rotterdam 1995 cip-gegevens koninklijke bibliotheek, den haag Blom, Hans Willem Causality and morality in politics : the rise of naturalism in Dutch seventeenth-century political thought / Hans Willem Blom. -[S.l. : s.n.] Proefschrift Universiteit Utrecht. -Met index, lit. opg. - Met samenvatting in het Nederlands. isbn 90-9007917-3 Trefw.: naturalisme in de politiek / politieke filosofie / Nederland ; politieke geschiedenis ; 17e eeuw. Typeset in Trinité (roman wide 2), typeface designed by Bram de Does. Printed by Offsetdrukkerij Ridderprint bv, Ridderkerk. Cover illustration: Atlas supporting the heavens, cast plaster model, presumably by Artus Quellien. ‘Burgerzaal’ of the Royal Palace (built 1648 till late 1660’s as town hall), Amsterdam. parentibus uxorique Reproduction by courtesy of the Stichting Koninklijk Paleis te Amsterdam Contents Preface 7 chapter i Morality and causality in politics 9 A naturalist conception of politics /10/ Passions and politics /13/ Naturalism /16/ Is–ought: some caveats /19/ History of political philosophy: distance and similarity /21/ The historical theses /25/ The core of the argument /29/ chapter ii Dutch political thought and institutions 33 Causes and intentions explaining Dutch political thought /34/ Between political strength