Forschungen Zur Baltischen Geschichte 9 / 2014
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Tours and Experiences
• HIGHLIGHTS OF THE BALTIC STATES IN 8 DAYS. An agenda of local best hits to spend a week in Baltic countries. Ask for 2020 guaranteed departure dates! • BALTICS AND SCANDINAVIA IN 10 DAYS. Discover the facinating diversity of the Baltics and Scandinavia. • BALTICS AND BELARUS IN DAYS. Get an insider’s view to all three Baltic states of Lithuania, Latvia and Estonia and spice up your travel experience with a visit to Belarus Baltics is an ideal place for soft adventure or walking holidays. You can really get a good sense of the diversity of natural beauty in our countries. You can walk the shoreline, wander through river valleys and forests, or just watch the landscape. The landscape is full of nature. There are wonderful paths in national parks and other areas that are under environmental protection. Allow yourself 8-14 days to walk and bus/train in between from Vilnius to Tallinn. NATIONAL PARKS & CITIES. Combination of National parks and Cities. Bike, Hike, Kayak, Walk and Taste Baltic States in this 13 day adventure. Day1. Vilnius. Arrival day. Day2. Vilnius walking tour. Day3. Hiking and kayaking in Aukštaitijos National Park. Day4. Free time in a homestead (sauna, bikes, walks and relax time). Day5. Road till Klaipėda port town. Walking in the city & Brewery visiting. Day6. Curonian Spit visiting (or biking half way). Day7. Rundale palace on a way to Riga. Day8. Riga day tour. Day9. Gauja National Park half-day walking trip. Day 10. Visiting Parnu on a way to Tallinn. Day 11. Tallinn walking tour. Day 12. Lahemaa bog shoes trekking tour with a picnic. -

Turaida. Turaida Ravines and Caves
6 km TURAIDA. TURAIDA RAVINES AND CAVES Gūtmaņala Cave Tracks in Gauja valley Photo: Baltic Pictures and the Archive of Sigulda TIC Turaida Castle Description Distance Starting point/ destination For travellers interested in the nature ~ 6 km. Parking lot at the Gūtmaņala Cave and culture monuments located on Visitor Centre. 24.84699, 57.17633 the banks of the old Gauja valley. The Route reason why fortified settlements by Gūtmaņala Cave Visitor Centre – Way marking Livs later followed by monolith stone Vikmeste Valley – Mounds Taurētāju None on site. castles erected by Germans were and Rata – Mound Kārļa – Turaida established here are the natural – Turaida Museum Reserve – Dainu Distance to Riga conditions and geologic processes kalns or the Hill of Folksongs – stairs 55 km. over the last 10,000–15,000 years and leading down from Dainu kalns to the consequences thereof — complicated River Gauja – Turaidas Street (Igauņu Public transportation terrain, steep ravines and rock Ravine) – Gūtmaņala Cave Visitor The train Riga-Sigulda operates 8-9 pillars on banks in the places of their Centre. times per day; Turaida is reached by interactions, onto which castles were bus (buses going to Krimulda or In- erected. Were the primeval valley not Duration ciems), bus stop “Turaida”, electric formed by the glacier, the nature and Half-day or a full day route. car, or on foot (5 km). culture landscape of Sigulda would be completely different! Difficulty level Worth knowing! Moderate. Some sections — banks Suitable trekking footwear and a Best time to go of the primeval valley of the River map of Turaida is needed. -
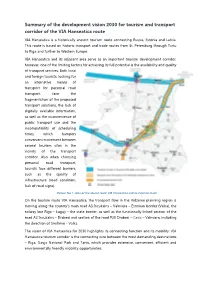
Summary of the Development Vision 2030 for Tourism and Transport Corridor of the VIA Hanseatica Route
Summary of the development vision 2030 for tourism and transport corridor of the VIA Hanseatica route VIA Hanseatica is a historically ancient tourism route connecting Russia, Estonia and Latvia. This route is based on historic transport and trade routes from St. Petersburg through Tartu to Riga and further to Western Europe. VIA Hanseatica and its adjacent area serve as an important tourism development corridor, however, one of the limiting factors for achieving its full potential is the availability and quality of transport services. Both local and foreign tourists, looking for an alternative means of transport for personal road transport, face the fragmentation of the proposed transport solutions, the lack of digitally available information, as well as the inconvenience of public transport use and the incompatibility of scheduling times, which hampers convenient movement between several tourism sites in the vicinity of the transport corridor. Also when choosing personal road transport, tourists face different barriers, such as the quality of infrastructure (road condition, lack of road signs). Picture No 1: Area of the tourist route VIA Hanseatica and its external reach On the tourism route VIA Hanseatica, the transport flow in the Vidzeme planning region is moving along the country's main road A3 Incukalns – Valmiera – Estonian border (Valka), the railway line Riga – Lugaji – the state border, as well as the functionally linked section of the road A2 Incukalns – Drabesi and section of the road P20 Drabesi – Cesis – Valmiera, including the direction of Smiltene - Valka. The vision of VIA Hanseatica for 2030 highlights its connecting function and its mobility: VIA Hanseatica tourism corridor is the connecting wire between the most demanding destinations – Riga, Gauja National Park and Tartu, which provides extensive, convenient, efficient and environmentally friendly mobility opportunities. -

Animal-Watching in Gauja National Park
ANIMAL-WATCHING IN GaUJA NATIONAL PARK Fox (Vulpes vulpes) Roe Deer (Capreolus capreolus) Red deer (Cervus elaphus) Photo: Vilnis Skuja WHY GAUJA NATIONAL PARK IS A SUITABLE PLACE TRACES OF ANIMALS APPROVE THE PRESENCE OF TO WATCH ANIMALS? THEM! In total, 52 out of the slightly above 60 animal (mammals) species Patient and careful nature watchers should look for footprints of Latvia have been registered in the territory of the park. There and traces of animal activities. A careful watcher will spot bushes is a dense network of hiking, cycling, and canoeing routes in and young deciduous trees, coniferous trees gnawed by deer and the park, thus creating access to nearly every spot in the park, elks, as well as their droppings. Wild boar dug-ups are seen both except for the nature reserve zones. Due to agriculture activities, on fields and in the forest. The wild pigs are looking for acorns, here are quiet many open areas to spot the animals more easily. plant roots, and sometimes underground mushrooms! Animal And they are drawn there by the products grown in the farms. droppings are seen on roads, paths, and trails, and thinner ground Sometimes you do not have to walk deep into a forest, as animals covers. Some droppings of mammals reveal not only species, but also gender, age, health conditions, and even their menu! A true can be seen on roadsides. world of footprints is seen in winter – try identifying the animals! It is often the case the animals have made a true road instead WHAT ANIMALS CAN BE SEEN IN GAUJA NATIONAL of a small path leading to the food storage places, particularly PARK? haylage, of farmers. -

Vidzeme Planning Region Sustainable Development Strategy 2030 Mazsalaca Municipality Naukšēni Municipality
VIDZEME PLANNING REGION SUSTAINABLE DEVELOPMENT STRATEGY 2030 MAZSALACA MUNICIPALITY NAUKŠĒNI MUNICIPALITY VALKA MUNICIPALITY VIDZEME STRENČI MUNICIPALITY KOCĒNI MUNICIPALITY SMILTENE MUNICIPALITY BEVERĪNA MUNICIPALITY APE MUNICIPALITY RŪJIENA MUNICIPALITY ALŪKSNE MUNICIPALITY BURTNIEKI MUNICIPALITY VALMIERA CITY GULBENE MUNICIPALITY RAUNA MUNICIPALITY JAUNPIEBALGA MUNICIPALITY The booklet is VECPIEBALGA MUNICIPALITY nanced by the Norwegian Financial Mechanism programme 2009–2014 No. LV 07 PĀRGAUJA MUNICIPALITY “Capacity-building and Institutional Cooperation between Latvian and CĒSIS MUNICIPALITY LUBĀNA MUNICIPALITY Norwegian Public Institutions, Local PRIEKUĻI MUNICIPALITY CESVAINE MUNICIPALITY and Regional Authorities” project No. 4.3–24/NFI/INP–002 “Increasing territorial development planning capacities of planning regions and local governments of Latvia and elaboration of development planning documents” VARAKĻĀNI MUNICIPALITY MADONA MUNICIPALITY LĪGATNE MUNICIPALITY AMATA MUNICIPALITY AMATA ĒRGĻI MUNICIPALITY ĒRGĻI Vidzeme Region Any development is based on vision, planning and adherence to targets. This is the way, which we are paving today in order to lay the foundation for future prosperity. We hand you Vidzeme Planning Region Sustainable Development Strategy 2030 and Chairman of Vidzeme Planning Vidzeme Planning Region Development Region Development Programme 2015–2020. Council These documents can be considered as a guide to Hardijs Vents strengthen intentions and abilities of people living and working in Vidzeme to promote sustainable -

Lower Gauja Spillway Valley at Sigulda
Late Quaternary Terrestrial Processes, Sediments and History: from Glacial to Postglacial Environments STOP 1: Lower Gauja spillway valley at Sigulda Māris Krievāns, Vitālijs Zelčs and Māris Nartišs University of Latvia The stop (24°50'2"E, 57°10'15"N, for location see Fig. 1.1) at the Krimulda Castle ruins in Sigulda introduces the geological structure, morphology and formation of the River Gauja valley and slope processes between the towns of Valmiera and Vangaži. This stretch of the river valley, also known as the Lower Gauja spillway valley, is about 110 km long. The spillway is confined to an ancient buried valley incised into Middle and Upper Devonian sedimentary rock (Pērkons 1947). The oversized river valley is 1-2.5 km wide and reaches a depth of 25 m near Valmiera, 35-40 m in the vicinity of Cēsis and 85 m at Sigulda. The floor of the bedrock within the valley lies at 17-18 m a.s.l. near Valmiera, 12 m b.s.l. in the vicinity of Cēsis and more than 50 m b.s.l. at Sigulda (Fig. 1.2). It is significant that downstream of Cēsis the ancient valley is carved into weakly-cemented and/or soft Devonian terrigenous rock that runs along the lithological boundary with carbonate rock. Fig. 1.1. Geomorphological map of the River Gauja valley and the adjacent area between Valmiera town and Murjāņi village. 1 – Lower Gauja spillway valley; 2 – valleys of tributaries; 3 – largest gullies; 4 – late-glacial delta plains; 5 – glaciolacustrine plains; 6 – ancient shorelines of glacial lakes; 7 – ice-contact and bedrock scarps; 8 – till plains; 9 – ice marginal ridges; 10 – morainic hills; 11 – cupola-like hills; 12 – drumlins; 13 – glaciofluvial plains; 14 – kames; 15 – inland dunes; 16 – mires; 17 – Strenči proglacial lake; 18 – Silciems ice- dammed lake; 19 – Zemgale ice-dammed lake; 20 – Līgatne ice-dammed lake; black circle – location of the stop. -

Soft Adventures at the Gauja National Park
ADVENTURE TOUR / INDIVIDUAL Soft Adventures at the Tallinn Gauja National Park The tour is based in the picturesque Gauja National Park with its main value – the river Gauja ancient valley. The tour will allow to enjoy cycling through forests filled with birds Ventspils Rīga songs, visit several castles, stop at charming provincial towns and take old fashioned ferry across the river. Walks at Līgatne Nature Trails give insite into local wildlife - brown bears, moose, wild boar and others. Canoying the river Gauja allows different perspec- tive to the river bank with wonderful views to the sandy outcrops. Vilnius Daily cycling distances: ~30-55 km (8 Days) General Route: Rīga - Valmiera - km), picturesque trail along Gauja River Cēsis - Sigulda - Rīga Valley. Canoeing from Cēsis to Līgatne (~17 km, 4-5 h) which is one of the pic- Day 1 turesque parts of the river Gauja where Arrival in Rīga sand stone banks are visible. Cycle from Additional: Transfer to the hotel. Pick up River Gauja to Līgatne Nature Park (~4 the info package with maps and the de- km, 98% tarmac). Cycling at the Līgatne tailed itinerary at the hotel’ s reception. Nature Park (5,1 km, 100% tarmac) is ex- Attractions of Rīga include medieval cellent way to watch local wild animals Hanseatic Old Town, Art Nouveau district, (such us brown bear, woolves, foxes, red Central market and boat trip along the deers, wild boar and elks). Further nature canal and the river Daugava. Overnight trails possible: the trail of the untouched Sigulda castle ruins in Rīga. nature in the fern glen (1,3 km) and the trail along the river Gauja (1,3 km). -

Vacations in Enter Gauja Manors This Is Your Opportunity to Savour the Jewels That Noblemen Have Safeguarded in the Cusp of the Forest for Time Eternal
EN Vacations in Enter Gauja Manors This is your opportunity to savour the jewels that noblemen have safeguarded in the cusp of the forest for time eternal. Venture forth, rapt in contemplation, essaying your brush back and forth over the canvas, listening to the paint plotting its way into the canvas, and sipping tea in the manor garden, where you will hear the tick tock of the venerable lord’s clock. We invite you to discover Latvia, travelling through time and enjoying the tranquility of the historic residences of the aristocracy fanned by centuries of impressive history. The authentic hospitality of the nobility awaits you, along with the opportunity to step into the world of Latvia’s nobility and to encounter its broad heritage, as well as to embark on a stately journey amid impressive settings nestling among painterly landscapes. During your journey, you will be welcomed at the most important manor houses, castles and palaces in the Gauja region, offering fine dining and accommodation options, and an eclectic offering of additional services, ranging from tours recreating the epochs of the nobility through to scenic horse carriage excursions through the Latvian countryside. TURAIDA MUSEUM RESERVE FROM THE HISTORY Turaida’s historical centre has developed over the course of more than 1,000 years. The events A TREASURE TROVE OF TESTIMONIES TO HISTORY that have taken place here are closely linked to the course of Latvian and European history. Around the 11th century, the Livonian people began living on the shores of the Gauja in Turaida. The rhythm of their daily life was closely attuned to nature. -

The Botanical Tour of Vidzeme
BOTANICAL TOUR / GROUP The Botanical Tour of Vidzeme Tallinn This tour is planned to show a variety of habitat found in different types of forests, wetlands as well as sea coast. The tour will pass some impressive ancient trees and beautiful landscapes. Along with some rare and endangered plants you could spot Rīga different types of butterflies and dragonflies. The tour involves some longer walks and historic monuments along the way. Vilnius (5 Days) Tansy (Tanacetum vulgare) Wild pansy (Viola tricolor) Common sea-buckthorn (Hippophae rhamnoides) General Route: Rīga - Salacgrīva - pathway leads through the meadows, Valmiera - Sigulda - Līgatne - Rīga and at the end of the path is a bird watch- ing tower. Possible plants of interest: Ba- Day 1 trachium baudotii, Beakead Tasselweed Arrival in Rīga (Ruppia maritime), Small Spikerush (Eleo- Overnight in Rīga. charis parvula), Blinks (Montia fontana), European Searocket (Crambe maritime), Day 2 Siberian Bugseed (Corispermum inter- Rīga - Salacgrīva medium), Seaside Centaury (Centaurium Departure along the Vidzeme sea coast. littorale), Smallmarsh Rush (Juncus gerar- The rocky shoreline of Vidzeme is a dii), Strawberry Clover (Trifolium fragifer- unique and rocky phase of the eastern um) as well as different orchid species. shore of the Bay of Rīga, with small cliffs Overnight in Salacgrīva. Northern firmoss (Huperzia selago) from the Devonian period along the shoreline. You can hike for 4-5 kilome- Day 3 tres along the seashore from the Vec- Salacgrīva - Valmiera zemu cliffs (Mantiņi) to Meleki. Possible Departure. The Dambju oak tree, Kaņepju plants of interest: Sea Sandwort (Hon- oak tree and Baložu juniper tree are all ckenya peploides), European Searocket in the Northern Gauja Protected Land- (Cakile maritima), Lime-grass (Leymus scape Region, and from the perspective arenarius) as well as very rare Pincushion of biological diversity, it is a unique terri- Moss (Leucobryum glaucum). -

Adventures of the Dormouse at the Gauja National Park
EN ADVENTURES OF THE DORMOUSE AT THE GAUJA NATIONAL PARK TRAVEL GUIDE FOR FAMILIES AND CHILDREN 1 2 / Leisure Park “Rāmkalni” Lēdurga Dendrological A nice place for families: rodeling Park track, bicycle and boat rental, other Go on an exploring adventure thrilling adventures. Tasty meals through Lēdurga Dendrological and local produce sold right on the Park, where you can enjoy the magic spot. of the fairy-tale forest, take a look at “Vītiņkalni”, ph. +371 29100280, the Bug hotel, legendary Mudurga www.ramkalni.lv Great stone, forest tepees, wooden GPS 57.1248, 24.6585 sculptures and the horoscope circle. Make your own jewelry, runes and Krimulda Swimming Pool bows. Feel the nature! Learn to swim or train in a “Dendroparks”, Lēdurga, 25-meter pool, catch water bubbles ph. +371 25549747 in the small pool with the kids, and www.ledurgasdendroparks.lv enjoy the water cascade. Relax in GPS 57.3142,24.7596 sauna, steambath and enjoy our gym! Kubesele Nature & History Skolas Street 11, Ragana trail ph. + 371 26161322, Enjoy the power of Latvia’s GPS: 57.1828,24.6968 wilderness – the wild flow of Golf club ”Reinis” Runtiņupīte River, the Big Stone, Learn how to play golf or go on mysterious caves, hills and vales. an exciting journey through Gauja Enjoy the winding Gauja River and National Park forests on foot or by have a picnic there. bike. Rest in Reiņa Café, spend the GPS 57.1636, 24.7684 night in the cosy holiday cabin and enjoy the summer together with Inčukalns Devil’s Cave your family! Historic site, a place where “Kalnzaķi”, ph. -

Tourist Map Vidzeme
Tourist attractions 1 14. Live Silver Museum. Silver sculptures 15 29. Līgatne Nature Trails. Wild animals, 29 43. Rauna medieval castle ruins and 43 57. Gulbene – Alūksne Banitis. Narrow- 57 and ornaments, excursion at the museum birds, viewing tower, walkabouts in the Lutheran church. Viewing platform at the gauge railway, hand railcar, excursions, and workshop, live silver water tasting. forest, excursions. castle tower, excursion. activities, lodging. 1. Daugava Museum. Dole manor | Limbaži, +371 29356858, | Līgatnes pagasts, +371 64153313, | Raunas pagasts, +371 27775764, | Gulbene, +371 20228884, house, history expositions, fishermen's [email protected], [email protected], www.visitligatne.lv +371 64177014, [email protected], [email protected], www.banitis.lv •D3 tools, park, dolomite detrition, bird www.sudrabamuzejs.lv •A2 •B3 www.rauna.lv •B2 watching. 58. Gulbene Regional History and | Salaspils novads, +371 67216367, 15. Bīriņi Palace. 19th century Neo- 30. Līgatne Paper Factory Village. 44. Lielā Ellīte. Sandstone caves and Art Museum. Exhibitions, interactive Free of charge. of Free [email protected], 2 Gothic style building, hotel, restaurant, 16 19th century wooden buildings, cellar 30 arcs, spring, old sacred place. 44 environment, activities, excursions. 58 Jānis Zilvers, Valdis Skudre, Shutterstock.com, Dreamstime.com Shutterstock.com, Skudre, Valdis Zilvers, Jānis SPA, horse riding, lake, boat rent, nature caves, crafts workshops, bridges, mills, Liepas pagasts, +371 29362837, Gulbene, +371 64473098, Photos: Investment and Development Agency of Latvia, Reinis Hofmanis, Jānis Bautra, Bautra, Jānis Hofmanis, Reinis Latvia, of Agency Development and Investment Photos: www.daugavasmuzejs.lv •A4 | | trails, excursions. excursions. [email protected], +371 26128984, [email protected], 2. -

EPICAH State of Art Report
EPICAH State of Art Report (To be developed based on existing studies, the policy instrument documents, the online survey results, the local stakeholders group meetings and knowledge and experience of the partners) Policy instrument addressed Interreg VA Estonia-Latvia Partner involved in the state of Peipsi Center for Transboundary Cooperation art report writing Sent to the partnership in 1 Contents A. Brief characterization of border area ...................................................................... 3 B. Brief characterization of the policy instrument addressed and other existing policy / strategic instruments ............................................................................................. 8 C. Cross-border natural heritage ................................................................................... 8 D. Cross-border cultural heritage ................................................................................ 12 E. Cross-border tourism ................................................................................................ 15 F. Good Practices ............................................................................................................ 18 In the field of cross-border natural heritage ......................................................................... 18 In the field of cross-border cultural heritage ........................................................................ 19 In the field of cross-border tourism ........................................................................................