Mooskurs Uni Hohenheim 3
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
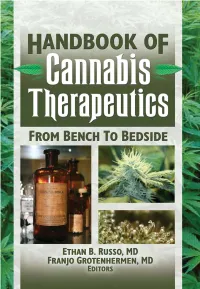
The Handbook of Cannabis Therapeutics: from Bench to Bedside
Handbook of Cannabis Therapeutics From Bench to Bedside 9780789030979 Handbook of Cannabis Therapeutics From Bench to Bedside Size: 212 x 152mm Spine size: 26 mm Color pages: Binding: Paperback THE HAWORTH PRESS® Haworth Series in Integrative Healing Ethan Russo Editor The Last Sorcerer: Echoes of the Rainforest by Ethan Russo Professionalism and Ethics in Complementary and Alternative Medicine by John Crellin and Fernando Ania Cannabis and Cannabinoids: Pharmacology, Toxicology, and Therapeutic Potential by Franjo Grotenhermen and Ethan Russo Modern Psychology and Ancient Wisdom: Psychological Healing Practices from the World’s Religious Traditions edited by Sharon G. Mijares Complementary and Alternative Medicine: Clinic Design by Robert A. Roush Herbal Voices: American Herbalism Through the Words of American Herbalists by Anne K. Dougherty The Healing Power of Chinese Herbs and Medicinal Recipes by Joseph P. Hou and Youyu Jin Alternative Therapies in the Treatment of Brain Injury and Neurobehavioral Disorders: A Practical Guide edited by Gregory J. Murrey Handbook of Cannabis Therapeutics: From Bench to Bedside edited by Ethan B. Russo and Franjo Grotenhermen Handbook of Cannabis Therapeutics From Bench to Bedside Ethan B. Russo, MD Franjo Grotenhermen, MD Editors Routledge Taylor &. Francis Croup NEW YORK AND LONDON First Published by The Haworth Press, Inc., 10 Alice Street, Binghamton, NY 13904-1580. Transferred to Digital Printing 2010 by Routledge 270 Madison Ave, New York NY 10016 2 Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon, OX14 4RN For more information on this book or to order, visit http://www.haworthpress.com/store/product.asp?sku=5741 or call 1-800-HAWORTH (800-429-6784) in the United States and Canada or (607) 722-5857 outside the United States and Canada or contact [email protected] © 2006 by The Haworth Press, Inc. -

Marchantia References 1986-2006 Mp Cpgenome To
Marchantia literature 1986-2006 Mp CpGenome to Genome Project Marchantia literature 1986-2006 Mp CpGenome to Genome Project Adam, K.-P., and H. Becker, 1993 A lectin from the liverwort Marchantia polymorpha L. Experimentia 49: 1098-1100. Adam, K.-P., R. Thiel, J. Zapp and H. Becker, 1998 Involvement of the Mevalonic Acid Pathway and the Glyceraldehyde–Pyruvate Pathway in Terpenoid Biosynthesis of the Liverworts Ricciocarpos natans and Conocephalum conicum. Archives of Biochemistry and Biophysics 354: 181-187. Adam, K. P., and H. Becker, 1994 Phenanthrenes and Other Phenolics from in-Vitro Cultures of Marchantia-Polymorpha. Phytochemistry 35: 139-143. Akashi, K., J. Hirayama, M. Takenaka, S. Yamaoka, Y. Suyama et al., 1997 Accumulation of nuclear- encoded tRNA(Thr)(AGU) in mitochondria of the liverwort Marchantia polymorpha. Biochimica Et Biophysica Acta-Gene Structure and Expression 1350: 262-266. Akashi, K., K. Sakurai, J. Hirayama, H. Fukuzawa and K. Ohyama, 1996 Occurrence of nuclear- encoded tRNA(IIe) in mitochondria of the liverwort Marchantia polymorpha. Current Genetics 30: 181-185. Akashi, K., M. Takenaka, S. Yamaoka, Y. Suyama, H. Fukuzawa et al., 1998 Coexistence of nuclear DNA-encoded tRNA(Val)(AAC) and mitochondrial DNA-encoded tRNA(Val)(UAC) in mitochondria of a liverwort Marchantia polymorpha. Nucleic Acids Research 26: 2168-2172. Akiyama, H., and T. Hiraoka, 1994 Allozyme variability within and divergence among populations of the liverwort Conocephalum conicum (Marchantiales- Hepaticae) in Japan. Journal of Plant Research 107: 307-320. Alfano, F., A. Russell, R. Gambardella and J. G. Duckett, 1993 The actin cytoskeleton of the liverwort Riccia Fluitans-Effects of cytochalasin B and aluminium ions on rhizoid tip growth. -

REVIEW History of Cannabis and Its Preparations in Saga, Science, And
1614 CHEMISTRY & BIODIVERSITY – Vol. 4 (2007) REVIEW History of Cannabis and Its Preparations in Saga, Science, and Sobriquet by Ethan B. Russo 20402 81st Avenue SW, Vashon, WA 98070, USA (e-mail: [email protected]) Cannabis sativa L. is possibly one of the oldest plants cultivated by man, but has remained a source of controversy throughout its history. Whether pariah or panacea, this most versatile botanical has provided a mirror to medicine and has pointed the way in the last two decades toward a host of medical challenges from analgesia to weight loss through the discovery of its myriad biochemical attributes and the endocannabinoid system wherein many of its components operate. This study surveys the history of cannabis, its genetics and preparations. A review of cannabis usage in Ancient Egypt will serve as an archetype, while examining first mentions from various Old World cultures and their pertinence for contemporary scientific investigation. Cannabis historians of the past have provided promising clues to potential treatments for a wide array of currently puzzling medical syndromes including chronic pain, spasticity, cancer, seizure disorders, nausea, anorexia, and infectious disease that remain challenges for 21st century medicine. Information gleaned from the history of cannabis administration in its various forms may provide useful points of departure for research into novel delivery techniques and standardization of cannabis-based medicines that will allow their prescription for treatment of these intractable medical conditions. Contents 1. Introduction 2. The Ticklish Matter of Taxonomy 3. A Bit of Geography 4. Cannabis Preparations: Bhang, Ganja, and Charas 5. History of Medicinal Cannabis 5.1. -

Uncovering the Psychoactivity of a Cannabinoid from Liverworts Associated with a Cyano Cannabinoids
SCIENCE ADVANCES | RESEARCH ARTICLE NEUROPHYSIOLOGY Copyright © 2018 The Authors, some rights reserved; Uncovering the psychoactivity of a cannabinoid from exclusive licensee American Association liverworts associated with a legal high for the Advancement A. Chicca1, M. A. Schafroth2, I. Reynoso-Moreno1, R. Erni2, V. Petrucci1, of Science. No claim to 2 1 original U.S. Government E. M. Carreira *, J. Gertsch * Works. Distributed under a Creative Phytochemical studies on the liverwort Radula genus have previously identified the bibenzyl (−)-cis-perrottetinene Commons Attribution 9 9 (cis-PET), which structurally resembles (−)-D -trans-tetrahydrocannabinol (D -trans-THC) from Cannabis sativa NonCommercial L. Radula preparations are sold as cannabinoid-like legal high on the internet, even though pharmacological data License 4.0 (CC BY-NC). are lacking. Herein, we describe a versatile total synthesis of (−)-cis-PET and its (−)-trans diastereoisomer and demonstrate that both molecules readily penetrate the brain and induce hypothermia, catalepsy, hypolocomo- tion, and analgesia in a CB1 receptor–dependent manner in mice. The natural product (−)-cis-PET was profiled on major brain receptors, showing a selective cannabinoid pharmacology. This study also uncovers pharmacological 9 differences between D -THC and PET diastereoisomers. Most notably, (−)-cis-PET and (−)-trans-PET significantly 9 reduced basal brain prostaglandin levels associated with D -trans-THC side effects in a CB1 receptor–dependent manner, thus mimicking the action of the endocannabinoid 2-arachidonoyl glycerol. Therefore, the natural product (−)-cis-PET is a psychoactive cannabinoid from bryophytes, illustrating the existence of convergent evolution of bioactive cannabinoids in the plant kingdom. Our findings may have implications for bioprospecting and drug discovery and provide a molecular rationale for the reported effects upon consumption of certain Radula prepa- rations as moderately active legal highs. -
Integrative Taxonomy Resolves the Cryptic and Pseudo-Cryptic Radula Buccinifera Complex (Porellales, Jungermanniopsida), Including Two Reinstated and Five New Species
A peer-reviewed open-access journal PhytoKeys 27:Integrative 1–113 (2013) taxonomy resolves the cryptic and pseudo-cryptic Radula buccinifera... 1 doi: 10.3897/phytokeys.27.5523 RESEARCH ARTICLE www.phytokeys.com Launched to accelerate biodiversity research Integrative taxonomy resolves the cryptic and pseudo-cryptic Radula buccinifera complex (Porellales, Jungermanniopsida), including two reinstated and five new species Matt A.M. Renner1, Nicolas Devos2, Jairo Patiño3, Elizabeth A. Brown1, Andrew Orme1, Michael Elgey1, Trevor C. Wilson1, Lindsey J. Gray4, Matt J. von Konrat5 1 Royal Botanic Gardens and Domain Trust, Mrs Macquaries Road, Sydney, NSW 2000, Australia 2 Department of Biology, Duke University, Box 90388, Durham NC 27708, U.S.A. 3 Institute of Botany, University of Liège, Liège, Belgium 4 School of Biological Sciences, The University of Sydney, NSW 2006, Australia 5 The ieldF Mu- seum of Natural History, 1400 South Lake Shore Drive, Chicago, Illinois, USA Corresponding author: Matt A.M. Renner ([email protected]) Academic editor: Lyubomir Penev | Received 15 May 2013 | Accepted 20 August 2013 | Published 30 October 2013 Citation: Renner MAM, Devos N, Patiño J, Brown EA, Orme A, Elgey M, Wilson TC, Gray LJ, von Konrat MJ (2013) Integrative taxonomy resolves the cryptic and pseudo-cryptic Radula buccinifera complex (Porellales, Jungermanniopsida), including two reinstated and five new species. PhytoKeys 27: 1–113. doi: 10.3897/phytokeys.27.5523 Abstract Molecular data from three chloroplast markers resolve individuals attributable to Radula buccinifera in six lineages belonging to two subgenera, indicating the species is polyphyletic as currently circumscribed. All lineages are morphologically diagnosable, but one pair exhibits such morphological overlap that they can be considered cryptic. -
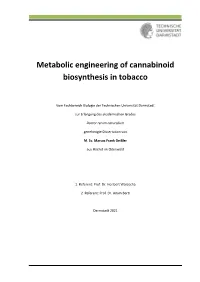
Metabolic Engineering of Cannabinoid Biosynthesis in Tobacco
Metabolic engineering of cannabinoid biosynthesis in tobacco Vom Fachbereich Biologie der Technischen Universität Darmstadt zur Erlangung des akademischen Grades Doctor rerum naturalium genehmigte Dissertation von M. Sc. Marcus Frank Geißler aus Höchst im Odenwald 1. Referent: Prof. Dr. Heribert Warzecha 2. Referent: Prof. Dr. Adam Bertl Darmstadt 2021 Geißler, Marcus Frank: Metabolic engineering of cannabinoid biosynthesis in tobacco Darmstadt, Technische Universität Darmstadt Jahr der Veröffentlichung der Dissertation auf TUprints: 2021 Tag der mündlichen Prüfung: 11.06.2021 Veröffentlichung unter CC BY-SA 4.0 International https://creativecommons.org/licenses/ 2 Für Jana 4 Abstract For millennia, Cannabis has been used in various cultural groups because of its versatile applications. Among other things, the plant served as a source of textile fibers, but was also used as a medicine to treat inflammation, cramps or epilepsy. With the discovery of the endocannabinoid system, the plant, which had fallen into disrepute in the mid-20th century because of its excessive use as a recreational drug and is therefore still subject to heavy restrictions in most countries, gained new prestige. Thus, it was found that certain secondary metabolites, known as cannabinoids, could modulate a variety of physiological processes, potentially offering new therapeutic applications. To date, more than 100 of these cannabinoids have been isolated, the best known of which are the psychoactive-acting Δ9-tetrahydrocannabinol (THC) and the non-psychotropic cannabidiol (CBD). In this context, THC- and CBD-containing products such as Sativex® and Epidyolex®, which are already approved as pharmaceuticals, are finding application in medicine. However, THC is considered a major limitation for clinical use due to its psychoactive character, so non-psychotropic cannabinoids, as well as synthetic non-naturally-occurring cannabinoids that have similar medicinal properties to THC, but do not have the undesirable side effect, will be of key importance in the future. -

The Genus Radula Dumort. (Radulaceae, Marchantiophyta) in Brazil
Nova Hedwigia, Vol. 000 (2020), Issue 0-0, 000–000 PrePubArticle Published online November 2020 The genus Radula Dumort. (Radulaceae, Marchantiophyta) in Brazil Fúvio Rubens Oliveira-da-Silva1, S. Robbert Gradstein2 and Anna Luiza Ilkiu-Borges3* 1 Postgraduation Program in Biological Sciences – Tropical Botany (UFRA/MPEG), Museu Paraense Emílio Goeldi, Coordination of Botany, Av. Perimetral 1901, 66530-070 Belém, Brazil. [email protected] 2 Department of Systematics, Biodiversity and Evolution of Plants, Albrecht von Haller Institute, University of Göttingen, 37073 Göttingen, Germany; Muséum National d’Histoire Naturelle, Institut de Systématique, Évolution, Biodiversité (UMR 7205), 75005 Paris, France. [email protected] 3 Museu Paraense Emílio Goeldi, Coordination of Botany, Av. Perimetral 1901, 66530-070 Belém, Brazil. [email protected] * Corresponding author: [email protected] With 35 figures and 1 Appendix Article Abstract: A taxonomic study of the liverwort genus Radula in Brazil based on morphological characters and on examination of types and over 1000 additional collections, leads to the recogni- tion of 31 species and two varieties. A key to all species as well as descriptions, illustrations and comments on recognition, distribution and habitat of the recognized species are provided. One new species, R. renneri, is described and illustrated. Radula longiloba, R. punctata and R. xalapensis are new records for Brazil whereas the occurrence of R. pseudostachya and R. subinflata in Brazil is confirmed. Radula elliottii, R. varilobula and R. wrightii are excluded from the country and R. marginata, R. microloba and R. saccatiloba are doubtful records. Several new lectotypifications [for R. flaccida, R. epiphylla (= R. -

Conservation Status of New Zealand Hornworts and Liverworts, 2020
2020 NEW ZEALAND THREAT CLASSIFICATION SERIES 31 Conservation status of New Zealand hornworts and liverworts, 2020 P.J. de Lange, D. Glenny, K. Frogley, M.A.M. Renner, M. von Konrat, J.J. Engel, C. Reeb and J.R. Rolfe The Threatened – Nationally Endangered liverwort Goebelobryum unguiculatum growing amongst the Not Threatened Kurzia hippuroides. Photo: Jeremy Rolfe. New Zealand Threat Classification Series is a scientific monograph series presenting publications related to the New Zealand Threat Classification System (NZTCS). Most will be lists providing NZTCS status of members of a plant or animal group (e.g. algae, birds, spiders). There are currently 23 groups, each assessed once every 5 years. From time to time the manual that defines the categories, criteria and process for the NZTCS will be reviewed. Publications in this series are considered part of the formal international scientific literature. This report is available from the departmental website in pdf form. Titles are listed in our catalogue on the website, refer www.doc.govt.nz under Publications. © Copyright May 2020, New Zealand Department of Conservation ISSN 2324–1713 (web PDF) ISBN 978–0–473–52570–5 (web PDF) This report was prepared for publication by the Creative Services Team; editing and layout by Lynette Clelland. Publication was approved by the Director, Terrestrial Ecosystems Unit, Department of Conservation, Wellington, New Zealand Published by Publishing Team, Department of Conservation, PO Box 10420, The Terrace, Wellington 6143, New Zealand. In the interest of forest conservation, we support paperless electronic publishing. CONTENTS Abstract 1 1. Summary 2 1.2 Trends 5 2. Conservation status of New Zealand hornworts and liverworts, 2020 8 2.1 Hornworts 8 2.2 Liverworts 9 2.3 NZTCS categories, criteria and qualifiers 26 3. -

Volume 4, Chapter 1-7: Aquatic and Wet Marchantiophyta, Class
Glime, J. M. 2021. Aquatic and Wet Marchantiophyta, Class Jungermanniopsida, Orders Porellales: Jubulineae, part 1. Chapt. 1-7. In: 1-7-1 Glime, J. M. (ed.). Bryophyte Ecology. Volume 4. Habitat and Role. Ebook sponsored by Michigan Technological University and the International Association of Bryologists. Last updated 22 May 2021 and available at <http://digitalcommons.mtu.edu/bryophyte-ecology/>. CHAPTER 1-7 AQUATIC AND WET MARCHANTIOPHYTA, CLASS JUNGERMANNIOPSIDA, ORDER PORELLALES: JUBULINEAE, PART 1 TABLE OF CONTENTS Porellales – Suborder Jubulineae ........................................................................................................................ 1-7-2 Frullaniaceae ................................................................................................................................................ 1-7-2 Frullania asagrayana ........................................................................................................................... 1-7-2 Frullania riparia ................................................................................................................................... 1-7-4 Frullania tamarisci ............................................................................................................................... 1-7-5 Frullania teneriffae ............................................................................................................................... 1-7-7 Jubulaceae ................................................................................................................................................... -

Bryo-Activities: a Review on How Bryophytes Are Contributing to the Arsenal of Natural Bioactive Compounds Against Fungi
plants Review Bryo-Activities: A Review on How Bryophytes Are Contributing to the Arsenal of Natural Bioactive Compounds against Fungi Mauro Commisso 1,† , Francesco Guarino 2,† , Laura Marchi 3,†, Antonella Muto 4,†, Amalia Piro 5,† and Francesca Degola 6,*,† 1 Department of Biotechnology, University of Verona, Cà Vignal 1, Strada Le Grazie 15, 37134 Verona (VR), Italy; [email protected] 2 Department of Chemistry and Biology, University of Salerno, Via Giovanni Paolo II 132, 84084 Fisciano (SA), Italy; [email protected] 3 Department of Medicine and Surgery, Respiratory Disease and Lung Function Unit, University of Parma, Via Gramsci 14, 43125 Parma (PR), Italy; [email protected] 4 Department of Biology, Ecology and Earth Sciences, University of Calabria, Via Ponte P. Bucci 6b, Arcavacata di Rende, 87036 Cosenza (CS), Italy; [email protected] 5 Laboratory of Plant Biology and Plant Proteomics (Lab.Bio.Pro.Ve), Department of Chemistry and Chemical Technologies, University of Calabria, Ponte P. Bucci 12 C, Arcavacata di Rende, 87036 Cosenza (CS), Italy; [email protected] 6 Department of Chemistry, Life Sciences and Environmental Sustainability, University of Parma, Parco delle Scienze 11/A, 43124 Parma (PR), Italy * Correspondence: [email protected] † All authors equally contributed to the manuscript. Abstract: Usually regarded as less evolved than their more recently diverged vascular sisters, which currently dominate vegetation landscape, bryophytes seem having nothing to envy to the defensive arsenal of other plants, since they had acquired a suite of chemical traits that allowed them to Citation: Commisso, M.; Guarino, F.; adapt and persist on land. In fact, these closest modern relatives of the ancestors to the earliest Marchi, L.; Muto, A.; Piro, A.; Degola, F. -

Tajammul Hussain and Oliver Kayser
Radula marginata; a prospective liverwort an alternate source of cannabinoid-like compounds Tajammul Hussain and Oliver Kayser Department of Technical Biochemiestry, Faculty of Bio-Chemical Engineering, Technical University Dortmund [email protected]; [email protected] INTRODUCTION iii) Characterization of stilbene synthase The liverwort Radula marginata belongs to the bryophyte division of land plants. Bryophytes are an early-diverged group of land plants. The division comprising of A around 20,000 species and are divided into three phyla: mosses, hornworts and liverworts. Among them liverworts are the most abundant consisting of 6000-8000 species. Radulales is an order of subclass Jungermanniidae in this phylum. Radulaceae is the only family in this order, comprises Radula genus and 283 species. Radula marginata is of significant interest since perrottetinene and perrottetinenic acid 1,2 had been reported. These compounds are structural analogs to tetrahydrocannabinol (Δ9- THC), a psychopharmacological compound in Cannabis sativa L. Recently, agonistic Chalcone synthase (HsCHS) Stilbene synthase (RmSTS Model) Stilbenecarboxylate synthase (MpSTCS2) (Huperzia serrata ) (Radula marginata) (Marchantia polymorpha) activity of these compounds with cannabinoid receptor 1 (CB1) 3–5 further confirmed the B potential of this specie in cannabinoid-based pharmaceutical industry. Therefore genetic- LOCAL Quality Estimate Z-score Comparison with Non-redundant Set of PDB Structures level understanding of secondary metabolic pathways that lead to the synthesis of 1.0 QMEAN6 -0.18 1.0 cannabinoid-like natural compounds would be desirable. 0.8 All Atom -0.26 0.6 CBeta -0.80 0.5 Solvation 0.50 0.4 RESULTS Torsion -0.35 0.0 0.2 SS Agree 0.64 Normalized QMEAN6 Score 0.0 Predicted Local Similarity to Target Predicted Local Similarity to -0.5 i) de-novo assembly and annotation 0 50 100 150 200 250 300 350 400 ACC Agree -0.26 0 100 200 400300500 600 Paired-end Illumina Hiseq-2000 platform generated 30 million raw reads for each pair. -

Jahan Marcu, Ph.D
Virginia Governor's Council: Considering Medical Cannabis Jahan Marcu, Ph.D September 24th, 2014 Senior Scientist, Americans for Safe Access, DC Jahan @safeaccessnow.org Research and Development Director, Green Standard Diagnostics [email protected] Year, Number of Studies on Cannabis and Cannabinoids 2014,1566+ 1997,352 1980,198 1963,10 1946,14 2013,1748 1996,273 1979,191 1962,7 1945,8 2012,1755 1995,264 1978,248 1961,8 1940,1 2011,1589 1994,186 1977,247 1960,6 1939,1 2010,1553 1993,175 1976,362 1959,5 1909,1 2009,1379 1992,143 1975,351 1958,4 1893,1 2008,1516 1991,187 1974,440 1957,1 1883,2 2007,1241 1990,157 1973,478 1956,1 1847,1 2006,1153 1989,131 1972,414 1955,2 1845,1 2005,1103 1988,119 1971,343 1954,7 1843,1 2004,885 1987,162 1970,234 1953,10 2003,746 1986,162 1969,161 1952,3 2002,690 1985,155 1968,111 1951,9 2001,608 1984,160 1967,58 1950,4 2000,501 1983,143 1966,12 1949,2 1999,430 1982,136 1965,17 1948,4 1998,445 1981,184 1964,17 1947,5 The Endocannabinoid System (ECS) • Discovered with the help of phytocannabinoids (Cannabis Sativa, Voacanga Africana, Rhodenderon Anthpogonoides, Radula Marginata, and Helichrysum Umbraculigerum) • Consists of endocannabinoids (anandamide,2-AG), cannabinoid receptors (GPCRs), and enzymes for synthesis and catabolism • “Eat, sleep, relax, forget, and protect” • Clinical Endocannabinoid Deficiency (CECD; Russo 2004) Helichrysum Umbraculigerum Rhodenderon Anthpogonoides Cannabis Sativa Radula Marginata Voacanga Africana VCU – Hundreds of studies • Discovery of receptor sites • Inhibiting HIV replication • Pain • Drug addiction treatment • Mary Abood (Middle) – ALS • Sean McAllister – Cancer My VCU Mentors 20 HOUR TIMELAPSE VIDEO (23 SECONDS) THC Selectively Kills Cancer Cells Cannabinoid Receptor Genetics • CNR1 encodes CB1 localized on 6q14-q15 (Hoehe et al.