Rundbrief Lesen
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Provinsi : SULAWESI TENGAH Kecamatan : BUNGKU BARAT
Model A.1 KWK DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2018 Provinsi : SULAWESI TENGAH Kecamatan : BUNGKU BARAT Kabupaten/Kota : MOROWALI Desa/Kelurahan : BAHOEA REKO-REKO Tps : 002 Status Jenis Kelamin Alamat No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Usia Disabilitas Keterangan *) Perkawinan L/P Jalan/Dukuh Rt Rw 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 7206080311**** 7206084503**** WAHYUNI PURWAKERTO 05|03|1988 30 S P BAHOEA REKO-REKO 2 7206080311**** 7206081810**** ZAINAL POLARA 18|10|1987 30 S L BAHOEA REKO-REKO 3 7206080607**** 7206080305**** ASWANDI BAHOEA REKO-REKO 03|05|1977 41 S L BAHOEA REKO-REKO 4 7206080607**** 7206084305**** MARICE TANDAYONDO 03|05|1988 30 B P BAHOEA REKO-REKO 5 7206080607**** 7206085510**** HAMIMO BAHOEA REKO-REKO 15|10|1967 50 S P BAHOEA REKO-REKO 6 7206080706**** 7206085212**** ANDI BESSE SENGKANG 12|12|1971 46 P P BAHOEA REKO-REKO 7 7206080707**** 7206082912**** SAKARIA PURWAKARTA 29|12|1971 46 S L BAHOEA REKO-REKO 8 7206080707**** 7206084303**** SURIANI KOTA RAYA 03|03|1983 35 S P BAHOEA REKO-REKO 9 7206080707**** 7206080107**** I MADE SUKLA PEGUYANGAN 01|07|1972 45 S L BAHOEA REKO-REKO 10 7206080807**** 7206086909**** YANTI BANJAR NEGARA 29|09|1983 34 S P BAHOEA REKO-REKO 11 7206081012**** 7206081002**** NIRSAM BANYUMAS 10|02|1971 47 S L BAHOEA REKO-REKO 12 7206081012**** 7206084208**** TUGIARTI BANYUMAS 02|08|1980 37 S P BAHOEA REKO-REKO 13 7206081012**** 7206082405**** I GEDE SUKRA WIJAYA BALI 24|05|1993 25 S L BAHOEA REKO-REKO 14 7206081107**** 7206081010**** ANTON DESA OLANG -

Poso on the Edge
JIHADISM IN INDONESIA: POSO ON THE EDGE Asia Report N°127 – 24 January 2007 TABLE OF CONTENTS EXECUTIVE SUMMARY AND RECOMMENDATIONS................................................. i I. INTRODUCTION .......................................................................................................... 1 II. TANAH RUNTUH AND JI ........................................................................................... 3 A. JI TRAINING..........................................................................................................................3 B. HASANUDDIN COMES TO POSO .............................................................................................5 III. FALSE LEADS ............................................................................................................... 7 A. BOTCHED MURDER PROSECUTION ........................................................................................7 IV. THE ARRESTS OF HASANUDDIN AND HARIS .................................................... 9 V. THE TIBO EXECUTIONS AND THEIR AFTERMATH....................................... 11 VI. THE 22 OCTOBER CLASH IN TANAH RUNTUH................................................ 13 VII. THE MOST-WANTED LIST AND THE LIMITS OF PERSUASION.................. 15 VIII. THE 11 JANUARY RAID AND ITS AFTERMATH ............................................... 16 IX. POSO DEVELOPMENTS AND JI............................................................................. 18 X. CONCLUSION: THE WAY FORWARD................................................................. -

Buku Data Sulawesi Ten
DAFTAR TABEL BAB I KONDISI LINGKUNGAN HIDUP DAN KECENDERUNGANNYA A. LAHAN DAN HUTAN TABEL SD-1 Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan/Tutupan Lahan .............................................................................................. 1 TABEL SD-2 Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsi atau Statusnya... 2 TABEL SD-3 Luas Kawasan Lindung Berdasarkan RTRW dan Tutupan Lahannya ............................................................................. 3 TABEL SD-4 Luas Penutupan Lahan Dalam Kawasan Hutan dan Luar Kawasan Hutan .................................................................. 5 TABEL SD-5 Luas Lahan Kritis ................................................................... 6 TABEL SD-6 Luas Kerusakan Hutan ........................................................ 7 TABEL SD-7 Luas Konversi Hutan ............................................................ 8 TABEL SD-8 Luas Hutan Tanaman Industri ............................................ 9 B. KEANEKARAGAMAN HAYATI TABEL SD-9 Jumlah Spesies Flora dan Fauna yang Diketahui dan Dilindungi 10 TABEL SD-10 Keadaan Flora dan Fauna yang Dilindungi ............................. 11 C. AIR TABEL SD-11 Inventarisasi Sungai ............................................................. 15 TABEL SD-12 Inventarisasi Danau Situ/Waduk/Situ/Embung ............... 22 TABEL SD-13 Kualitas Air Sungai ............................................................... 23 TABEL SD-14 Kualitas Air Danau/Situ/Embung....................................... 35 TABEL SD-15 Kualitas Air Sumur................................................................ -

France - 04 75 97 20 40
Point-Voyages - 4 Avenue Félix Chalamel - 07700 BOURG ST ANDEOL - France - 04 75 97 20 40 INDONÉSIE - SULAWESI - ECLIPSE TOTALE AU PAYS TORAJA 11 jours/8 nuits Nombre de participants : Départ garanti 6 personnes Groupe limité à 15 personnes Environnement : A l'occasion de l'éclipse totale de Soleil qui aura lieu au mois de mars 2016, Point-Voyages propose un voyage au Sulawesi, connue aussi sous le nom de Célèbes, île indonésienne qui abrite une incroyable variété de cultures. La Ligne Wallace partage l'Indonésie en deux. A l'Ouest, l'influence est asiatique alors quel'Est est biologiquement, culturellement et géologiquement relié à l'Océanie.<o:p></o:p> Depuis la côte jusqu’aux montagnes, vous découvrirez la culture Toraja et ses exubérantes constructions, vous traverserez les rizières, vous vous rendrez à Tana Toraja,Pendolo, Tentena …et Ampana où vous aurez le privilège d'observer l'éclipse totale de soleil !!!<o:p></o:p> 3 minutes et 2 secondes d’éclipse totale… Fascinante suspension dans le ciel !<o:p></o:p> Face à l’Est, pile au centre du passage de l’éclipse avec une des plus faibles couvertures nuageuses de la région, vous aurez d’exceptionnelles conditions d’observation pour cet événement astronomique. Situé à peine à un demi – degré de l’Equateur, c’est tout l’Univers qui est observable durant l’année. Si les conditions astronomiques sont favorables, vous pourrez découvrir les constellations australes invisibles depuis l’hémisphère Nord ainsi que des astres étonnants. Pensez à amener vos jumelles ou télescopes, nous fournissons -

Great Rides: After a Disaster
Details Where: Sulawesi, Indonesia Start/finish: Manado to Makassar Distance: 1,480km (920 miles) Pictures: Dave Barden 58 cycle APRIL/MAY 2019 SULAWESI GREAT RIDES DAVE BARDEN Cycling UK member Dave is cycling around the world Great in stages, riding one leg each Rides year. AFTER A DISASTER The month before Dave Barden was due to tour Sulawesi in Indonesia, the island was hit by an earthquake and tsunami… here’s been a big earthquake and tsunami Do it yourself was a Sunday morning and I was joined by a exactly where you were going!” said my Getting there local leisure cyclist, also David. We chatted in a “T partner Frances. “You won’t be going now, mixture of languages before he sped away. will you?!” Three flights are Over the next five days, I cycled through My destination was Sulawesi, an oddly-shaped required to reach undulating coastal landscapes, past wooden Indonesian island almost as large as mainland Manado, the largest houses, coconut and banana trees, agricultural UK. My proposed itinerary would visit some areas city in the north of workers carrying huge knives, and ox-carts affected by the disaster. Should I go or cancel? Sulawesi. Garuda pulling piles of coconuts. Outside mosques and I contacted tour agencies, checked the Foreign Indonesia (garuda- churches, loudspeakers entreated drivers to drop and Commonwealth Office advice, and read indonesia.com) and money into earthquake-appeal buckets. articles on the ethics of travelling to areas hit by KLM (klm.com/home/ I had a tent with me but often stayed in hotels. -

World Bank Document
Document of The World Bank FOR OFFICIAL USE ONLY Public Disclosure Authorized Report No. 4131-IN, STAFF APPRAISAL REPORT Public Disclosure Authorized INDONESIA PROVINCIAL HEALTH PROJECT Public Disclosure Authorized January 12, 1983 Public Disclosure Authorized Population, Health and Nutrition Department This document has a restricted distribution and may be used by recipients only in the performance of their official duties. Its contents may not otherwise be disclosed without World Bank authorization. CURRENCY EQUIVALENTS US$1.00 = Rupiahs (Rp) 660 Rp 100 US$0.151 Rp 1 million = US$1,515 WEIGHTS AND 'MEASURES- METRIC SYSTEM 1 millimeter (mm) = 0.039 inches 1 meter (m) = 39.37 inches 1 ki].ometer (kn) = 0.62 miles 1 square kilometer (sq km) = 0.386 square miles 1 hectare (ha) = 2.47 acres GOVERNMENTOF INDONESIA FISCAL YEAR April 1 - March 31 ABBREVIATIONS ASKES = Health Insurance Scheme For Government Employees BAPPENAS = National Development Planning Board CIDA = Canadian International Development Agency GOI = Government of Indonesia INPRES = National Subsidy for Local Governments MCH = Maternal and Child Health MHA = Ministry of Home Affairs MOH = Ministry of Health NFPCB = National FamnilyPlanning Coordinating Board PKMD = Village Comnunity Health Development Program PTC = Provincial Training Center PUSDIKLAT MOH Center for Education and Training REPELITA Five-Year Development Plan UNICEF = United Nations Children's Fund USAID = United States Agency for International Development INDONESIA FOR OFFICIAL USE ONLY PROVINCIAL HEALTH PROJECT STAFF APPRAISAL REPORT Table of Contents Page No. Basic Data .... i Definitions. ii I. INTRODUCTION . 1 II. THE HEALTH SECTOR . 3 A. Health Status. 3 B. The Health Service System. 5 C. Health Expenditure and its Financing . -

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
-1- KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01.07/MENKES/190/2019/MENKES/367/2017 TENTANG LOKUS PROGRAM INDONESIA SEHAT DENGAN PENDEKATAN KELUARGA TAHUN 2019 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga di tingkat Puskesmas 2018 telah ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/42/2018 tentang Lokus Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga Tahun 2018; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Lokus Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga Tahun 2019; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); -2- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2); 6. -

Alternative Report to the Secretary General's Special Rapporteur on Torture on the Issue of Torture in Indonesia
Alternative Report to the Secretary General's Special Rapporteur on Torture on the issue of torture in Indonesia Document ID: ALRC-SPR-001-2007 Hong Kong, October 2007 Submitted by the Asian Legal Resource Centre (ALRC) To facilitate the analysis of the problem of torture in Indonesia, this report makes comments on the situation of torture in Indonesia based on the list of recommendations by the UN Committee against Torture (CAT Committee) that was concluded in November 2002. Recommendations made by the CAT Committee (Concluding Observations: Indonesia. 01/11/2002. A/57/44,paras.36-46. (Concluding Observations/Comments ): (a) Amend the penal legislation so that torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment are offences strictly prohibited under criminal law, in terms fully consistent with the definition contained in article 1 of the Convention. Adequate penalties, reflecting the seriousness of the crime, should be adopted; ALRC Comments: A revision of the Indonesian Penal Code is still being discussed in the House of Representative. A timeframe for approval of the code has still not been set. The draft of the penal code has been discussed for over twenty years and there is no time frame set for its approval by the parliament and by the President. In the draft of the Penal Code, the definition of torture reflects largely that which is stipulated in the Convention against Torture (CAT). However there is a serious flaw due to the failure on the part of the state to affirm the uniqueness of torture as is found in the last Government report of 2005 submitted to the CAT Committee, whereby maltreatment or assault is confused with the act of torture. -

Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA NOMOR 605 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA KELULUSAN PROGRAM PROFESI GURU PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN DALAM JABATAN TAHUN 2018 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN, Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kompetensi guru Pendidikan Agama Kristen telah dilaksanakan Program profesi guru pendidikan agama Kristen dalam jabatan; b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran keputusan ini adalah guru Pendidikan Agama Kristen yang telah lulus program profesi guru pendidikan agama Kristen dalam jabatan tahun 2018; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen tentang Penetapan Nama-Nama Kelulusan Program Profesi Guru Pendidikan Agama Kristen Dalam Jabatan Tahun 2018; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O3 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O05 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 20 15 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47691; 5. -

Daftar Faskes/Dinkes/Klinik/Laboratorium Yang Menginput Pada Aplikasi Nar Antigen Periode Waktu 22 - 28 Agustus 2021
DAFTAR FASKES/DINKES/KLINIK/LABORATORIUM YANG MENGINPUT PADA APLIKASI NAR ANTIGEN PERIODE WAKTU 22 - 28 AGUSTUS 2021 No Asal Provinsi Faskes Asal Kabupaten/Kota Faskes Jenis Faskes Nama Faskes 1 ACEH ACEH BARAT Lainnya KLINIK ANANDA FAMILY 2 ACEH ACEH BARAT Lainnya Klinik Cempaka Lima Meulaboh 3 ACEH ACEH BARAT Puskesmas COT SEUMEREUNG 4 ACEH ACEH BARAT Puskesmas DRIEN RAMPAK 5 ACEH ACEH BARAT Puskesmas KUALA BHEE 6 ACEH ACEH BARAT Puskesmas MENTULANG 7 ACEH ACEH BARAT Puskesmas MEUREUBO 8 ACEH ACEH BARAT Puskesmas PANTE CEUREUMEN 9 ACEH ACEH BARAT Puskesmas PASIE MALI (WOYLA BARAT) 10 ACEH ACEH BARAT Puskesmas PEUREUMEU 11 ACEH ACEH BARAT RS RSUD CUT NYAK DHIEN MEULABOH 12 ACEH ACEH BARAT DAYA Klinik Dinkes Aceh Barat Daya 13 ACEH ACEH BESAR Lainnya Klinik Utama Kasehat Walafiat 14 ACEH ACEH BESAR Lainnya Tirtana Medikal Klinik 15 ACEH ACEH BESAR Puskesmas BLANG BINTANG 16 ACEH ACEH BESAR Puskesmas LAMPISANG 17 ACEH ACEH BESAR Puskesmas LHOKNGA 18 ACEH ACEH BESAR Puskesmas MESJID RAYA 19 ACEH ACEH BESAR Puskesmas MONTASIK 20 ACEH ACEH BESAR Puskesmas Puskesmas Krueng Barona Jaya 21 ACEH ACEH JAYA Klinik dinkesacehjaya 22 ACEH ACEH SELATAN Klinik Dinas kesehatan 23 ACEH ACEH SELATAN Puskesmas BAKONGAN 24 ACEH ACEH SELATAN Puskesmas BLANGKEJEREN 25 ACEH ACEH SELATAN Puskesmas BUKIT GADENG 26 ACEH ACEH SELATAN Puskesmas DURIAN KAWAN 27 ACEH ACEH SELATAN Puskesmas KAMPONG PAYA 28 ACEH ACEH SELATAN Puskesmas KLUET TIMUR 29 ACEH ACEH SELATAN Puskesmas KRUENG LUAS 30 ACEH ACEH SELATAN Puskesmas KUALA BA'U 31 ACEH ACEH SELATAN Puskesmas LADANG -
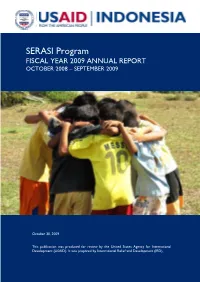
SERASI Program
SERASI Program FISCAL YEAR 2009 ANNUAL REPORT OCTOBER 2008 – SEPTEMBER 2009 October 30, 2009 This publication was produced for review by the United States Agency for International Development (USAID). It was prepared by International Relief and Development (IRD). SERASI Program FISCAL YEAR 2009 ANNUAL REPORT OCTOBER 2008 - SEPTEMBER 2009 USAID Contact Number: 497-C-00-08-00004-00 USAID/Indonesia Project Office: Office of Democracy and Decentralized Government USAID/Indonesia Strategic Objective: SO 6 – Conflict Mitigation Geographic Coverage: Aceh, Central Sulawesi, Maluku, North Maluku, and Papua provinces. Contract Period of Performance (Base): February 25, 2008 to February 24, 2011 Contract Ceiling (Base): USD 27,418,534 Contractor: International Relief and Development (IRD) Contractor Contact: Mr. James Grall, Chief of Party SERASI Program Intiland Tower 9th Floor/ Suite 904 Jl. Jendral Sudirman 32 Jakarta 10220 Email: [email protected] Tel: +62 (21) 5785-3780 & 5785-3223 Fax: +62 (21) 5785-3781 USAID Contracting Officer’s Technical Ms. Leila Abu-Gheida Representative USAID Contracting Officer: Mr. Raymond Jennings Ms. Asuncion L. Juico Mr. Bendeguz Viragh Date of Publication: October 30, 2009 Cover photo: Acehnese children strategizing during an ASA facilitated football tournament (Photo: Ian Nugrahane). DISCLAIMER The views expressed in this publication do not necessarily reflect the views of the United States Agency for International Development or the United States Government. 1 TABLE OF CONTENTS ACRONYMS AND INITIALS……………………………………………………………………………… 5 I. EXECUTIVE SUMMARY………………………………………………………………………………. 9 II. INTRODUCTION………………………………………………………………………………………. 11 A. Program Overview……………………………………………………………………………………. 11 B. Program Approach……………………………………………………………………………………. 12 III.MAJOR PROGRAM ACTIVITIES…………………………………………………………………….. 14 A. Summary………………………………………………………………………………………………. 14 B. Aceh………………………………………………………………………………………………….... 18 1. Key Political Developments………………………………………………………………………... 18 a. -

Kelurahan Jalan Rt/Rw Rb Rs Rr Hl Hm Sw Gbs Gb Ts Lk 1 2 3
5. KELURAHAN PETOBO JUMLAH ALAMAT TEMPAT TINGGAL KONDISI BANGUNAN STATUS LAHAN AKIBAT KERUSAKAN TITIK SUMBER No NAMA KEPALA KELUARGA TEMPAT TANGGAL LAHIR PEKERJAAN ANGGOTA SHELTER DATA KELUARGA KELURAHAN JALAN RT/RW RB RS RR HL HM SW GBS GB TS LK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 JUNAIDI RAHMAN, ST KOTA BARU, 09-06-1981 PNS 4 PETOBO BTN PETOBO PERMAI BLOK M2 NO. 21 003/009 √ √ √ 2 SERLY LISAN TORAJA, 10-07-1963 IRT 3 PETOBO JL. DEWI SARTIKA NO. 16 003/008 √ √ √ 3 MEYSKE PALU, 28-06-1986 PNS 3 PETOBO BTN BUMI PETOBO PERMAI BLOK N2 NO. 14 003/009 √ √ √ 4 MARTONIS DIWONDA SAMPALOWO, 28-01-1977 SWASTA 4 PETOBO JL. H.M. SUHARTO LRG. PERJUANGAN 008/003 √ √ √ 5 ANDI JASMIN SOPPENG, 15-01-1961 SWASTA PETOBO JL. DEWI SARTIKA V BLOK E NO. 11 002/008 √ √ √ 6 LAPATAWE B. HAMKA LALOS, 14-12-1972 PNS PETOBO JL. DEWI SARTIKA V BLOK E NO. 33 002/008 √ √ √ 7 AGNES FERGREIS PALU, 08-02-1981 SWASTA 5 PETOBO JL. NAMBO BTN MAMARA REGENCY BLOK A/10 √ √ √ 8 EKA WAHYUDI PALU, 30-10-1983 POLRI 4 PETOBO Jl. Nambo, BTN Green View Blok D2 No. 12A √ √ √ 9 SALMAN RUSLAN, ST. MT SALULEMO, 05-07-1976 PNS 7 PETOBO BTN PETOBO BLOK I 4 NO. 3 001/002 √ √ √ 10 TRIAS MARIANTO LIMBAS PALU, 20-03-1987 HONORER 3 PETOBO JL. SAMUDRA II LRG. II NO. 18 005/005 √ √ √ 11 FRANKY STENLY PALU, 18-11-1981 PNS 4 PETOBO JL.