Litteraturbericht Anonymous
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Vegetation Succession Along New Roads at Soqotra Island (Yemen): Effects of Invasive Plant Species and Utilization of Selected N
10.2478/jlecol-2014-0003 Journal of Landscape Ecology (2013), Vol: 6 / No. 3. VEGETATION SUCCESSION ALONG NEW ROADS AT SOQOTRA ISLAND (YEMEN): EFFECTS OF INVASIVE PLANT SPECIES AND UTILIZATION OF SELECTED NATIVE PLANT RESISTENCE AGAINST DISTURBANCE PETR MADĚRA1, PAVEL KOVÁŘ2, JAROSLAV VOJTA2, DANIEL VOLAŘÍK1, LUBOŠ ÚRADNÍČEK1, ALENA SALAŠOVÁ3, JAROSLAV KOBLÍŽEK1 & PETR JELÍNEK1 1Mendel University in Brno, Faculty of Forestry and Wood Technology, Department of the Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology, Zemědělská 1/1665, 613 00 Brno 2Charles University in Prague, Faculty of Science, Department of Botany, Benátská 2, 128 01 Prague 3Mendel University in Brno, Faculty of Horticulture, Department of Landscape Planning, Valtická 337, 691 44 Lednice Received: 13th November 2013, Accepted: 17th December 2013 ABSTRACT The paved (tarmac) roads had been constructed on Soqotra island over the last 15 years. The vegetation along the roads was disturbed and the erosion started immediately after the disturbance caused by the road construction. Our assumption is that biotechnical measurements should prevent the problems caused by erosion and improve stabilization of road edges. The knowledge of plant species which are able to grow in unfavourable conditions along the roads is important for correct selection of plants used for outplanting. The vegetation succession was observed using phytosociological relevés as a tool of recording and mapping assambblages of plants species along the roads as new linear structures in the landscape. Data from phytosociological relevés were analysed and the succession was characterised in different altitudes. The results can help us to select group of plants (especially shrubs and trees), which are suitable to be used as stabilizing green mantle in various site conditions and for different purposes (anti-erosional, ornamental, protection against noise or dust, etc.). -

Nematicidal and Antimicrobial Evaluation of Extracts, Nanosized Materials, and Fractions, of Selected Plants, and the Identification of the Bioactive Phytochemicals
Nematicidal and antimicrobial evaluation of extracts, nanosized materials, and fractions, of selected plants, and the identification of the bioactive phytochemicals Dissertation zur Erlangung des Grades des Doktors der Naturwissenschaften der Naturwissenschaftlich-Technischen Fakultät der Universität des Saarlandes von Adel Al-Marby July Saarbrücken 2017 Tag des Kolloquiums: 14-07-2017 Dekan: Prof. Dr. rer. nat. Guido Kickelbick Prüfungsvorsitzender: Prof. Dr. Ingolf Bernhardt Berichterstatter: Prof. Dr. Claus Jacob Prof. Dr.Thorsten Lehr Akad. Mitarbeiter: Dr. Aravind Pasula i Diese Dissertation wurde in der Zeit von Februar 2014 bis Februar 2017 unter Anleitung von Prof. Dr. Claus Jacob im Arbeitskreis für Bioorganische Chemie, Fachrichtung Pharmazie der Universität des Saarlandes durchgeführt. Bei Herr Prof. Dr. Claus Jacob möchte ich mich für die Überlassung des Themas und die wertvollen Anregungen und Diskussionen herzlich bedanken ii Erklärung Ich erkläre hiermit an Eides statt, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig und ohne unerlaubte fremde Hilfe angefertigt, andere als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel nicht benutzt habe. Die aus fremden Quellen direkt oder indirekt übernommenen Stellen sind als solche kenntlich gemacht. Die Arbeit wurde bisher in gleicher oder ähnlicher Form keinem anderen Prüfungsamt vorgelegt und auch nicht veröffentlicht. Saarbruecken, Datum aA (Unterschrift) iii Dedicated to My Beloved Family iv Table of Contents Table of Contents Erklärung .................................................................................................................................................... -

Bruno Rodrigo Minozzo.Pdf
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA SETOR DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS BRUNO RODRIGO MINOZZO AÇÃO GASTROPROTETORA DA FRAÇÃO METANÓLICA DAS CASCAS DE Euphorbia umbellata (PAX) BRUYNS: ENVOLVIMENTO DE CICLOOXIGENASES, ÓXIDO NÍTRICO E SEU PAPEL ANTIOXIDANTE PONTA GROSSA 2015 BRUNO RODRIGO MINOZZO AÇÃO GASTROPROTETORA DA FRAÇÃO METANÓLICA DAS CASCAS DE Euphorbia umbellata (PAX) BRUYNS: ENVOLVIMENTO DE CICLOOXIGENASES, ÓXIDO NÍTRICO E SEU PAPEL ANTIOXIDANTE Dissertação apresentada ao Programa de Pós- Graduação em Ciências Farmacêuticas, como parte dos requisitos para obtenção do Título de Mestre em Ciências Farmacêuticas pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. Orientador: Prof. Dr. Flávio Luís Beltrame Co-orientador: Prof. Dr. Daniel Fernandes PONTA GROSSA 2015 Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas Associação Ampla entre a Universidade Estadual do Centro-Oeste e a Univesidade Estadual de Ponta Grossa ATA DE DEFESA DE DISSERTAÇÃO DE MESTRADO EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS– ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: FÁRMACOS, MEDICAMENTOS E BIOCIÊNCIAS APLICADAS À FARMÁCIA, NÚMERO DA ATA 08/2015, DO MESTRANDO BRUNO RODRIGO MINOZZO REALIZADO NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2015, NA UNIVERSIDADE ESTADUALDE PONTA GROSSA. Aos dois dias de dezembro de dois mil e quinze, às 14 h 00 min na sala 02, auditório NUTEAD, Central de salas de aula, da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) em seção pública sob a presidência do Professor Doutor Flávio Luís Beltrame reuniu-se a Banca Examinadora de defesa da Dissertação de Mestrado em Ciências Farmacêuticas do mestrando Bruno Rodrigo Minozzo na linha de pesquisa: Avaliação Química e Biológica de Produtos Naturais, constituída pelos demais Doutores (membros titulares): José Carlos Rebuglio Vellosa (UEPG/PR) e Rodrigo Rezende Kitagawa (UFES/ES). -

REPUBLIC of YEMEN: CONSERVATION and USE of the BIODIVERSITY ARCHIPELAGO GEF FOCAL AREA: Biodiversity GEF ELIGIBILITY: Under Fina
PROPOSAL FOR REVIEW REPUBLIC OF YEMEN: CONSERVATION AND SUSTAINABLEUSE OF THE BIODIVERSITYOF SOCOTRAARCHIPELAGO GEF FOCALAREA: Biodiversity GEF ELIGIBILITY: Under financial mechanism of Convention (Convention ratified February 2 1, 1996) GEF FINANCING: US$4,944,700 GOVERNMENTCONTRIBUTION: US$500,000 In kind CO-FINANC~NG/~ARALLEL US$ 13,200 British Government FINANCING: US$ 2,500,000 UNDP (Exact figures to be confirmed) US$ 3,000,000 UNICEF, WHO & others ASSOCIATED PROJECT: Government of Yemen: Transport Development for Socotra US$2,000,000 GEF OPERATIONAL Environmental Protection Council (EPC) FOCALPOINT: GEF IMPLEMENTING UNDP AGENCY: EXECUTINGAGENCY: Government of the Republic of Yemen and UNOPS LOCALCOUNTERPART High Committee for Development of Socotra AGENCY: E~IMATEDAPPROVAL DATE: January 1997 PROJECT DURATION: 5 years GEF PREPARATIONCOSTS: US$25,000 UNDP iJS$ 9,950 RBGE Expedition Funu Page: 2 - 1 National Priority of Global Significance 1. The flora and vegetation of the Socotra Archipelago is of outstanding global significance. Over a third of its plant species are found nowhere else, ranking it amongst the top ten island groups in the world. Many of these endemics are remnants of ancient floras which long ago disappeared from the African-Arabian mainland. Others have evolved bizarre growth forms making the Socotran landscape one of the worlds most remarkable. What makes Socotra of even greater global significance is that unlike most other island groups its environment has remained virtually untouched by modern development. There is no evidence of recent extinctions and the vegetation appears unchanged since the island was first exvlored by botanists in 1980. 2. Situated where the Arabian Sea merges with the Indian Ocean, the marine communities of Socotra Archipelago demonstrate distinct biogeographic characteristics of the two major marine biogeographic zones. -

Présentée Et Soutenue Par Le 28 Décembre 2012
ANNEE: 2012 THESE N °:03/12 CSVS Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat UFR Doctoral : Substance naturelles : Etude chimique et biologique Spécialité: Pharmacologie, Toxicologie et Pharmacognosie THESE DE DOCTORAT VALORISATION PHARMACOLOGIQUE D’ALOE PERRYI BAKER ET JATROPHA UNICOSTATA BALF, PLANTES ENDEMIQUES DU YEMEN: TOXICITE, POTENTIEL ANTI INFLAMMATOIRE ET ANALGESIQUE Equipe de Recherche de Pharmacodynamie ERP Présentée et soutenue par Mr. MOSA’D ALI MOSA’D AL-SOBARRY Le 28 Décembre 2012 JURY Professeur Yahia Cherrah Président Faculté de Médecine et de Pharmacie - Rabat Université Mohammed V- Souissi Professeur Katim Alaoui Directeur de Thèse Faculté de Médecine et de Pharmacie -Rabat Université Mohammed V- Souissi Professeur Amina Zellou Faculté de Médecine et de Pharmacie - Rabat Université Mohammed V - Souissi Professeur Abdelaziz Benjouad Faculté des Sciences - Rabat Rapporteurs Directeur générale de Centre National de Recherche Scientifique et Technique - Rabat Professeur Najib Gmira Faculté des Sciences - Kénitra Université Ibn Tofail -Kénitra Professeur Mohammed Akssira Faculté des Sciences et Technique - Mohammedia Examinateurs Université Hassan II - Mohammedia Professeur Naima Saidi Faculté des Sciences - Kénitra Université Ibn Tofail - Kénitra ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ ﴿ﻭﻗﻞ ﺭﺏ ﺯﺩﻧﻲ ﻋﻠﻤﺎ﴾ ﺻﺪﻕ ﺍﷲ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ "ﺳﻮرة ﻃﮫ آﯾﺔ : 114" Je dédis cette thèse à L’âme de mes honorables grands-pères. A ma mère A mon père A ma femme et mes enfants A mes sœurs et frères A toute ma famille sans exception. Aucun mot, aucune dédicace ne sourie exprimer mon respect, ma considération et l'amour éternel que je vous porte, veuillez trouver dans ce travail toute ma gratitude. Que dieu vous protège et vous procure santé et bonheur. -

Classification and Distribution Patterns of Plant Communities on Socotra
Applied Vegetation Science && (2012) Classification and distribution patterns of plant communities on Socotra Island, Yemen Michele De Sanctis, Achmed Adeeb, Alessio Farcomeni, Chiara Patriarca, Achmed Saed & Fabio Attorre Keywords Abstract Gradient analysis; Hierarchical classification; Non-metric dimensional scaling; Question: What are the main plant communities and vegetation zones on Phytosociology; Vegetation classification Socotra Island in relation to climatic, geological and topographic factors? Nomenclature Location: Socotra Island (Yemen). Miller & Morris (2004) Methods: A total of 318 releve´s were sampled along an altitudinal gradient. Received 25 December 2010 Floristic and environmental (topographic, geological and climatic) data were Accepted 27 April 2012 collected and analysed using numerical classification and NDMS ordination; an Co-ordinating Editor: Joop Schamine´ e analysis of the correlation between plant communities and environmental factors was also performed. De Sanctis, M. (corresponding author, Results: Eight types of woody vegetation, seven of shrubs, six of herbaceous [email protected]) & Attorre, F. (fabio. and seven of halophytic vegetation were identified. Ordination revealed [email protected]): Department of Plant the importance of altitudinal and climatic gradients, as well as of geological Biology, Sapienza University of Rome, I-00185, substrata. Rome, Italy Adeeb, A. (botanyunit.epa.socotra@gmail. Conclusions: Four vegetation zones were identified. The first three are located com) & Saed, A. ([email protected]): in the arid region with altitude ranging from 0 to 1000 m and the fourth in the Environmental Protection Authority (E.P.A.) of semi-arid region from 1000 to 1500 m a.s.l. Specifically they are: (1) an arid Socotra, Hadibo, Yemen coastal plain mainly located on an alluvial substratum between 0 and 200 m, Farcomeni, A. -

Overview of Biotope Types of Socotra Island
10.2478/jlecol-2014-0004 Journal of Landscape Ecology (2013), Vol: 6 / No. 3. OVERVIEW OF BIOTOPE TYPES OF SOCOTRA ISLAND HANA HABROVÁ AND ANTONÍN BUČEK Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology, Mendel University in Brno, Zemědělská 3, 613 00 Brno, Czech Republic, e-mail: [email protected], [email protected] Received: 10th March 2014, Accepted: 18th April 2013 ABSTRACT The study describes main biotopes of Socotra Island. The biotopes were distinguished and described during complex field observations on more than 250 localities of Socotra between years 1999-2004. Classification of biotopes is based on differences in physiognomy, structure and species composition of the vegetation component of present biocoenoses. Groups of biotope types differ, above all, in the physiognomy and structure of vegetation. Biotope types are divided according to composition of dominant species. In this manner, 13 groups of biotopes and 39 biotope types were distinguished and described. Keywords: Socotra Island, biotope type classification, geobiocoenological approach INTRODUCTION The present condition of biotopes on the island of Socotra is the result of long-term activities of man on the landscape, particularly through cattle grazing. The structure and species composition of biotopes distinguish in relation to the type and intensity of anthropogenic impacts, which show different consequences in particular types of geobiocoenes with a range of permanent ecological conditions. There are various approaches to biotope classification (e.g. Chytrý et al., 2010; Pählsson, 2008). We utilised the geobiocoenological approach (Maděra, 1998), based on the comparison of the natural (potential) and current state of geobiocoenoses in the landscape. In differentiating the current state of geobiocoenoses in the landscape, a formation- physiognomical approach is used. -
World Journal of Pharmaceutical Research Ali Et Al
World Journal of Pharmaceutical Research Ali et al. World Journal of Pharmaceutical Research SJIF Impact Factor 5.990 Volume 4, Issue 11, 2050-2056. Research Article ISSN 2277– 7105 ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF THE JATROPHA SPINOSA EXTRACTS ON THE SELECTED PATHOGENIC MICROORGANISMS Fuad Abdulla Nagi Al-hood1 and Khaled Saeed Ali*2 1Biology Department, Faculty of Education/Aden, University of Aden, Yemen. 2Biology Department, Faculty of Education/Sabir, University of Aden, Yemen. ABSTRACT Article Received on 14 Sept 2015, This study was conducted to assess the antimicrobial activity of the stem juice (sap) and the extracts of the Jatropha spinosa, that belongs Revised on 06 Oct 2015, Accepted on 28 Oct 2015, to the Euphorbiaceae family. The stem juice and the methanoli stem extract were tested against three bacterial species and one fungi. They *Correspondence for are as follows: the Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Author Pseudomonas aeruginosa and candida albicans was also used via agar Khaled Saeed Ali diffusion and minimum inhibitory concentration of (MIC) as a Biology Department, determination method. The fresh stem juice and the mehanolic stem Faculty of extract displayed a potential antibacterial activity against all the Education/Sabir, University of Aden, bacterial species, but the stem juice was more effective than the Yemen. methanolic stem extract. The plant extracts not showed any efficiency on C. albicans. MIC values for all the existing extracts at a concentration of 25 µl and 5 mg/l. KEYWORDS: Jatropha spinosa, Pathogenic microorganisms, Juice, Extract, Antimicrobial activity, MIC. INTRODUCTION The Jatropha tree belongs to the Euphorbiaceae family. This family Comprises about 300 to 5000 species distributed mainly in America and (tropical Africa).[1] The genus Jatropha contains approximately 170 known species. -

Information Sheet on Ramsar Wetlands (RIS) – 2009-2014 Version
Designation date: 08/10/2007 Ramsar Site no. 1736 Information Sheet on Ramsar Wetlands (RIS) – 2009-2014 version Available for download from http://www.ramsar.org/ris/key_ris_index.htm. Categories approved by Recommendation 4.7 (1990), as amended by Resolution VIII.13 of the 8th Conference of the Contracting Parties (2002) and Resolutions IX.1 Annex B, IX.6, IX.21 and IX. 22 of the 9th Conference of the Contracting Parties (2005). Notes for compilers: 1. The RIS should be completed in accordance with the attached Explanatory Notes and Guidelines for completing the Information Sheet on Ramsar Wetlands. Compilers are strongly advised to read this guidance before filling in the RIS. 2. Further information and guidance in support of Ramsar site designations are provided in the Strategic Framework and guidelines for the future development of the List of Wetlands of International Importance (Ramsar Wise Use Handbook 14, 3rd edition). A 4th edition of the Handbook is in preparation and will be available in 2009. 3. Once completed, the RIS (and accompanying map(s)) should be submitted to the Ramsar Secretariat. Compilers should provide an electronic (MS Word) copy of the RIS and, where possible, digital copies of all maps. 1. Name and address of the compiler of this form: FOR OFFICE USE ONLY. DD MM YY Abdulghany Al Mosaed Environment Protection Authority ( EPA). Wetlands Unit. Designation date Site Reference Number Industry zoon Zubairy st, P.O.Box: 19719, Sana’a – Yemen. Tel: + 967-1-206611, +967-1-207817 Fax: +967-1-207327 E-mail: [email protected] [email protected] 2. -

Dirachma Socotrana—Back from the Brink?
ORYX VOL 25 NO 4 OCTOBER 1991 Dirachma socotrana—back from the brink? M. Bazara'a, L. Guarino, A. Miller and N. Obadi Socotra, a small island in the Indian Ocean, is renowned for its remarkable flora. More than one-third of its 750 plant species are endemic, and seven are included in the IUCN Plant Red Data Book. Among these is Dirachma socotrana, which is something of a botanical curiosity. It was described in 1881 but confusion over its vernacular name led to the belief that it was widespread on the island. In 1989 the authors failed to find it in many of the sites where local people said it grew and on a second visit in 1990 the puzzle was resolved with the help of a linguist. In fact the species is apparently confined to one mountain pass. Although it is not immediately threatened it is, like many of the other plants on the island, at risk because of development plans. The small Indian Ocean island of Socotra has ered by a Scottish botanist, Sir Isaac Bayley long been renowned for its fascinating flora, Balfour, during his pioneering botanical expe- which includes such botanical curiosities as dition to the island in 1880. He collected only the cucumber tree Dendrosicyos socotrana and sterile material but was able to complete the the dragon's blood tree Dracaena cinnabari. description of the plant the following year Socotra, like many other oceanic islands, con- from flowering material collected by a tains a large number of endemic plant and ani- German explorer and naturalist, Georg mal species. -
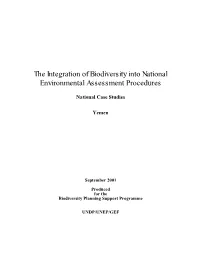
Integration of Biodiversity Into National Environmental Assessment Procedures
The Integration of Biodiversity into National Environmental Assessment Procedures National Case Studies Yemen September 2001 Produced for the Biodiversity Planning Support Programme UNDP/UNEP/GEF CASE STUDY 15 YEMEN 15 YEMEN Prepared by Ali Albar Mohammed CONTENTS 15 Yemen............................................................................................................1 15.1 Introduction....................................................................................................2 15.2 Biodiversity status..........................................................................................3 15.2.1 Wetlands ................................................................................................................... 3 15.2.2 Vegetation................................................................................................................. 3 15.2.3 Terrestrial Fauna ....................................................................................................... 4 15.3 Threats to biodiversity ...................................................................................9 15.3.1 Threats to Vegetation................................................................................................ 9 15.3.2 Threats to Terrestrial Fauna.................................................................................... 10 15.3.3 Threats to Freshwater Biodiversity......................................................................... 10 15.4 The NBSAP Process ......................................................................................10 -

1 Geobiocoenological Differentiation As a Tool for Sustainable Land-Use Of
Geobiocoenological differentiation as a tool for sustainable land-use of Socotra Island Hana Habrová Mendel University of Agriculture and Forestry, Department of Forest Botany, Dendrology and Typology, Zemědělská 3, 61300 Brno, Czech Republic, E-mail: [email protected] Abstract Socotra Island (Republic of Yemen) is inhabited by descendents of a primeval south-Semitic language group for some 3000 years. The main way of living is traditional pasturage husbandry and in the lesser extent also fishery. Pasturage is practised in a similar extensive way as on continental Yemen. Increasing anthropogenic pressure on the natural resources is thus above all driven by livestock grazing and by excessive wood depletion used for construction and fuelwood. As a matter of fact, grazing practice influenced plant communities and notably contributed to the contemporary distribution and structure of tree populations around the island, including endemic Commiphora spp., Boswellia spp., Dendrosicyos socotrana and Dracaena cinnabari. Consequently, the most extensive vegetation type is low grazed forest dominated by some Euphorbiaceae representatives as Croton spp. or Jatropha unicostata, species unpalatable to the livestock. Preservation of the biological richness of Socotra Island will not be, therefore, possible without restrictions aimed at pasturage husbandry, at least in the key structural segments of the ecological network. Precise geobiocoenological differentiation is needed for recognizing the detailed state of natural conditions of the island. Keywords: Socotra Island, vegetation tiers, geobiocoenological differentiation, pasturage, agroforestry Introduction In 1999-2001, within the programme of foreign development assistance of the Czech Republic a project was dealt with entitled "Creating an ecological network and agroforestry, educational and cultural doorway for sustainable development of Socotra Island (Republic of Yemen)".