Das Egoistische Gen Richard Dawkins
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

THE NAKED APE By
THE NAKED APE by Desmond Morris A Bantam Book / published by arrangement with Jonathan Cape Ltd. PRINTING HISTORY Jonathan Cape edition published October 1967 Serialized in THE SUNDAY MIRROR October 1967 Literary Guild edition published April 1969 Transrvorld Publishers edition published May 1969 Bantam edition published January 1969 2nd printing ...... January 1969 3rd printing ...... January 1969 4th printing ...... February 1969 5th printing ...... June1969 6th printing ...... August 1969 7th printing ...... October 1969 8th printing ...... October 1970 All rights reserved. Copyright (C 1967 by Desmond Morris. This book may not be reproduced in whole or in part, by mitneograph or any other means, without permission. For information address: Jonathan Cape Ltd., 30 Bedford Square, London Idi.C.1, England. Bantam Books are published in Canada by Bantam Books of Canada Ltd., registered user of the trademarks con silting of the word Bantam and the portrayal of a bantam. PRINTED IN CANADA Bantam Books of Canada Ltd. 888 DuPont Street, Toronto .9, Ontario CONTENTS INTRODUCTION, 9 ORIGINS, 13 SEX, 45 REARING, 91 EXPLORATION, 113 FIGHTING, 128 FEEDING, 164 COMFORT, 174 ANIMALS, 189 APPENDIX: LITERATURE, 212 BIBLIOGRAPHY, 215 ACKNOWLEDGMENTS This book is intended for a general audience and authorities have therefore not been quoted in the text. To do so would have broken the flow of words and is a practice suitable only for a more technical work. But many brilliantly original papers and books have been referred to during the assembly of this volume and it would be wrong to present it without acknowledging their valuable assistance. At the end of the book I have included a chapter-by-chapter appendix relating the topics discussed to the major authorities concerned. -

Animal Welfare and the Paradox of Animal Consciousness
ARTICLE IN PRESS Animal Welfare and the Paradox of Animal Consciousness Marian Dawkins1 Department of Zoology, University of Oxford, Oxford, UK 1Corresponding author: e-mail address: [email protected] Contents 1. Introduction 1 2. Animal Consciousness: The Heart of the Paradox 2 2.1 Behaviorism Applies to Other People Too 5 3. Human Emotions and Animals Emotions 7 3.1 Physiological Indicators of Emotion 7 3.2 Behavioral Components of Emotion 8 3.2.1 Vacuum Behavior 10 3.2.2 Rebound 10 3.2.3 “Abnormal” Behavior 10 3.2.4 The Animal’s Point of View 11 3.2.5 Cognitive Bias 15 3.2.6 Expressions of the Emotions 15 3.3 The Third Component of Emotion: Consciousness 16 4. Definitions of Animal Welfare 24 5. Conclusions 26 References 27 1. INTRODUCTION Consciousness has always been both central to and a stumbling block for animal welfare. On the one hand, the belief that nonhuman animals suffer and feel pain is what draws many people to want to study animal welfare in the first place. Animal welfare is seen as fundamentally different from plant “welfare” or the welfare of works of art precisely because of the widely held belief that animals have feelings and experience emotions in ways that plants or inanimate objectsdhowever valuableddo not (Midgley, 1983; Regan, 1984; Rollin, 1989; Singer, 1975). On the other hand, consciousness is also the most elusive and difficult to study of any biological phenomenon (Blackmore, 2012; Koch, 2004). Even with our own human consciousness, we are still baffled as to how Advances in the Study of Behavior, Volume 47 ISSN 0065-3454 © 2014 Elsevier Inc. -

1 Book Review the God Delusion Richard Dawkins New
Book review The God delusion Richard Dawkins New York, Houghton Mifflin Company, 2006 Renato Zamora Flores* * PhD. Professor, Department of Genetics, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre, RS, Brazil. “The achievements of theologians don’t do anything, don’t affect anything, don’t mean anything. What makes anyone think that “theology” is a subject at all?” (Richard Dawkins)1 On September 15, 2001, only 4 days after the terrorist attack to the World Trade Center in New York, Richard Dawkins – evolutionary biologist, 65 years, professor of public understanding of science at the University of Oxford – published an incisive article on the renowned English newspaper The Guardian, with the impressive title “Religion’s misguided missiles,” where he stated: “Those people were not mindless and they were certainly not cowards. On the contrary, they had sufficiently effective minds braced with an insane courage, and it would pay us mightily to understand where that courage came from. It came from religion. Religion is also, of course, the underlying source of the divisiveness in the Middle East... To fill a world with religion, or religions of the Abrahamic kind, is like littering the streets with loaded guns. Do not be surprised if they are used”.2 1 Without losing the courage and creativity that have characterized Dawkins since his first book, The selfish gene,3 launched 30 years ago, the British scientist now launches a dense and solid critical work on the logical and scientific bases of religious thinking: The God delusion. The title is a bit more sarcastic than it looks. -

Animal Welfare Regulation in the Australian Agricultural Sector: a Legitimacy Maximising Analysis
Animal Welfare Regulation in the Australian Agricultural Sector: A Legitimacy Maximising Analysis Jed Goodfellow LLB/BA (Hons), GDLP Macquarie Law School Macquarie University This thesis is presented for the degree of Doctor of Philosophy in Law September 2015 In dedication to each of the 605 million sentient beings used for food and fibre in Australia every year, and to the people who wish to represent their interests. Contents Abstract ........................................................................................................................... v Statement of Candidate .......................................................................................................... vi Acknowledgements ................................................................................................................. vii List of Tables and Figures ..................................................................................................... ix PART I - Setting the Regulatory Scene Chapter 1: Introduction ........................................................................................... 3 1.1 Background to research problem ....................................................................... 3 1.2 Research objectives and questions ..................................................................... 7 1.3 Methodology: the legitimacy and regulatory analytical framework .................. 8 1.3.1 Legitimacy theory ........................................................................................ 9 1.3.2 Input legitimacy -
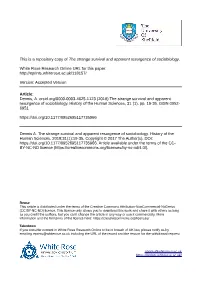
The Strange Survival and Apparent Resurgence of Sociobiology
This is a repository copy of The strange survival and apparent resurgence of sociobiology. White Rose Research Online URL for this paper: http://eprints.whiterose.ac.uk/118157/ Version: Accepted Version Article: Dennis, A. orcid.org/0000-0003-4625-1123 (2018) The strange survival and apparent resurgence of sociobiology. History of the Human Sciences, 31 (1). pp. 19-35. ISSN 0952- 6951 https://doi.org/10.1177/0952695117735966 Dennis A. The strange survival and apparent resurgence of sociobiology. History of the Human Sciences. 2018;31(1):19-35. Copyright © 2017 The Author(s). DOI: https://doi.org/10.1177/0952695117735966. Article available under the terms of the CC- BY-NC-ND licence (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/). Reuse This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND) licence. This licence only allows you to download this work and share it with others as long as you credit the authors, but you can’t change the article in any way or use it commercially. More information and the full terms of the licence here: https://creativecommons.org/licenses/ Takedown If you consider content in White Rose Research Online to be in breach of UK law, please notify us by emailing [email protected] including the URL of the record and the reason for the withdrawal request. [email protected] https://eprints.whiterose.ac.uk/ The strange survival and apparent resurgence of sociobiology Abstract A recent dispute between Richard Dawkins and Edward O. Wilson concerning fundamental concepts in sociobiology is examined. -
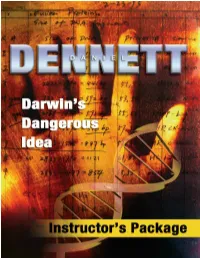
1. a Dangerous Idea
About This Guide This guide is intended to assist in the use of the DVD Daniel Dennett, Darwin’s Dangerous Idea. The following pages provide an organizational schema for the DVD along with general notes for each section, key quotes from the DVD,and suggested discussion questions relevant to the section. The program is divided into seven parts, each clearly distinguished by a section title during the program. Contents Seven-Part DVD A Dangerous Idea. 3 Darwin’s Inversion . 4 Cranes: Getting Here from There . 8 Fruits of the Tree of Life . 11 Humans without Skyhooks . 13 Gradualism . 17 Memetic Revolution . 20 Articles by Daniel Dennett Could There Be a Darwinian Account of Human Creativity?. 25 From Typo to Thinko: When Evolution Graduated to Semantic Norms. 33 In Darwin’s Wake, Where Am I?. 41 2 Darwin's Dangerous Idea 1. A Dangerous Idea Dennett considers Darwin’s theory of evolution by natural selection the best single idea that anyone ever had.But it has also turned out to be a dangerous one. Science has accepted the theory as the most accurate explanation of the intricate design of living beings,but when it was first proposed,and again in recent times,the theory has met with a backlash from many people.What makes evolution so threatening,when theories in physics and chemistry seem so harmless? One problem with the introduction of Darwin’s great idea is that almost no one was prepared for such a revolutionary view of creation. Dennett gives an analogy between this inversion and Sweden’s change in driving direction: I’m going to imagine, would it be dangerous if tomorrow the people in Great Britain started driving on the right? It would be a really dangerous place to be because they’ve been driving on the left all these years…. -

Richard Dawkins
RICHARD DAWKINS HOW A SCIENTIST CHANGED THE WAY WE THINK Reflections by scientists, writers, and philosophers Edited by ALAN GRAFEN AND MARK RIDLEY 1 3 Great Clarendon Street, Oxford ox2 6dp Oxford University Press is a department of the University of Oxford. It furthers the University’s objective of excellence in research, scholarship, and education by publishing worldwide in Oxford New York Auckland Cape Town Dar es Salaam Hong Kong Karachi Kuala Lumpur Madrid Melbourne Mexico City Nairobi New Delhi Shanghai Taipei Toronto With offices in Argentina Austria Brazil Chile Czech Republic France Greece Guatemala Hungary Italy Japan Poland Portugal Singapore South Korea Switzerland Thailand Turkey Ukraine Vietnam Oxford is a registered trade mark of Oxford University Press in the UK and in certain other countries Published in the United States by Oxford University Press Inc., New York © Oxford University Press 2006 with the exception of To Rise Above © Marek Kohn 2006 and Every Indication of Inadvertent Solicitude © Philip Pullman 2006 The moral rights of the authors have been asserted Database right Oxford University Press (maker) First published 2006 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, without the prior permission in writing of Oxford University Press, or as expressly permitted by law, or under terms agreed with the appropriate reprographics rights organization. Enquiries concerning reproduction outside the scope of the above should -

What, If Anything, Is a Darwinian Anthropology?
JONATHAN MARKS What, if anything, is a Darwinian anthropology? Not too many years ago, I was scanning the job advertisements in anthropology and stumbled upon one for a faculty post in a fairly distinguished department in California. The ad specified that they were looking for someone who ‘studied culture from an evolutionary perspective’. I was struck by that, because it seemed to me that the alternative would be a creationist perspective, and I had never heard of anyone in this century who did that. Obviously my initial reading was incorrect. That department specifically wanted someone with a particular methodological and ideo- logical orientation; ‘evolutionary perspective’ was there as a code for something else. It has fascinated me for a number of years that Darwin stands as a very powerful symbol in biology. On the one hand, he represents the progressive aspect of science in its perpetual struggle against the perceived oppressive forces of Christianity (Larson 1997); and on the other, he represents as well the prevailing stodgy and stultified scientific orthodoxy against which any new bold and original theory must cast itself (Gould 1980). Proponents of the neutral theory (King and Jukes 1969) or of punctuated equilibria (Eldredge 1985) represented themselves as Darwinists to the outside worlds, and as anti-Darwinists to the inside world. Thus, Darwinism can be both the new and improved ideology you should bring home today, and is also the superseded Brand X ideology. That is indeed a powerful metaphor, to represent something as well as its opposite. Curiously, nobody ever told me in my scientific training that scientific progress was somehow predicated on the development of powerful metaphors. -

Ten Misunderstandings About Evolution a Very Brief Guide for the Curious and the Confused by Dr
Ten Misunderstandings About Evolution A Very Brief Guide for the Curious and the Confused By Dr. Mike Webster, Dept. of Neurobiology and Behavior, Cornell Lab of Ornithology, Cornell University ([email protected]); February 2010 The current debate over evolution and “intelligent design” (ID) is being driven by a relatively small group of individuals who object to the theory of evolution for religious reasons. The debate is fueled, though, by misunderstandings on the part of the American public about what evolutionary biology is and what it says. These misunderstandings are exploited by proponents of ID, intentionally or not, and are often echoed in the media. In this booklet I briefly outline and explain 10 of the most common (and serious) misunderstandings. It is impossible to treat each point thoroughly in this limited space; I encourage you to read further on these topics and also by visiting the websites given on the resource sheet. In addition, I am happy to send a somewhat expanded version of this booklet to anybody who is interested – just send me an email to ask for one! What are the misunderstandings? 1. Evolution is progressive improvement of species Evolution, particularly human evolution, is often pictured in textbooks as a string of organisms marching in single file from “simple” organisms (usually a single celled organism or a monkey) on one side of the page and advancing to “complex” organisms on the opposite side of the page (almost invariably a human being). We have all seen this enduring image and likely have some version of it burned into our brains. -
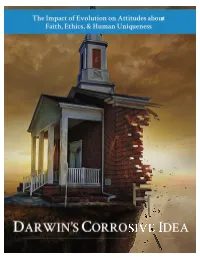
Darwins-Corrosive-Idea.Pdf
This report was prepared and published by Discovery Institute’s Center for Science and Culture, a non-profit, non-partisan educational and research organization. The Center’s mission is to advance the understanding that human beings and nature are the result of intelligent design rather than a blind and undirected process. We seek long-term scientific and cultural change through cutting-edge scientific research and scholarship; education and training of young leaders; communication to the general public; and advocacy of academic freedom and free speech for scientists, teachers, and students. For more information about the Center, visit www.discovery.org/id. FOR FREE RESOURCES ABOUT SCIENCE AND FAITH, VISIT WWW.SCIENCEANDGOD.ORG/RESOURCES. PUBLISHED NOVEMBER, 2016. © 2016 BY DISCOVERY INSTITUTE. DARWIN’S CORROSIVE IDEA The Impact of Evolution on Attitudes about Faith, Ethics, and Human Uniqueness John G. West, PhD* EXECUTIVE SUMMARY In his influential book Darwin’s Dangerous Idea, have asked about the impact of science on a person’s philosopher Daniel Dennett praised Darwinian religious faith typically have not explored the evolution for being a “universal acid” that dissolves impact of specific scientific ideas such as Darwinian traditional religious and moral beliefs.1 Evolution- evolution.5 ary biologist Richard Dawkins has similarly praised In order to gain insights into the impact of Darwin for making “it possible to be an intellect- specific scientific ideas on popular beliefs about ually fulfilled atheist.”2 Although numerous studies God and ethics, Discovery Institute conducted a have documented the influence of Darwinian nationwide survey of a representative sample of theory and other scientific ideas on the views of 3,664 American adults. -

Fish Cognition: a Primate's Eye View
Anim Cogn (2002) 5:1–13 DOI 10.1007/s10071-001-0116-5 REVIEW Redouan Bshary · Wolfgang Wickler · Hans Fricke Fish cognition: a primate’s eye view Received: 8 February 2001 / Accepted after revision: 6 September 2001 / Published online: 20 November 2001 © Springer-Verlag 2001 Abstract We provide selected examples from the fish lit- erature of phenomena found in fish that are currently be- Introduction ing examined in discussions of cognitive abilities and evolution of neocortex size in primates. In the context of Recently increased interest in cognitive aspects of the be- social intelligence, we looked at living in individualised haviour of animals is connected with advances in the de- groups and corresponding social strategies, social learning velopment of both theoretical frameworks and methodol- and tradition, and co-operative hunting. Regarding envi- ogy. Cognitive psychologists have adopted a more evolu- ronmental intelligence, we searched for examples concern- tionary approach to cognitive research (see historical re- ing special foraging skills, tool use, cognitive maps, mem- view in Kamil 1998). The major contribution of primatol- ory, anti-predator behaviour, and the manipulation of the ogy to cognitive psychology was arguably the develop- environment. Most phenomena of interest for primatolo- ment of the social intelligence hypothesis (Humphrey 1976; gists are found in fish as well. We therefore conclude that Byrne and Whiten 1988; Dunbar 1992), which states that more detailed studies on decision rules and mechanisms the evolution of cognitive skills together with a large neo- are necessary to test for differences between the cognitive cortex in primates was caused by the social complexity abilities of primates and other taxa. -

Hutnan Ethology Bulletin
Hutnan Ethology Bulletin VOLUME 12, ISSUE 1 ISSN 0739-2036 MARCH 1997 © 1997 The International Society for Human Ethology obviously not in the interests of the slaves. Why don't they go on strike? Because the slaves are not genetically related to anything that comes out of the nest where they are now working. Any gene that tended to make them go on strike would have no possibility of being benefited by the striking action. The copies of their genes, the ·copies of these striking workers genes, would be back in the home nest, and they would be being turned out by the queen, which the striking workers left behind. So there would be no opportunity for a phenotypic effect, namely striking, to benefit germ line copies of themselves. You also write about an ant species called Monomorium santschii in which there are no workers. The queen invades a nest of another species, and then uses chemicals to induce the An Interview of workers to adopt her, and to kill their own queen. How is it possible that natural sdection Richard Dawkins did not act against such incredible deception and manipulation, which must have been going By Frans Roes, Lauriergracht 127-II, 1016 on for millions of years? RK Amsterdam, The Netherlands In any kind of arms race, it is possible for one Richard Dawkins is a zoologist and Professor of . side in the arms race to lose consistently. Public. Understanding of Science at Oxford Monomorium santschii is a very rare species. If University. Of his best-selling books, The you look back in the ancestry of the victim- Selfish Gene (1976) probably did most in species over many millions of years, many of bringing the evolutionary message home to both their ancestors may never have encountered a professional and a general readership.