Roth, Karl Heinz: Wohin Der Zeitgeist Weht
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

KALAVRYTA: Occupation of 1941-1944 and the Holocaust of December 13, 1943 Memories from the Village of Aghios Nikolaos
KALAVRYTA: Occupation of 1941-1944 and the Holocaust of December 13, 1943 Memories from the Village of Aghios Nikolaos The Grieving Mother of Kalavryta Peter N. Demopoulos LOS ANGELES, 2017 KALAVRYTA: Occupation of 1941-1944 and the Holocaust of December 13, 1943 Memories from the Village of Aghios Nikolaos Peter N. Demopoulos …and you shall know the truth and the truth shall set you free. (John 8.32) 2017 First published in 2013 by Peter N. Demopoulos and the Hellenic University Club of Southern California in Los Angeles, California, www.huc.org . © Copyright 2015, 2017, Peter N. Demopoulos and the Hellenic University Club of Southern California. All rights reserved. Work may not be reproduced without permission by Peter N. Demopoulos or the publisher. Quoting is permitted with a reference to the source and a notice to the publisher at [email protected]. Published by the Hellenic University Club of Southern California PO Box 45581 Los Angeles, CA 90045-0581 USA ISBN-13: 978-1-938385-00-1 949.507 DF849 Published in the United States of America Second Edition 2017 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Also, can be found Online in GREEK and ENGLISH at the Hellenic University Club website www.huc.org Click on “Publications” and wait a few seconds for it to download. Contact: Peter N. Demopoulos 7485 McConnell Ave., Los Angeles, CA 90045 Phone/FAX: 310.215.3130 m: 310.923.1519 [email protected] TABLE OF CONTENTS Page Foreword……………………………………………………………………………………………………. 5 Acronyms…………………………………………………………………………………………………… 6 Greeks Defend Themselves Against the Invaders, 1940-1941…………………….. 6 The Italian Occupation ………………………………………………………………………………. -

1 Grundsätzliches - Verschiedenes
Stand: 12.02.2013 1 Grundsätzliches - Verschiedenes 1. 1.1 Nachschlagewerke – Gesamtdarstellungen 1.1.1 Übergreifende Literatur 1.1.2 Gesamtdarstellungen 1.1.3 Lexika - Dokumentationen 1.1.4 Bildbände 1.1.5 Bibliographien 1.2 Verschiedenes 1.2.1 Verwaltung besetzter Gebiete 1.2.1.1 Balkan Griechenland 1.2.1.2 Benelux 1.2.1.3 Frankreich 1.2.1.4 Italien 1.2.1.5 Polen 1.2.1.6 Russland 1.2.1.7 Skandinavien 1.2.2 Kriegsgefangenenschaft 1.2.2.1 Gesamtdarstellungen 1.2.2.2 Deutsche Soldaten in Kriegsgefangenschaft 1.2.2.2.1 Allgemeines 1.2.2.2.2 Kriegesgefangenschaft im Osten 1.2.2.2.2.1 Kriegsgefangenschaft in Russland 1.2.2.2.3 Kriegsgefangenschaft im Westen 1.2.2.2.3.3 Kriegsgefangenschaft in Grossbritannien 1.2.2.2.3.5 Kriegsgefangenschaft in den USA 1.2.2.2.4 Heimkehr 1.2.2.3 Alliierte Soldaten in Kriegsgefangenschaft 1.2.2.3.1 Alliierte Soldaten in deutscher Kriegsgefangenschaft 1.2.3 militärischer Widerstand 1.2.4 Propaganda 1.2.5 Feldpost 1.2.6 Nachrichtendienst - Spionage 1.2.7 Festungsbau, Bunker u.ä. 1.2.8 Tiere in der Wehrmacht 1.2.9 Vertreibung 1.2.10 Kriegswirtschaft 1.2.11 Memoiren – Erinnerungen - Erlebnisberichte 1.2.12 Biographien 1.2.13 Literarische Darstellungen 1.2.14 Verschiedenes 1.3 Hilfsliteratur Seite 1 von 80 1.1 Nachschlagewerke - Gesamtdarstellungen 1.1.1 Übergreifende Literatur Ariès, Philippe; Chartier, Roger (Hg.) (1999) Vom Ersten Weltkrieg zur Gegenwart. Augsburg: Weltbild Vlg. (Geschichte des privaten Lebens / Philippe Ariès u. -
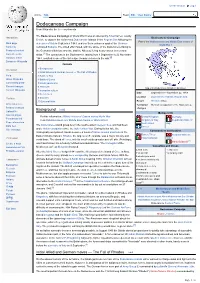
Dodecanese Campaign from Wikipedia, the Free Encyclopedia
Create account Log in Article Talk Read Edit View history Dodecanese Campaign From Wikipedia, the free encyclopedia The Dodecanese Campaign of World War II was an attempt by Allied forces, mostly Navigation Dodecanese Campaign British, to capture the Italian-held Dodecanese islands in the Aegean Sea following the Part of the Mediterranean and Middle East theatre of Main page surrender of Italy in September 1943, and use them as bases against the German- World War II Contents controlled Balkans. The Allied effort failed, with the whole of the Dodecanese falling to Featured content the Germans within two months, and the Allies suffering heavy losses in men and Current events ships.[3] The operations in the Dodecanese, lasting from 8 September to 22 November Random article 1943, resulted in one of the last major German victories in the war.[4] Donate to Wikipedia Contents 1 Background Interaction 2 Initial Allied and German moves — The Fall of Rhodes Help 3 Battle of Kos About Wikipedia 4 Battle of Leros Community portal 5 Naval operations Recent changes 6 Aftermath Map of the Dodecanese Islands (in dark blue) Contact Wikipedia 7 In popular culture Date September 8 – November 22, 1943 8 References Location Dodecanese Islands, Aegean Sea Toolbox 9 Sources 10 External links Result German victory What links here Territorial German occupation of the Dodecanese Related changes changes Background [edit] Upload file Belligerents Special pages Further information: Military history of Greece during World War United Kingdom Germany Permanent link II and Mediterranean and Middle East theatre of World War II Kingdom of Italy Republican State of Page information South Africa Italy The Dodecanese island group lies in the south-eastern Aegean Sea, and had been Data item Greece under Italian occupation since the Italo-Turkish War. -

Once in a Blue Moon: Airmen in Theater Command Lauris Norstad, Albrecht Kesselring, and Their Relevance to the Twenty-First Century Air Force
COLLEGE OF AEROSPACE DOCTRINE, RESEARCH AND EDUCATION AIR UNIVERSITY AIR Y U SIT NI V ER Once in a Blue Moon: Airmen in Theater Command Lauris Norstad, Albrecht Kesselring, and Their Relevance to the Twenty-First Century Air Force HOWARD D. BELOTE Lieutenant Colonel, USAF CADRE Paper No. 7 Air University Press Maxwell Air Force Base, Alabama 36112-6615 July 2000 Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Belote, Howard D., 1963– Once in a blue moon : airmen in theater command : Lauris Norstad, Albrecht Kesselring, and their relevance to the twenty-first century Air Force/Howard D. Belote. p. cm. -- (CADRE paper ; no. 7) Includes bibliographical references. ISBN 1-58566-082-5 1. United States. Air Force--Officers. 2. Generals--United States. 3. Unified operations (Military science) 4. Combined operations (Military science) 5. Command of troops. I. Title. II. CADRE paper ; 7. UG793 .B45 2000 358.4'133'0973--dc21 00-055881 Disclaimer Opinions, conclusions, and recommendations expressed or implied within are solely those of the author and do not necessarily represent the views of Air University, the United States Air Force, the Department of Defense, or any other US government agency. Cleared for public release: distribution unlimited. This CADRE Paper, and others in the series, is available electronically at the Air University Research web site http://research.maxwell.af.mil under “Research Papers” then “Special Collections.” ii CADRE Papers CADRE Papers are occasional publications sponsored by the Airpower Research Institute of Air University’s (AU) College of Aerospace Doctrine, Research and Education (CADRE). Dedicated to promoting understanding of air and space power theory and application, these studies are published by the Air University Press and broadly distributed to the US Air Force, the Department of Defense and other governmental organiza- tions, leading scholars, selected institutions of higher learn- ing, public policy institutes, and the media. -

Download Article (PDF)
MGZ 75/1 (2016): 94–122 OLDENBOURG Aufsatz Gaj Trifković Carnage in the Land of Three Rivers: The Syrmian Front 1944–1945 DOI 10.1515/mgzs-2016-0004 Abstract: The aim of this article will be to examine the operations of the Yugoslav Partisans and German armed forces in northern parts of Yugoslavia in late 1944 and early 1945. Since the summer of 1941, the communist-led guerrilla movement had conducted a massive guerrilla campaign against Axis forces, at the same time striving to build a regular army and thus gain recognition as a full-time member of the anti-Hitler coalition. The arrival of the Red Army and liberation of country’s eastern parts in September and October 1944 secured material foundations for a creation of a regular field force. Whether this nascent army would be capable of defeating its retreating, but still dangerous German foe remained to be seen. Keywords: Yugoslavia, Syrmia, Serbia, Croatia, Bosnia, Second World War, Parti- sans, Wehrmacht, front, operations, NOVJ The fierce fighting in the flat, open terrain of the province of Syrmia1 counted among the bloodiest of the whole war and left a lasting controversy about whether the Yugoslav Partisans should have pursued an active campaign on the so-called »Syrmian Front« in the first place. In the socialist Yugoslavia prior to the late 1970s, descriptions of operations on the Syrmian Front could usually be found in either general war histories or in unit histories; relevant Partisan docu- ments were published in several volumes of the massive »Zbornik dokumenata i 1 Syrmia (Serbian: Srem; Croatian: Srijem) is the geographical region between the rivers Danube and Sava, stretching from Belgrade in the east to the line north of Vukovar-Bosna estuary in the west. -

Danae Richter
Bibliographie Heinz A. Richter Danae Richter Bücher: 1. Griechenland zwischen Revolution und Konterrevolution 1936 - 1946 (Frankfurt: Europäische Verlagsanstalt, 1973), 623 Seiten; griechische Ausgabe. 2. Äýo gðáváóôÜógéò êáé ávôgðáváóôÜógéò óôçv EëëÜäá 1936 - 1946 (Athen: Exantas, 1977), 2 Bde. 3. Griechenlands Kommunisten und die Europäische Gemeinschaft (Köln: Bundesinstitut für ostwissenschaftliche und internationale Studien, Nr. 17 (1980), 54 Seiten. 4. Griechenland und Zypern seit 1920. Bibliographie zur Zeitgeschichte. (Heidelberg: Nea Hellas, 1984), 437 Seiten. 5. British Intervention in Greece: From Varkiza to Civil War, February 1945 - August 1946 (London: The Merlin Press, 1986), 573 Seiten. 6. Der griechisch-türkische Konflikt und die Haltung der Sowjetunion (Köln: Bundesin- stitut für ostwissenschaftliche und internationale Studien, Nr. 8 1987), 69 Seiten. 7. Frieden in der Ägäis? Zypern - Ägäis - Minderheiten (Köln: Romiosini, 1989), 168 Seiten. 8. Griechenland im 20. Jahrhundert Band 1: Megali Idea - Republik - Diktatur (Köln: Romiosini, 1990), 260 Seiten. 9. Griechenland im Zweiten Weltkrieg August 1939 - Juni 1941. PELEUS. Studien zur Archäologie und Geschichte Griechenlands und Zyperns Band 2 (Bodenheim: Syndi- kat, 1997), 515 Seiten. 10. Ç gðÝìâáóç ôùv ¢ããëùv óôçv ÅëëÜäá. Áðü ôç ÂÜñêéæá óôov Eìöýëéo Ðüëgìo (Athen: Estia, 1997, 22003), 669 Seiten. 11. Ç éôáëo-ãgñìávéêÞ gðé2góÞ gvÜvôéov ôçò ¸ëëÜäoò 1,2,3(Athen: Govostis, 1998-99), 687 Seiten. 12. Geschichte der Insel Zypern 1878-1949 Band 1 (Möhnesee: Bibliopolis, 2004) 560 Seiten. 13. Geschichte der Insel Zypern 1950-1959 Band 2 (Möhnesee: Bibliopolis, 2006) 665 Seiten 14. Éóôïñßá ôçò Êýðñïõ Ôüìïò Á’: 1878-1949 (Athen: Estia, 2007) 806 Seiten 15. Geschichte der Insel Zypern 1959-1965 Band 3 (Mainz, Ruhpolding: Rutzen, 2007) 665 Seiten 16. -
Freya Stark's Known Covert Activities in the Middle East, 1927–1943
Appendix A: Freya Stark’s known covert activities in the Middle East, 1927–1943, compiled from various archival and published sources From To Region Visited Objective/product Client 1927–10 1928 Levant Beirut; Unknown. Probably debriefed SIS/ Damascus; regarding the Jebel Druze WO? Jebel Druze; Palestine; Cairo 1930–04 1930–06 Persia Elburz Cartographic survey (Valley of WO Mountains the Assassins) 1931–08 1931–10 Persia Elburz Cartographic and WO/ Mountains; archaeological surveys (Valley RGS Luristan of the Assassins; Luri graves); RGS reports 1931–10 1933–03 Baghdad – Baghdad Times (mostly) ? 1932–09 1933–02 Persia Luristan Cartographic survey (Pusht-i- WO Kuh [uncharted]) 1934–12 1935–04 Yemen Hadhramaut Probably no intelligence. RGS? Aborted (measles) 1937–10 1938–03 Yemen Hadhramaut Probably no intelligence; just RGS RGS reports. (Wakefield archaeological expedition leader) 1939–03 1939–07 Syria Hama, Probably no intelligence RGS? Orontes valley, Aleppo © The Author(s) 2019 261 A. O’Sullivan, The Baghdad Set, https://doi.org/10.1007/978-3-030-15183-6 262 APPENDIX A: FREYA STARK’S KNOWN COVERT ACTIVITIES IN THE MIDDLE EAST… From To Region Visited Objective/product Client 1939–10 1939–10 Cairo – Meetings in Cairo with various – intelligence personalities: Cawthorn (MEIC), Thornhill (SIS), Clayton (DDMI), et al. 1939–11 1940–02 Aden – Assistant Information Officer. MOI/ Ikhwan al-Hurriya. Bonzo FO scheme 1940–02 1940–03 Yemen Sana’a Political, military, economic MEIC/ intelligence. Persuasion FO 1940–07 1941–03 Cairo Ikhwan. Bonzo scheme MOI/ SOE 1941–03 1943–02 Baghdad Ikhwan MOI 1943–02 1943–03 Delhi Bonzo scheme GOC 1943–04 1943–08 Baghdad Ikhwan MOI Periods between travels spent in the UK and/or Italy. -

Général Devers)
Appendice 1 Ordre de bataille du Groupe d’Armées E (Heeresgruppe E) Juillet 1943 Colonel-général Maximilian von Weichs (a succédé le 5 février 1943 à Erwin Rommel) QG à Belgrade – Chef d’état-major : August Winter 12. Armee [Grèce-Albanie] (Alexander Löhr) QG à Salonique – Chef d’état-major : Hermann Foertsch Troupes dépendant du Groupe d’Armées E - 19. Panzer-Brigade [constituée avec les blindés laissés sur place par les 15. et 21. Pz, quelques cadres et des novices sortis des écoles de la Panzerwaffe] (colonel Josef Irkens) - 1. Regiment Brandenburg - 201. StuG Abteilung - 242. StuG Abteilung Note 1 – La 19. Pzr Brigade, le 1. Brandenburg et le 242. StuG Abt formeront à partir du mois d’août la 19. PanzerGrenadier Division. Note 2 – Le 93. schwere Panzerjäger abteilung, sur Hornisse/Nashorn, sera envoyé au Groupe d’Armées E en septembre 1943. XXII. Gebirgs-Armee-Korps (Gustav Fehn) [Albanie et Macédoine] Oberbefehlshaber Albanien - 100. Jäger-Division (Willibald Utz) - Un régiment de musulmans soviétiques (Theodor Oberländer) de la 162. ID (Oskar von Niedermayer) - Unité albanaise en formation (à partir de milices d’allégeances changeantes…) ……… Oberbefehlshaber Saloniki - 97. Jäger-Division [arrivée à Salonique en juin] (Ludwig Müller) - 104. Jäger-Division [entre Salonique et Larissa] (Hartwig von Ludwiger) - 153. Feldausbildungs-Division [division d’instruction encadrée par des blessés légers et des convalescents] (Diether von Böhm-Bezing) - Eléments de la 4. SS-Polizei-Panzergrenadier-Division (Alfred Wünnenberg) XVIII. Gebirgs-Armee-Korps [ou Ägäis Korps] (Eduard Dietl) [Epire et Grèce centrale] - 1. Gebirgs-Division (Hubert Lanz) - 3. Gebirgs-Division (Hans Kreysing) - 4. Gebirgs-Division (Hermann Kress) - Gruppe Müller (Friedrich-Wilhelm Müller) [formation de la taille d’un gros régiment et constituée de Grecs collaborateurs, d’Italiens fascistes et de cadres allemands venus de différentes unités] LXVIII. -

M1035 Publication Title: Guide to Foreign Military Studies
Publication Number: M1035 Publication Title: Guide to Foreign Military Studies, 1945-54 Date Published: 1954 GUIDE TO FOREIGN MILITARY STUDIES, 1945-54 Preface This catalog and index is a guide to the manuscripts produced under the Foreign Military Studies Program of the Historical Division, United States Army, Europe, and of predecessor commands since 1945. Most of these manuscripts were prepared by former high-ranking officers of the German Armed Forces, writing under the sponsorship of their former adversaries. The program therefore represents an unusual degree of collaboration between officers of nations recently at war. The Foreign Military Studies Program actually began shortly after V-E Day, when Allied interrogators first questioned certain prominent German prisoners of war. Results were so encouraging that the program was expanded; written questions replaced oral interrogation, and later certain highly-placed German officers were asked to prepare a series of monographs. Originally the mission of the program was only to obtain information on enemy operations in the European Theater for use in the preparation of an official history of the U.S. Army in World War II. In 1946 the program was broadened to include the Mediterranean and Russian war theaters. Beginning in 1947 emphasis was placed on the preparation of operational studies for use by U.S. Army planning and training agencies and service schools. The result has been the collection of a large amount of useful information about the German Armed Forces, prepared by German military experts. While the primary aim of the program has remained unchanged, many of the more recent studies have analyzed the German experience with a view toward deriving useful lessons. -

United States Army European Command, Historical Division Typescript Studies, 1945-1954
http://oac.cdlib.org/findaid/ark:/13030/tf696nb1jc No online items Register of the United States Army European Command, Historical Division Typescript Studies, 1945-1954 Hoover Institution Archives Stanford University Stanford, California 94305-6010 Phone: (650) 723-3563 Fax: (650) 725-3445 Email: [email protected] © 1999, 2012 Hoover Institution Archives. All rights reserved. 66026 1 Register of the United States Army European Command, Historical Division Typescript Studies, 1945-1954 Hoover Institution Archives Stanford University Stanford, California Contact Information Hoover Institution Archives Stanford University Stanford, California 94305-6010 Phone: (650) 723-3563 Fax: (650) 725-3445 Email: [email protected] © 1999, 2012 Hoover Institution Archives. All rights reserved. Descriptive Summary Title: United States Army European Command, Historical Division Typescript Studies, Date (inclusive): 1945-1954 Collection number: 66026 Creator: United States. Army. European Command. Historical Division Collection Size: 60 manuscript boxes(25.2 linear feet) Repository: Hoover Institution Archives Stanford, California 94305-6010 Abstract: Relates to German military operations in Europe, on the Eastern Front, and in the Mediterranean Theater, during World War II. Studies prepared by former high-ranking German Army officers for the Foreign Military Studies Program of the Historical Division, U.S. Army, Europe. Language: English. Access Collection open for research. The Hoover Institution Archives only allows access to copies of audiovisual items. To listen to sound recordings or to view videos or films during your visit, please contact the Archives at least two working days before your arrival. We will then advise you of the accessibility of the material you wish to see or hear. Please note that not all audiovisual material is immediately accessible. -

Schrankenloser Terror Geschichte
Tageszeitung junge Welt http://www.jungewelt.de/2014/06-10/042.php?print=1 10.06.2014 / Thema / Seite 10 Schrankenloser Terror Geschichte. Vor 70 Jahren verwüsteten deutsche Soldaten die griechische Gemeinde Distomo und töteten mehr als 200 Einwohner. Die Angehörigen der Opfer sind bis heute nicht entschädigt Martin Seckendorf Der 10. Juni 1944 hat sich tief in das kollektive Gedächtnis von Franzosen und Griechen eingebrannt. An diesem Tag zerstörten Soldaten einer Waffen-SS-Einheit die Gemeinde Oradour sur Glane in Mittelfrankreich und ermordeten 642 Einwohner. Es war das größte Kriegsverbrechen, das die deutschen Besatzer während des Zweiten Weltkrieges in Westeuropa verübten. Auch wegen eines aufsehenerregenden Strafverfahrens, das die DDR-Justiz 1983 gegen einen Haupttäter führte, war der Massenmord in Deutschland gut bekannt – lange vor dem Besuch des Bundespräsidenten 2013 an den zum Denkmal erklärten Ruinen des von den Faschisten zerstörten Dorfes. Dagegen ist das Massaker der deutschen Besatzer vom 10. Juni 1944 in dem griechischen Ort Distomo noch immer weiten Teilen der hiesigen Bevölkerung kaum bekannt. Massenmord im Wochentakt Am Abend des 14. Juni 1944 erreichte die in Athen tätige Vertretung des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) die Nachricht, daß deutsche Soldaten in Distomo ein Massaker mit vielen Toten verübt und das Dorf abgebrannt hätten. Das schwedische Ehepaar Clio und Sture Linnér, beide Mitarbeiter des IKRK, meldeten sich für eine Erkundungsmission. Distomo liegt südöstlich des Parnassos-Gebirges und unweit des Apollon-Orakelheiligtums in Delphi, das in der Antike als »Nabel der Welt« galt. Die beiden Schweden brachen noch in der Nacht mit Kleidung und Verbandsmaterial in die 170 Kilometer von Athen entfernte Ortschaft auf. -

Dr. Alexandra Kankeleit Archäologische Aktivitäten In
Dr. Alexandra Kankeleit Archäologische Aktivitäten in Griechenland während der deutschen Besatzungszeit, 1941-1944 Vortrag 2015 / 2016 Berlin – Frankfurt – Athen Bei dem folgenden Text handelt es sich um einen Vortrag, der 2015 und 2016 an verschiedenen Orten in Deutschland und Griechenland gehalten wurde. Für Unterstützung und Anregungen danke ich der Archäologischen Gesellschaft in Athen und dem Deutschen Archäologischen Institut, insbesondere Herrn Prof. B. Petrakos und Frau Prof. K. Sporn. Eine tiefergehende Untersuchung zum Thema ist aktuell in Vorbereitung. Inhalt Einleitung .........................................................6 5. Zusammenarbeit mit dem Kunstschutz der Wehrmacht ...........36 1. Bedeutung der deutschen Archäologie in Griechenland ............9 5.1. Merkblätter und sonstige Publikationen .........................36 1.1. Herausragende Altertumswissenschaftler in Griechenland ..........9 5.2. Prospektion und Luftbildaufnahmen ............................ 37 1.2. Das Deutsche Archäologische Institut in Athen ................... 10 5.3. Propaganda und Öffentlichkeitsarbeit ...........................39 1.3. Einfluss deutscher Politik und Wissenschaft 5.4. Ausgrabungen ...............................................42 auf griechische Altertumsforscher ...............................13 6. Kontroverse mit dem Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg ..........42 2. Strukturen und Organisation während der NS-Zeit. 14 7. Pläne der Forschungsgemeinschaft Deutsches Ahnenerbe der SS ...45 2.1. Situation vor 1934. 14 8. Funktion