©Museum Heineanum Orn
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

678 Wernigerode - Drei Annen Hohne - Benneckenstein - Eisfelder Talmühle - Nordhausen Nord
Hasselfelde - 678 Wernigerode - Drei Annen Hohne - Benneckenstein - Eisfelder Talmühle - Nordhausen Nord - Schierke (Schmalspurbahn) Rbd Magdeburg Train No. 14411 14441 14461 14401 14431 14403 14405 14449 14445 14407 14443 14415 14466 14433 14447 14417 14409 14409 km 0,0 Wernigerode Dep ... ... ... 6.35 8.00 Ý 9.02 â 9.42 ú 9.42 10.45 11.56 ... ... ... Ý 14.35 â 14.35 ... Ý 16.58 â 17.10 1,0 Wernigerode Westerntor ¶ ... ... ... 6.40 8.05 å 9.06 å 9.47 åµ 10.54 12.10 ... ... ... å 14.40 å 14.40 ... å 17.03 å 17.15 2,5 Wernigerode Kirchstraße µ ... ... ... 6.44 8.09 å 9.11 å 9.51 åµ 10.58 12.14 ... ... ... å 14.44 å 14.44 ... å 17.07 å 17.19 4,3 Wernigerode-Hasserode µ ... ... ... 6.52 8.16 å 9.18 å 9.58 åµ 11.05 12.22 ... ... ... å 14.52 å 14.52 ... å 17.14 å 17.26 5,9 Steinerne Renne ´ ... ... ... 6.57 8.22 å 9.25 å 10.05 åµ 11.11 12.28 ... ... ... å 14.57 å 14.57 ... å 17.21 å 17.40 14,1 Drei Annen Hohne Arr ... ... ... 7.18 8.43 å 9.46 å 10.26 å 10.37 11.33 12.49 ... ... ... å 15.18 å 15.18 ... å 17.43 å 18.02 14,1 Drei Annen Hohne Dep ... ... ... · 8.51 · · · · · ... ... ... å 15.27 · ... · · 19,4 Schierke Arr ... ... ... · 9.05 · · · · · ... ... ... Ý 15.41 · ... · · 14,1 Drei Annen Hohne Dep ... ... ... 7.26 ... å 9.54 å 10.34 å 11.23 11.48 12.57 .. -

Auf Diesen Bus-Linien Gilt HATIX
ê Braunschweig Alt Wallmoden ê Magdeburg ê 650 Klein Mahner ê Beuchte 822 Dardesheim 834 ê Neu Wallmoden ê 860 ê Hildesheim 212 Deersheim Huy Schwanebeck ê Braunschweig ê Bredelem 833 Vienenburg 210 Berßel 214 ê Hessen Osterwiek Nienhagen Schauen Zilly Sargstedt Hahausen Aspenstedt ê Dardesheim 222 236 Neuerkrug ê Liebenburg 852 Athenstedt 220 ê Dedeleben 273 Gröningen 801 802 803 Abbenrode 836 ê Rhüden Langelsheim 213 Groß Quenstedt Emersleben Astfeld 804 805 806 821 Wasserleben 210 Bornhausen Deesdorf Langeln Innerstestausee Wolfshagen Schachdorf Danstedt im Harz Goslar 874 Stöbeck Oker Veckenstedt Heudeber 832 Rammelsberg 866 873 1 2 11 12 Stapelburg Granestausee 810 871 272 Halberstadt 13 14 15 16 859 Seesen 271 275 234 Bad Harzburg Baumwipfelpfad 270 Harsleben Wegeleben Lautenthal Reddeber Minsleben 231 Herrhausen Hahnenklee Rabenklippen 201 202 Derenburg Ilsenburg Langenstein Kirchberg 861 830 Drübeck 203 204 Silstedt Hedersleben Radau-Wasserfall 875 Münchehof 205 831 Bockswiese Wernigerode 837 Plessenburg Darlingerode Schulenberg Okerstausee ê Ildehausen Schloss 233 Regenstein Eckerstausee Benzingerode Höhlenerlebnis- Wildemann 841 Ditfurt zentrum 250 Heimburg 820 274 842 Brocken Bad Grund 1.141 m Michaelstein Westerhausen 235 232 ê Heteborn/Gatersleben/ Altenau Torfhaus 264 Clausthal- 230 206 Nachterstedt Gittelde 460 Schaubergwerk Blankenburg Schaubergwerk Zellerfeld Büchenberg 252 Hohnehof Büchenberg Cattenstedt Teufelsmauer Windhausen Oderbrück 261 Schloss Timmenrode 251 Quedlinburg Buntenbock Warnstedt Badenhausen 840 Stieglitzecke -

Huminstoffe in Talsperren – Die Situation in Sachsen-Anhalt
Huminstoffe in Talsperren – Die Situation in Sachsen-Anhalt Dr. Peter Michalik Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH Dresden, 21.11.2016 Gliederung Unternehmen Rappbodetalsperrensystem Überwachung der Rohwasserqualität im Einzugsgebiet DOC- und SAK-Entwicklung im Rohwasser Aktuelle Maßnahmen Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH Dr. Peter Michalik 2 Unternehmen 1966 gegründet 1990 Umwandlung in die Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH Größter mitteldeutscher Trinkwasserversorger mit Kundenstamm aus Stadtwerken, Wasserzweckverbänden und Industriekunden Versorgt ca. 2 Millionen Menschen mit ca. 75 Millionen Kubikmeter Wasser jährlich Ca. 210 Mitarbeiter an mehreren Standorten Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH Dr. Peter Michalik 3 Unternehmen Wasserwerke WW Wienrode 180.000 m³/d WW Torgau-Ost 100.000 m³/d WW Mockritz 60.000 m³/d Hochbehälter 12 Stück mit 203.500 m³ Speicherraum Leitungsnetz 765 km Fernleitungsnetz 60 km Rohwasserleitungen Nennweite DN 200 bis DN 1200 Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH Dr. Peter Michalik 4 Unternehmen - Versorgungssystem Wasserwerk Ostharz-Leitung Wienrode Wasserwerk Mockritz Nordring Südring Wasserwerk Torgau Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH Dr. Peter Michalik 5 Einzugsgebiet – Rappbodetalsperre Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH Dr. Peter Michalik 6 Trinkwasseraufbereitung Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH Dr. Peter Michalik 7 Trinkwasseraufbereitung Verfahrensschema WW Wienrode Kalk- sättiger Branntkalksilo Kalk- Kalkwasser zur pH- schlamm- Wert-Einstellung speicher -
Baumann Cave
Landmark 13 Baumann Cave ® On the 17th of November, 2015, during the 38th UNESCO General Assembly, the 195 member states of the United Nations resolved to introduce a new title. As a result, Geoparks can be distinguished as UNESCO Global Geoparks. Among the fi rst 120 UNESCO Global Geoparks, spread throughout 33 countries around the world, is Geopark Harz · Braunschweiger Land · Ostfalen. UNESCO-Geoparks are clearly defi ned, unique areas, in which locations and landscapes of international geological importance are found. They are operated by organisations which, with the involvement of the local population, campaign for the protection of geological heritage, for environmental education and for sustainable regional development. 22 Königslutter 28 ® 1 cm = 16,15 miles 20 Oschersleben 27 18 14 Goslar Halberstadt 3 2 8 1 Quedlinburg 4 Osterode a.H. 9 11 5 133 15 16 6 10 17 19 7 Sangerhausen NordhausenN 12 21 As early as 2004, 25 Geoparks in Europe and China had founded the Global Geoparks Network (GGN). In autumn of that year Geopark Harz · Braunschweiger Land · Ostfalen became part of the network. In addition, there are various regional networks, among them the European Geoparks Network (EGN). These coordinate international cooperation. In the above overview map you can see the locations of all UNESCO Global Geoparks in Europe, including UNESCO Global Geopark Harz · Braunschweiger Land · Ostfalen and the borders of its parts. Stalactite Caves 1 Baumann Cave, Hermann Cave The Baumann Cave is known as the oldest visitors’ caves in Germany. Visitations were carried out here already in 1649. Even JOHANN WOLFGANG VON GOETHE (1749 – 1832) admired the beauty of the “Baumannshöhle” and is said to have visited it three times. -

Harzbücherei Wernigerode Wissenschaftliche Regionalbibliothek Gegründet 1868 Durch Den Harzverein Für Geschichte Und Altertumskunde
Harzbücherei Wernigerode wissenschaftliche Regionalbibliothek gegründet 1868 durch den Harzverein für Geschichte und Altertumskunde Klint 10 38855 Wernigerode Linolschnitt K.-H.Anger Opusliste 100, x3, 1980 Tel.: 03943 - 654424 654428 Fax: 654497 E-Mail: [email protected] Erwerbungen 2009 - Auswahlverzeichnis - Otmar Alt : ein Künstler in seiner Zeit. Hrsg. von Volker Kapp. Hamm 1988. 240 S. - Ku 636 - Amling, Christian: Der Koffer der Pandora : Kriminalroman. Mit Zeichn. von Jochen Müller. Oschersleben 2008. 200 S. - An 484 - Anzeigen-Schriften. Halberstadt : Der Mitteldeutsche, [ca.1936]. [43] Bl. - Ku 630 - Baranowski, Frank: Rüstungsprojekte in der Region Nordhausen, Worbis und Heiligenstadt während der NS-Zeit : der Großeinsatz von Fremdarbeitern, Kriegsgefangenen und KZ-Häftlingen in der deutschen Kriegswirtschaft unter Berücksichtigung der Untertageverlagerung in der Endphase des NS-Regimes. Duderstadt 1998. 96 S. Literaturverz. S. 92 - 95 - F 126 - Batek, G.: Entdecke den Nationalpark Harz : dein Mitmachbuch zum bundesweiten Junior Ranger Treffen. [Hrsg.: EUROPARC Deutschland e.V., Berlin. Idee, Konzeption und Text: G. Batek]. Berlin 2009. 20 S. + 1 Kt.-Beil. (Junior Ranger) - Ad 552 - Baumann, Eike: Der Konvertit Victor Aimé Huber (1800-1869) : Geschichte eines Christen und Sozialreformers im Spannungsfeld von Revolution und Reaktion. Leipzig 2009. 405 S. (Arbeiten zur Kirchen- und Theologiegeschichte ; 26) Zugl.: Leipzig, Univ., Diss., 2008. - Literaturverz. S. 383-398. Personenreg. S. 400-405 - Gen Hu 79 - Baumgartner, Konrad: Johann Michael Sailer (1751-1832) und die Gräfliche Familie zu Stolberg-Wernigerode - eine geistliche Freundschaft. S. 185 - 205 Aus: Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg ; 43.2009 - At 262 - Behme, Friedrich u. Hermann Fricke: Bilder aus dem Okerthal : 24 photographische Original-Aufnahmen. 2. Aufl. Hannover 1896. -

„Eisperlen“ Rufen – Und Hasselfelder Folgen Hasselfelde (Bfa) ● Mehr Motor- Radfahrer Bzw
Volksstimme 16 | Harzer Volksstimme Freitag, 26. Mai 2017 Oberharz Pakplatz-Plan am Brockenken Redaktion: auf langem Weg Burkhard Falkner (bfa), Tel.: 01 72/ ● 9 13 52 04, [email protected] Oberharz am Brocken(bfa) Die Verwaltung der Stadt hat den Service-Agentur: ersten Schritt zur Erweiterung Reisebüro Köhler, Oberstadt 65, 38877 Benneckenstein des Parkplatzes an der Rappbo- Tel.: 03 94 57/9 10 03 detalsperre getan. [email protected] Auf den Weg gebracht wur- den eine Änderung des Flä- chennutzungsplanes sowie ein Bebauungsplan für weitere 250 Parkplätze. Der Stadtrat Ober- Meldungen harz tagt Mitte Juni zu diesem Thema. Dauern werde das Ver- Stadtverwaltung fahren bis zum Bau der Plätze jedoch, so Experten mit Ver- heute geschlossen weis auf das Baugesetzbuch, Oberharz am Brocken (bfa) ● Die etwa anderthalb Jahre. Büros der Stadtverwaltung Am gestrigen Vatertag gin- Oberharz sind aufgrund des gen erneut viele Besucher über Brückentages am heutigen Staumauer und Brücke (Foto). Freitag geschlossen. Dafür Der Pkw-Stau war nicht so wird um Verständnis gebeten. stark wie in den ersten Tagen Alle Ämter sind für die Bürger nach der Eröff nung der Attrak- wieder ab Montag, 29. Mai, zu tion. Foto: Burkhard Falkner den gewohnten Sprechzeiten erreichbar. ➡ Weitere Infos im Internet: www.Oberharzstadt.de Biker erkunden vermehrt den Harz „Eisperlen“ rufen – und Hasselfelder folgen Hasselfelde (bfa) ● Mehr Motor- radfahrer bzw. Biker als sonst Bürger packen in wachsender Zahl bei der Saisonvorbereitung im Waldseebad an sind dieses Wochenende in der Region unterwegs. Zahl- Über 50 Harzer haben das Kinder waren gleich mit da- dekabinen zu Leibe, beseitigten ,Eisperlen’ Susi sowie Karin, Tiebe, unserer Bademeisterin, selfelder Eisenbahnfreunde. -

Auch Wenn Schnee Das Land Bedeckt, Ist Hasselfelde Ein Geheimtipp Für Individualisten
Mitteilungen der Neue Folge / Nr. 4 2017 25. Jahrgang / ISSN 1619-8085 Auch wenn Schnee das Land bedeckt, ist Hasselfelde ein Geheimtipp für Individualisten Foto: Jutta Wenzel Ein wenig träumen nur … den Blick wem und – komm mir bloß nicht noch mit heil’ge Christ. schweifen lassen in eine Landschaft, die dem Christkind im Stall und so’n Mist. Wo Es ist so fromm und freundlich, wie kein’s uns erschließt, was wir ersehnen: ist das geboren? In Bethlehem? Gefährli - auf Erden ist ... Stille, Schönheit, Harmonie. che Gegend das. Alles erfunden. Und außerdem gibt‘s da gar keine ‘kalte Win - Ein Märchen nur und doch – unendlich „Schau hin, mein Kind, erkennst du Spu - ternacht‘…“ schön und verheißungsvoll: Engel unter ren im Schnee? Vielleicht vom Nikolaus, der dem Sternenzelt, Engel in weißem, we - die Geschenke bringt?“ Ein wenig träumen nur … sage ich … henden Gewand, die Flügel weit gebreitet. „Den gibt’s gar nicht. Hab‘ gestern abend von einer Welt, in der Märchen wahr wer - Engel, wundersame Wesen aus unermess - gesehen, wie Mami meine Stiefel vor der den … lich fernen Weiten. Sie kommen zu uns und Tür mit Schoko und so, vollgestopft hat. bringen das Heil ... Aber warum hast du dann deine Stiefel … Über den Himmel fliegen drei Engel - Ein Märchen nur – Lichtblick zugleich in den Flur gestellt? wunderbar. – am grau verhangenen Himmelszelt. Ich will die Kinderschokolade – egal von Sie tragen ein holdes Kindlein. Das ist der Jutta Blumenau-Niesel Im Dezember 2017 Geschichte Hasselfelde – ein Kulturdenkmal in Sachsen-Anhalt Von Jutta Blumenau-Niesel kannteste Stadt deutscher Herkunft in Bra - silien. 1850 gegründet von Hermann Blu - menau aus Hasselfelde am Harz. -

Wernigerode - Elbingerode - Hasselfelde - Allrode - Güntersberge
Gültig ab 27. August 2020 bis auf Widerruf! [Alle Angaben ohne Gewähr! Änderungen bleiben vorbehalten!] 260 C Wernigerode - Elbingerode - Hasselfelde - Allrode - Güntersberge Mo - Fr außer Feiertag Sa außer Feiertag Fahrtnummer 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0008 0007 0016 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0201 0202 0203 0204 Haltestellen - . - . - ᵿ Wernigerode Hbf. 8 ab 6.45 7.45 8.45 9.45 10.45 11.45 12.45 12.45 13.45 13.45 14.45 15.45 16.45 17.45 18.45 8.05 10.05 12.05 14.05 Wernigerode Heltauer Platz 6.48 7.48 8.48 9.48 10.48 11.48 12.48 12.48 13.48 13.48 14.48 15.48 16.48 17.48 18.48 8.08 10.08 12.08 14.08 Wernigerode Waldhofbad 6.51 7.51 8.51 9.51 10.51 11.51 12.51 12.51 13.51 13.51 14.51 15.51 16.51 17.51 18.51 8.11 10.11 12.11 14.11 Wernigerode HSB-Bf. Westerntor 6.52 7.52 8.52 9.52 10.52 11.52 12.52 12.52 13.52 13.52 14.52 15.52 16.52 17.52 18.52 8.12 10.12 12.12 14.12 Wernigerode Forckestr. 6.53 7.53 8.53 9.53 10.53 11.53 12.53 12.53 13.53 13.53 14.53 15.53 16.53 17.53 18.53 8.13 10.13 12.13 14.13 Wernigerode Marktstr. 6.54 7.54 8.54 9.54 10.54 11.54 12.54 12.54 13.54 13.54 14.54 15.54 16.54 17.54 18.54 8.14 10.14 12.14 14.14 Wernigerode Holfelder Platz 6.56 7.56 8.56 9.56 10.56 11.56 12.56 12.56 13.56 13.56 14.56 15.56 16.56 17.56 18.56 8.16 10.16 12.16 14.16 Wernigerode Tiergartenstr. -

MD 24 – Wasser- Und Abwasserzweckverband Oberharz
Bezeichnung des Versorgungsgebietes Beschreibung des Versorgungsgebietes Jahr der Erhebung MD 24 – Wasser- und Ldkrs. Harz: die Städte Benneckenstein(Harz), Abwasserzweckverband Oberharz Elbingerode(Harz) und Hasselfelde sowie die Gemeinden Elend, Schierke, Sorge, Stiege und Tanne 2008 Anzahl Einwohner Anzahl Einwohner Anzahl Einwohner Anschluss - gesamt - an öff. WV angeschlossen - einzelversorgt -grad in % 13.329 13.329 0 100 Gegenwärtige Wasserbedarfsdeckung in m³/a Trautenstein 25.800 Eigenförderung gesamt in m³/a Königshütte (Teichtalstollen) 33.100 Rübeland 47.300 110.600 Stadtwerke Wernigerode/Harz GmbH 362.860 Fremdbezug gesamt in m³/a Trinkwasserversorgung Magdeburg GmbH (TWM) 163.829 526.689 Abgabe an Dritte in m³/a 0 Trinkwasserverbrauch Eigenverbrauch und Mittlerer Trinkwasser- Spez. Trinkwasser- Spez. Trinkwasser- gesamt im VG in m³/a Verluste in m³/a verbrauch im VG in m³/a verbrauch in m³/Ea verbrauch in l/Ed 637.289 137.469 499.820 37,5 103 Entwicklung Wasserbedarf/Wasserbedarfsdeckung und geplante Maßnahmen bis 2020 Nach Prognose des StaLA Sachsen-Anhalt wird sich die Zahl der Einwohner im Versorgungsgebiet Oberharz bis zum Jahr 2020 auch weiterhin reduzieren. Der prognostizierte Rückgang der Einwohnerzahl beträgt danach 7,4 %. Im Versorgungsgebiet werden im Jahr 2020 voraussichtlich nur noch 12.343 Einwohner leben. Der spezifische Wasserverbrauch wird sich auch künftig nicht wesentlich ändern. Bei einer Annahme von etwa 105 l/Ed (bzw. 38,2 m³/Ea) kann der mittlere Trinkwasserverbrauch im Versorgungsgebiet des WAZV Oberharz eine Höhe von 471.503 m³/a erreichen. Die Deckung dieses prognostizierten Wasserbedarfs kann auch in Zukunft einerseits durch eigene örtliche WVA’en und andererseits durch den Trinkwasserbezug von anderen WVU gewährleistet werden. -

Deformation Behaviour of a Concrete Gravity Dam Based on Monitoring Data and Numerical Simulation
Deformation behaviour of a concrete gravity dam based on monitoring data and numerical simulation Doctoral Thesis (Dissertation) to be awarded the degree Doctor of Engineering (Dr.-Ing.) submitted by M. Sc. Yuan Li from Shanxi, China approved by the Faculty of Energy and Economic Sciences Clausthal University of Technology Date of oral Examination 10 December 2020 Dean Prof. Dr. Bernd Lehmann Chairperson of the Board of Examiners Prof. Dr. Hans-Jürgen Gursky Supervising tutor Prof. Dr.-Ing. Norbert Meyer Reviewer Prof. Dr. Roland Strauß Acknowledgements I Acknowledgements It has been a great privilege for me to spend several years working in the Institute of Geotechnical Engineering and Mine Surveying at Clausthal University of Technology. Foremost, I would like to express my sincere thanks to Univ.-Prof. Dr.-Ing. Norbert Meyer, my supervisor, for his encouragement and instructive guidance for the development of my dissertation. Especially I would like to express my profound gratitude to Dr.-Ing. Ansgar Emersleben for his support and numerous constructive advices. My further thanks go to all colleagues in Institute of Geotechnical Engineering and Mine Surveying for providing me a pleasant working environment. Especially I would like to thank Dipl.-Ing. Daniel Gröger and Dr.-Ing. Chuantao Chen for the support and lots of technical discussions. Also, I am indebted to the team of Dam management in Sachsen-Anhalt for providing the necessary monitoring data. I would like to extend my gratitude to the China Scholarship Council (CSC) and Department of Geotechnical Engineering at Clausthal University of Technology for the financial supporting for my stay in Germany. -

Wernigeröder Selbsthilfegruppen Stand 21.4.20
Wernigeröder Selbsthilfegruppen Stand 21.4.20 Derzeit sind in der Selbsthilfekontaktstelle Landkreis Harz für den Bereich Wernigerode 37 (+ 1 SHG i.G.) Selbsthilfegruppen gemeldet: Krebs - Frauen nach Krebs Wernigerode - Junge Frauen nach Krebs Wernigerode - SHG für Kehlkopflose Hasselfelde - SHG Stomaträger Wernigerode andere chronische Krankheiten - Diabetiker SHG Wernigerode - Diabetiker SHG Hasselfelde - SHG Parkinson Wernigerode - SHG Multiple Sklerose Wernigerode - Rheuma SHG Wernigerode - SHG Restless legs „Zappelbeine“ Wernigerode - SHG Lipödemerkrankte Wernigerode Psychische Erkrankungen/Störungen - SHG f. seelisch Belastete Wernigerode - SHG „Oberharz“ (Ängste/Depression) Benneckenstein - SHG Sprung ins Leben Wernigerode - SHG Sucht – Depression WR Sucht - 4 SHG Sucht im Diakonie Krankenhaus GmbH Elbingerode (Betroffene und Angehörige) - SHG Sucht und Depression Wernigerode - Blaues Kreuz „New life“ Wernigerode - 2 Blaues Kreuz Elbingerode I und II - AS - MILEST e.V. (ehemalige Drogenabhängige) WR - Frauen-SHG „Blütezeit“ - i.G. Suchtgruppe Hoppenstedt Behinderungen - Rolli Wernigerode - Schlaganfall Wernigerode - SHG im Blinden-u. Sehbehindertenverband Ilsenburg, Wernigerode - SHG Endoprothesenträger Wernigerode - Harzkinder 21 Eltern und Angehörige Lebenslagen/Lebenskrisen - Gesprächskreis für Trauernde Wernigerode - SHG 50 plus Wernigerode - Hormonselbsthilfe Wernigerode - Angehörige Demenzerkrankter Wernigerode - SHG Eltern von Sternenkindern - SHG alleinerziehende Mütter Wernigerode Es gibt weitere Selbsthilfegruppen in -
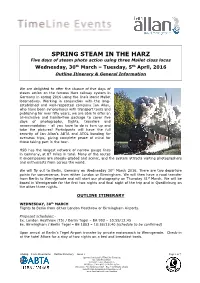
SPRING STEAM in the HARZ Five Days of Steam Photo Action Using Three Mallet Class Locos
SPRING STEAM IN THE HARZ Five days of steam photo action using three Mallet class locos Wednesday, 30th March – Tuesday, 5th April, 2016 Outline Itinerary & General Information We are delighted to offer the chance of five days of steam action on the famous Harz railway system in Germany in spring 2016 using the line’s iconic Mallet locomotives. Working in conjunction with the long- established and well-respected company Ian Allan, who have been synonymous with transport tours and publishing for over fifty years, we are able to offer an all-inclusive and hassle-free package to cover five days of photography, flights, transfers and accommodation - all you have to do is turn up and take the pictures! Participants will have the full security of Ian Allan’s ABTA and ATOL bonding for overseas trips, giving complete peace of mind for those taking part in the tour. HSB has the longest network of narrow gauge lines in Germany, at 87 miles in total. Many of the routes it encompasses are steeply-graded and scenic, and the system attracts visiting photographers and enthusiasts from across the world. We will fly out to Berlin, Germany on Wednesday 30th March 2016. There are two departure points for convenience, from either London or Birmingham. We will then have a road transfer from Berlin to Wernigerode and will start our photography on Thursday 31st March. We will be based in Wernigerode for the first two nights and final night of the trip and in Quedlinburg on the other three nights. OUTLINE ITINERARY WEDNESDAY, 30th MARCH Flights to Berlin from either London Heathrow or Birmingham Airports.