SIR-Mitteilungen Und Berichte Band 37/2019
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Continental Europe 2017/18 Europe Continental Travel Albatross We Do Work, the Hard So You Don’T Have To
Albatross Travel Albatross April 2017 to Continental March 2018 Europe INTRODUCTION Continental Europe 2017/18 We do the hard work, so you don’t have to... www.albatrosstravel.com Welcome to... our Continental Europe 2017/18 Brochure. For over 30 years, Albatross Travel has taken enormous pride in the fact that we always put our Albie in Germany! customers’ needs first and foremost. We strive to provide you with excellent value for money, reliable hotel choices and itinerary packages and suggestions that are well researched, innovative and designed with your own customers in mind. Albie in France! Why book with us? Albie in Italy! • We provide you with a 24 hour • We go the extra mile - We have a Guaranteed Maximum number to give to your driver so that dedicated team devoted to you and Response Times: we can assist him/her if any problems we take the time to understand your arise during the tour. business and tailor our products to Responding to complaints 30mins your bespoke requirements. or problems while a tour is • We provide you with a free single underway room for the driver no matter • We Visit, Inspect and Grade every 1hr how many passengers are booked hotel in the brochure based on your Responding to requests for on your tour! customers’ needs. additional passengers on an existing tour • Reputation Counts - We have been • Marketing Support – For tours booked Requests for new quotations 2hrs awarded Coach Wholesaler of the with us, we can design flyers for you where we hold an allocation Year 7 times in the past 10 years and with your company logo and pricing for or where we do not need to we are active members of all key you to send to your customers! request space industry organisations including BAWTA, ETOA and the CTC. -

Live Dabei Beim Sommerliftln in Ski Amadé
Saison von 02.05.2019 bis 03.11.2019 Live dabei beim Sommerliftln in Ski amadé SNOW SPACE SALZBURG | WAGRAIN GRAFENBERG RAMSAU | RITTISBERG FLYLINE GENIESSEN SIE DEN ALMSOMMER MIT 14 LIFTUNTERSTÜTZUNG 13 13a Bekannt als „Österreichs größtes Skivergnügen“, beliebt 12a als familienfreundliche Region zum „Sommerliftln“ – so präsentiert sich Ski amadé seinen Gästen. Egal, ob Ihnen der Sinn nach Seilbahnwandern, Mountainbiken, 12 Sommerrodeln, Abenteuer erleben, Aussicht genießen oder zünftigem Einkehren steht – bei den Sommerbah- 22 ZAUCHENSEE | GAMSKOGELHÜTTE nen von Ski amadé sind Sie ganz sicher richtig! 3 Diesen Sommer sind wieder zahlreiche Bergbahnen aus allen fünf Urlaubsregionen mit ihren Attraktionen beim „Sommerliftln“ live dabei und Sie, Sie sollten das auch sein! 15 Immer „Live dabei“ über Facebook 11a www.facebook.com/skiamade Get inspired: Video Fans check out 11 www.youtube.com/skiamadetv 1a Follow us on Instagram 10 4 8 #skiamade FILZMOOS | PAPAGENO 1b 7 2 SO NAHELIEGEND... 4 16 Bischofshofen 6 SNOW SPACE SALZBURG | 19 FLACHAU STARJET 1 UND STARJET 2 5 17 9 Sportgastein 20 21 18 Salzburger Sportwelt Schladming-Dachstein Gastein Hochkönig Großarltal Sesselbahn Schladming-Dachstein Salzburger Sportwelt Großarltal Gastein Hochkönig Snow Space Salzburg in Flachau, Wagrain, St. Johann, Zauchensee, Flachauwinkl, Kleinarl, Radstadt, Altenmarkt, Filzmoos, Eben Autobahn Kabinenbahn +43 (0) 3687 / 23310 +43 (0) 6414 / 281 +43 (0) 6432 / 3393 +43 (0) 6584 / 20388 BAD GASTEIN | STUBNERKOGEL Bundesstraße +43 (0) 6457 / 2929 Eisenbahn Standseilbahn Flughafen Schleuse Pendelbahn Alle weiteren Infos zum Ski amadé Sommerliftln finden Sie unter www.skiamade.com IMPRESSUM: Medieninhaber: Ski amadé GmbH, 5550 Radstadt. Hersteller: Ennstal Druckerei und Verlag Ges.m.b.h., A-8962 Gröbming Design: Fredmansky GmbH, fredmansky.at, 4040 Linz. -

Gemeindenachrichten Forstau Dezember 2017 Informationen Aus Dem Gemeinde- Und Vereinsgeschehen 2017
An einen Haushalt! Österreichische Post AG / Entgelt bar bezahlt! Gemeindenachrichten Forstau Dezember 2017 Informationen aus dem Gemeinde- und Vereinsgeschehen 2017 Die Gemeindevertretung wünscht allen Forstauerinnen und Forstauern sowie allen Gästen frohe Weihnachten und ein gutes Neues Jahr! Liebe Forstauerinnen, liebe Forstauer, geschätzte Leser der Liebe Forstauerinnen, liebe Forstauer! Gemeindenachrichten! In den folgenden Seiten wird das Geschehen in unserem Ort Das alte Jahr ist bald Geschichte. Viele Ereignisse werden uns in auszugsweise von der Gemeinde und den Vereinen dargestellt. Erinnerung bleiben. Positive wie auch Negative. Es sind viele Aktivitäten, die das ganze Jahr organisiert und durch- geführt werden. Neben den erfreulichen und geselligen Veranstal- Vieles konnte 2017 gemeinsam durch die Gemeindevertretung tungen haben uns dieses Jahr die schweren Unwetter gezeigt, dass umgesetzt werden, einiges muss noch warten. unserer schönen Gegend durch solche Ereignisse großer Schaden zugefügt werden kann. Es ist uns bewusst geworden, mit welcher Ge- Wie auch im privaten Leben. Vieles ist geschehen, nicht alles ist so walt die Natur sich auch von der negativen Seite zeigen kann. Über die verlaufen, wie wir es uns vorgestellt haben. Manche von uns hatten Ursachen solcher Naturgefahren wird sehr viel diskutiert. Es gibt sicher ein gutes Jahr, manche schweren Zeiten hinter sich. Manche haben nicht nur einen Verursacher. Der Ruf nach einem sorgsamen Umgang einen lieben Menschen verloren. mit unserer Natur wird immer lauter. Obwohl wir gerne die Schuld bei Anderen suchen, trägt sicher jeder Einzelne eine große Verpflichtung Und gerade in diesen Zeiten ist es wichtig Mut zu machen, einander zu überlegen, ob man nicht auch als Einzelner einen Beitrag zur Scho- Beizustehen oder einfach nur Zeit zu schenken. -

M1928 1945–1950
M1928 RECORDS OF THE GERMAN EXTERNAL ASSETS BRANCH OF THE U.S. ALLIED COMMISSION FOR AUSTRIA (USACA) SECTION, 1945–1950 Matthew Olsen prepared the Introduction and arranged these records for microfilming. National Archives and Records Administration Washington, DC 2003 INTRODUCTION On the 132 rolls of this microfilm publication, M1928, are reproduced reports on businesses with German affiliations and information on the organization and operations of the German External Assets Branch of the United States Element, Allied Commission for Austria (USACA) Section, 1945–1950. These records are part of the Records of United States Occupation Headquarters, World War II, Record Group (RG) 260. Background The U.S. Allied Commission for Austria (USACA) Section was responsible for civil affairs and military government administration in the American section (U.S. Zone) of occupied Austria, including the U.S. sector of Vienna. USACA Section constituted the U.S. Element of the Allied Commission for Austria. The four-power occupation administration was established by a U.S., British, French, and Soviet agreement signed July 4, 1945. It was organized concurrently with the establishment of Headquarters, United States Forces Austria (HQ USFA) on July 5, 1945, as a component of the U.S. Forces, European Theater (USFET). The single position of USFA Commanding General and U.S. High Commissioner for Austria was held by Gen. Mark Clark from July 5, 1945, to May 16, 1947, and by Lt. Gen. Geoffrey Keyes from May 17, 1947, to September 19, 1950. USACA Section was abolished following transfer of the U.S. occupation government from military to civilian authority. -

About Route Registration Accreditation in Radstadt How To
About The Amadé Radmarathon is a well-known cycling event for more than 20 years. The beautiful valley basin around Radstadt, a fantastic moutain panorama of Dachstein, Bischofsmütze and Tauern, cheering spectators along the route and a great supporting program make this race unforgettable. Route To meet everyone's expectations, there are two routes to choose from - a short and a long one. The short one (96 km, 1.535 m.o.a.): Radstadt - Pichl - Ramsau - Filzmoos - Eben - Niedernfritz - Hüttau - Bischofshofen - St. Johann - Wagrain - Reitdorf/ Flachau - Radstadt The long one (147 km, 2.221 m.o.a.) : Radstadt - Pichl - Ramsau - Filzmoos - Eben - Niedernfritz - St. Martin - Annaberg - Abtenau - Golling - Bischofshofen - St. Joann - Wagrain - Reitdorf/ Flachau Radstadt Registration Registration starts on December 16th, 2014 at 12 pm CET Mai 16th, 2015, 2 pm - 7pm Accreditation th in Radstadt Mai 17 , 2015, 5:30 am - 7 pm How to • Follow the button “Anmeldung/ Registration” and record your personal register entries. • Complete your registration by paying the entry fee. • You can register several persons at once. • Your registration is confirmed, when the full entre fee is received by us. • You will get an automatic e-mail confirming your registration after the payment has been completed. • By making the payment, you accept the participation conditions. Prices for Price from14.02.2015 Price from 15.02.2015 Price from 11.05.2015 both 49,- € p.P. 59,- € p.P. 69,- € p.P. distances • Chip time keeping, rental fee • Route plan and further Benefits -

Ein Auszug Tipps Für Interessante & Erholsame Zwischens
Kurort Mariapfarr - dem sonnenreichsten Ort Österreichs. Von Mariapfarr gelangt Entlang 01 Mitterbergrunde, 02 Schwarzenbergrunde & 46 Pochwerk & Hochofen Kendlbruck Entlang 10 Route Lessach Genussradeln im Salzburger Lungau man über das Stockerfeld zur Taurach und entlang der Taurachbahn zurück nach Besonderheiten entlang des Murradweges Direkt neben der Bundesstraße ist das „Pochwerk“. Das vorher geröstete Silbererz St. Andrä. 03 Murradweg Der Salzburger Lungau - ein sonnenreiches Höhenbecken auf über 1.000 m Seehöhe - wurde in diesen Anlagen gepocht (zerkleinert) bis auf Haselnussgröße oder sogar noch 59 Burgruine Thurnschall Kulturradweg - Das Brauchtumsjahr in Unternberg ist ein Eldorado für alle Genussradfahrer. 10 feiner. Die Anlage war bis 1782 in Betrieb. Route Lessach UNTERNBERG Etwa um 1200 gegründet - wird die Burg und das gesamte Gebiet Lessach 1242 Auf den Rastplätzen entlang des Murradweges, der Mitterbergrunde und der Die Schwierigkeitsstufen der einzelnen Strecken sind wie folgt markiert: Der Hochofen: Die Schmelzanlage besteht aus einem Floßofen und zwei Feuern in einer ca. 28 km, ca. 250 Hm, max. 7% Steigung, Ausgangspunkt Tamsweg 33 Naherholungsgebiet Unternberg an den Salzburger Erzbischof verkauft. Bei archäologischen Grabungen im Jahr Schwarzenbergroute durch Unternberg hat die Landjugendgruppe mit Skulptu- leicht mittel schwer 19 m hohen, kaminartigen Esse. ren und Figuren aus Holz, Metall und anderen natürlichen Stoffen das örtliche • • • Von Tamsweg geht’s entlang der Mitterbergrunde nach Wölting, weiter entlang des 2001 wurden die ca. 8 m hohen Reste des Wehrturms, sowie bis zu 4 m dicke Direkt am flachen Murufer zwischen den Ortsteilen Illmitzen und Neggerndorf laden Kann jederzeit besichtigt werden, Sonderführungen auf Anfrage. Brauchtum dargestellt. Auf Informationstafeln werden alle dargestellten Bräuche Lessachbaches, vorbei an alten Bauernhäusern erreicht man das schöne Dorf Umfassungsmauern freigelegt. -

Zeitung A4 4C 3-10 29.03.2010 9:38 Uhr Seite 1 Zeitung A4 4C 3-10 29.03.2010 9:38 Uhr Seite 2
Zeitung A4 4c 3-10 29.03.2010 9:38 Uhr Seite 1 Zeitung A4 4c 3-10 29.03.2010 9:38 Uhr Seite 2 Liebe Altenmarkterinnen - liebe Altenmarkter! Geschätzte Gäste! Das Osterwochenende liegt wieder vor uns, eine Wintersaison neigt sich ihrem En- de zu. Trotz des nicht gerade einfachen wirtschaftlichen Umfeldes können wir in Summe auch mit der vergangenen Saison nicht unzufrieden sein. Wenn wir auch einige Prozentpunkte minus bei den Nächtigungen ausweisen werden, so ist in die- sem Zusammenhang doch festzuhalten, dass wir von einem sehr hohen Niveau aus- gehen und die vorhergegangene Wintersaison 2008/09 die absolute Rekordsai- son im Wintertourismus in unserer Region war. Das heurige Nächtigungsergebnis wird sich wieder auf das Niveau der vorhergehenden Jahre einpendeln und ist durchaus nicht als schlecht zu bezeichnen. Hoffen wir, dass sich die Wirtschafts- lage doch bald wieder stabilisiert und wir auch in Zukunft mit einem Wachstum im Tourismus rechnen können. In den letzten Tagen und Wochen hatten wir ein großes Gesprächsthema in unse- rem Ort und darüber hinaus. Die Salzburger Medien haben darüber berichtet. Ich wurde persönlich oft darauf angesprochen und gefragt, warum der Bürgermeister oder die Gemeinde keine offizielle Stellungnahme dazu abgibt und ihre Bürger in- formiert. Dazu ist grundsätzlich festzuhalten, dass der Bürgermeister, die Mitglie- der der Gemeindevertretung sowie die Mitarbeiter des Gemeindeamtes der Amts- verschwiegenheit unterliegen. Ein Verstoß dagegen ist ein strafbares Delikt und wür- de bei einer Anzeige zu einer Verurteilung führen. Wenn man also davon ausgeht, dass gegen den Amtsleiter der Marktgemeinde Altenmarkt eine anonyme Anzeige erstattet wurde, so wäre es durchaus möglich, dass dies auch gegen den oben be- schriebenen Personenkreis wegen Vergehens gegen die Amtsverschwiegenheit ge- macht würde. -

Landescup 1951-59
Landescup 1951-59: 1951/1952/1953 Landescup Flachgau: 1. Runde: 01.07.1951 ÖTSU Seekirchen 3 : 0 SK Kasern-Salzburg 01.07.1951 ÖTSU Henndorf freilos 01.07.1951 ÖTSU Thalgau 4 : 1 USV Lamprechtshausen 01.07.1951 USK Grödig freilos 01.07.1951 USK Anif 3 : 7 1.Oberndorfer SK 1920 01.07.1951 SV Straßwalchen freilos 01.07.1951 ASV Grödig 0 : 3 * USC Mattsee 01.07.1951 TSV Neumarkt freilos * Strafverifizierung (Mannschaft nicht angetreten) 2. Runde: 08.07.1951 ÖTSU Seekirchen 4 : 1 ÖTSU Henndorf 08.07.1951 ÖTSU Thalgau 0 : 3 * USK Grödig 08.07.1951 1.Oberndorfer SK 1920 3 : 0 * SV Straßwalchen 22.07.1951 USC Mattsee 2 : 9 TSV Neumarkt * Strafverifizierung (Mannschaft nicht angetreten) 3. Runde: 13.07.1952 ÖTSU Seekirchen 4 : 3 n.V.** USK Grödig 13.07.1952 1.Oberndorfer SK 1920 3 : 0 * TSV Neumarkt * Strafverifizierung (Mannschaft nicht angetreten) ** Strafverifizierung 0:3 (ÖTSU Seekirchen hat einen nicht-berechtigten Spieler eingesetzt) Finale: 03.08.1952 USK Grödig 2 : 1 1.Oberndorfer SK 1920 Lungau: Vorrunde: 13.07.1952 USK Tamsweg 11 : 0 USC Ramingstein Semifinale: 20.07.1952 USK Tamsweg 0 : 3 USC Mauterndorf 20.07.1952 USK St. Michael im Lungau 1 : 5 WSV Predlitz Finale: 27.07.1952 USC Mauterndorf 5 : 2 WSV Predlitz Pongau: 1. Runde: 13.07.1952 SV Schwarzach im Pongau 3 : 0 * TSG Radstadt 13.07.1952 TSV St. Johann im Pongau freilos 13.07.1952 SV Konkordiahütte Tenneck 9 : 1 FC Badgastein 13.07.1952 SC Bad Hofgastein freilos * Strafverifizierung (Mannschaft nicht angetreten) Semifinale: 20.07.1952 SV Schwarzach im Pongau 12 : 2 TSV St. -
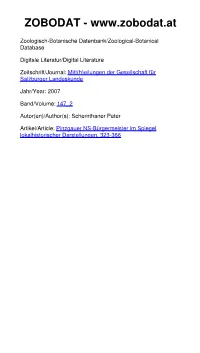
Pinzgauer NS-Bürgermeister Im Spiegel Lokalhistorischer Darstellungen
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Mitt(h)eilungen der Gesellschaft für Salzburger Landeskunde Jahr/Year: 2007 Band/Volume: 147_2 Autor(en)/Author(s): Schernthaner Peter Artikel/Article: Pinzgauer NS-Bürgermeister im Spiegel lokalhistorischer Darstellungen. 323-366 © Gesellschaft für Salzburger Landeskunde, Salzburg, Austria; download unter www.zobodat.at 323 Pinzgauer NS-Bürgermeister im Spiegel lokalhistorischer Darstellungen Von Peter Schernthaner E in leitung Unter der Herrschaft des Nationalsozialismus wurden furchtbare Ver brechen verübt. Am Ende standen Verwüstung, Elend und der gewaltsame Tod von vielen Millionen. Die 1945 wiedererstandene Republik Österreich schlüpfte von Anfang an in eine Opferrolle. Österreich betrachtete sich als ein Land im Stande der politischen Unschuld. Befreit von einer Unter drückung, der es sich entschieden widersetzt hatte und fest entschlossen, mit der vollen Schärfe der Gesetze gegen die wirklich Schuldigen vorzugehenx. Bereits am 7. Juni 1945 trat — zunächst nur für den Bereich der sowjetischen Besatzungsmacht — das Verbotsgesetz 19452 in Kraft. Dieses verfügte die Auflösung der NSDAP und aller ihrer Gliederungen und untersagte jede Neubildung. Zuwiderhandlungen waren mit strengsten Strafen, bis hin zur Todesstrafe, bedroht. Es verfügte eine Registrierungspflicht für alle Mitglie der der NSDAP oder deren Gliederungen. Wer zwischen dem 1. Juli 1933 und dem 13. März 1938 der NSDAP angehört hatte, galt ohne weiteres Ver fahren als des Hochverrates schuldig, doch wurde die Verfolgung wegen die ses Tatbestandes ausgesetzt. Kurz darauf folgte das Kriegsverbrechergesetz3, dessen § 1 allein die Ausübung bestimmter Funktionen im NS-Staat (z. B. Mitglieder der Reichsregierung, Gauleiter, SS-Führer vom Standartenführer aufwärts u. dgl.) für eine Bestrafung qualifizierte. -

Erlebnis-Planer
: 2017 DE | EN Hallo Freunde! Tennengauer AlmKasereien Tennengauer GenussFreunde Kommt mit auf die .. Cleverix DACHSTEIN Cheese Dairies Associates of Tennengau delights lå abenteuerliche I TOP TOP 2995 m Entdeckungsreise! Ratsel-Tour 1 POSTALM PANORAMASTRASSE ABTENAU Erlebnis-PlanerADVENTURE GUIDE POSTALM PANORAMIC ROAD ABTENAU Die sechs Tennengauer Almkäse Produzenten stellen seit Generationen Vom Edelbrand, über Bier und Säfte, bis hin zu süßen Leckereien und speziel- www.postalm.net • Tel.: +43 (0) 664/231 738 5 feine Köstlichkeiten – vom klassischen Kuhmilchkäse bis zum Ziegenkäse len Kulinarik-Betrieben, fi nden Sie im Tennengau weitere traditionelle Manu- – in verschiedenen frischen und gereiften Varianten, vorwiegend aus erst- fakturen und engagierte Familienbetriebe mit vielfältigen Angeboten. Inklusive Mach mit bei der Cleverix klassiger Bio-Heumilch her. Besuchen Sie die Hofl äden, machen Sie bei einer Tennengau TOP-Genuss & .. KARKOGEL ABTENAU From the fi nest liquor to beer and juices, sweet treats and special culinary com- Kulinarik Tipps! I 2 Ratsel-Tour durch den Tennengau! THE KARKOGEL MOUNTAIN ABTENAU Käse-Verkostung mit Diplom-Käsesommelier mit, oder produzieren Sie ein- fach Ihren eigenen Tennengauer Almkäse. panies you will fi nd many more traditional manufacturers and traditional and Including TOP www.karkogel.com • Tel.: +43 (0) 62 43/24 32 gourmet & culinary Bei jedem Ausfl ugsziel erhältst Du Deine dedicated family operations with a wide variety of offers in the Tennengau. tips! Rätselkarte und fi ndest eine Cleverix-Figur mit einer Since generations the six Alpine cheese producers from the Tennengau make MARMORMUSEUM & WEG ADNET delightful delicacies - from the classic cow milk cheese to goat cheese - in va- Frage und einem Hinweis auf die mögliche Antwort. -

PDF-Dokument
Landesrecht Bundesland Salzburg Kurztitel Salzburger Feuerwehrverordnung Kundmachungsorgan LGBl. Nr. 97/1986 §/Artikel/Anlage § 19 Inkrafttretensdatum 01.01.1987 Text Abschnitte § 19 Im Land Salzburg bestehen folgende Abschnitte: 1. Stadt Salzburg; 2. im politischen Bezirk Hallein - Tennengau: Abschnitt 1: Adnet, Krispl, Oberalm, Puch bei Hallein, St. Koloman und Vigaun; Abschnitt 2: Abtenau, Annaberg im Lammertal, Golling an der Salzach, Kuchl, Rußbach am Paß Gschütt und Scheffau am Tennengebirge; Abschnitt 3: Hallein; 3. im politischen Bezirk Salzburg-Umgebung - Flachgau: Abschnitt 1: Anthering, Bergheim, Bürmoos, Dorfbeuern, Elixhausen, Göming, Hallwang, Lamprechtshausen, Nußdorf am Haunsberg, Oberndorf bei Salzburg und St. Georgen bei Salzburg; Abschnitt 2: Ebenau, Faistenau, Fuschl am See, Hintersee, Hof bei Salzburg, Koppl, Plainfeld, St. Gilgen, Strobl und Thalgau; Abschnitt 3: Berndorf bei Salzburg, Eugendorf, Henndorf am Wallersee, Köstendorf, Mattsee, Neumarkt am Wallersee, Obertrum am See, Schleedorf, Seeham, Seekirchen am Wallersee und Straßwalchen; Abschnitt 4: Anif, Elsbethen, Grödig, Großgmain und Wals-Siezenheim; 4. im politischen Bezirk St. Johann im Pongau - Pongau: Abschnitt 1: Altenmarkt im Pongau, Eben im Pongau, Filzmoos, Flachau, Forstau, Hüttau, Kleinarl, Radstadt, St. Martin am Tennengebirge, Untertauern und Wagrain; Abschnitt 2: Bischofshofen, Goldegg, Großarl, Hüttschlag, Mühlbach am Hochkönig, Pfarrwerfen, St. Johann im Pongau, St. Veit im Pongau, Schwarzach im Pongau, Werfen und Werfenweng; www.ris.bka.gv.at Seite 1 von 2 Landesrecht Salzburg Abschnitt 3: Badgastein, Bad Hofgastein, Dorfgastein; 5. im politischen Bezirk Tamsweg - Lungau: Abschnitt 1: Göriach, Lessach, Mariapfarr, Ramingstein, St. Andrä im Lungau, Tamsweg, Unternberg und Weißpriach; Abschnitt 2: Mauterndorf, Muhr, St. Margarethen im Lungau, St. Michael im Lungau, Thomatal, Tweng und Zederhaus; 6. im politischen Bezirk Zell am See - Pinzgau: Abschnitt 1: Leogang, Lofer, Maria Alm am Steinernen Meer, Saalfelden am Steinernen Meer, St. -

Salzburger Sportjahrbuch 2019/2020 Bogenschießen Medizinisches Qi Gong Yoga Mit Fr
Salzburger Sportjahrbuch 2019/2020 Bogenschießen Medizinisches Qi Gong Yoga mit Fr. Chalupsky Aikido nach Watanabe Sensei Tai Ji Quan (24er Peking Form) Yoga mit Fr. Peer Shotokan Karate Do nach Tai Ji Quan (48er Peking Form) Diverse Kurse des Sensei Kanazawa Schwert Tai Ji Landes Salzburg Stock Tai Ji Wu Dang Tai Ji Tai Ji Erwachsene am frühen Morgen: Fr 5.30 – 6.30; (USI) Mi 5.30 – 7.00 Uhr Tai Ji Erwachsene am späten Nachmittag: Mo 17.00Neu –ab 18.30 Herbst Uhr; 2018! (USI) Mi. 06.00 - 07.00 Uhr Medizinisches Qi Gong Erwachsene: Di 08.00 – 09.00 Uhr; (USI) Waffenformen des Tai Ji: Mo 18.30 Uhr – 19.30 Uhr; (USI) Yoga, Frau Peer: Di 18.15 – 19.45 Uhr, Mi. 09.15 – 10.45, Do. 18.45 – 20.15. Uhr; Diverse Kurse, Land Salzburg: Di 17.15 – 18.30 Uhr; Shotokan Karate Do ein Lebensweg für Kinder: Mo. 16.00 – 17.00 Uhr, Mi. 17.00 – 18.00 Uhr; Shotokan Karate Do – ein Lebensweg für Erwachsene: Mo. 20.00 – 21.30 Uhr; (USI) Akido nach Watanabe Sensei für Kinder und Jugendliche: Do. 16.00 – 17.00 Uhr; Do 17.30 – 18.30 Uhr Akido nach Watanabe Sensei für Erwachsene: Mi. 19.0019:00-20.30 – 20.30 Uhr, Fr. 08.00 – 09.00 Uhr; TextInhalt Kräftige Hilfe für den Sport nach Corona �������������������������������������� 8 Zitate in der Krise �������������������������������������������������������� 9 Hallen im Sommer geöffnet ������������������������������������������������ 10 Qualifiziert und in der Warteschleife ����������������������������������������� 11 Sportstätten sind auch ein Thema ������������������������������������������� 12 Stefan Kraft rettete