Alexandre Guilmant · Louis Vierne Ben Van Oosten · Introduction Et Allegro · Sonate Nr
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

ORGELSTUNDE Sonnabend 26.09.2020 15.30 Uhr · Großer Saal BEN VAN OOSTEN Orgel
ORGELSTUNDE Sonnabend 26.09.2020 15.30 Uhr · Großer Saal BEN VAN OOSTEN Orgel Louis Vierne zum 150. Geburtstag (am 8.10.2020) Louis Vierne (1870–1937) „Marche épiscopale“ – Improvisation, rekonstruiert von Maurice Duruflé „Aubade“ op. 55 Nr. 1 und „Hymne au soleil“ op. 53 Nr. 3 (aus „Pièces de Fantaisie“) „Stele pour un enfant défunt“ (aus „Triptyque“ op. 58) Sergej Rachmaninow (1873–1943) Prélude cis-Moll op. 3 Nr. 2, für Orgel übertragen von Louis Vierne Louis Vierne Sinfonie Nr. 2 e-Moll op. 20 ALLEGRO RISOLUTO MA NON TROPPO VIVO CHORAL. LARGO SCHERZO. QUASI PRESTO CANTABILE. LARGHETTO FINAL. MAESTOSO HINWEISE ZUR PANDEMIE Bitte beachten Sie die allgemeine Hygiene-, Husten- und Nies-Etikette. Beim Betreten des Konzerthauses bitte Mund- und Nasen-Bedeckung tragen, erst nach Einnahme des Sitzplatzes und Schließen der Saaltüren abnehmen sowie beim Verlassen des Platzes wieder anlegen. Bitte Mindestabstand von 1,5 Metern sowie die Wegführung beim Betreten und Verlassen im Haus beachten. Serviceleistungen wie Garderobendienst und Foyer- Gastronomie sind zur Zeit eingestellt. Mäntel und Jacken können über die gesperrten Plätze neben dem eigenen Sitzplatz gelegt werden. Die Entwertung der Parkservicemarken finden Sie in der Kutschendurchfahrt. Mobiltelefon ausgeschaltet? Vielen Dank! Cell phone turned off? Thank you! Wir machen darauf aufmerksam, dass Ton- und/oder Bildaufnahmen unserer Aufführungen durch jede Art elektronischer Geräte strikt untersagt sind. Zuwiderhandlungen sind nach dem Urheberrechtsgesetz strafbar. Louis Vierne zum 150. -

BEN VAN OOSTEN DUDELANGE MARDI 15.10 Ben Van Oosten Beschäftigte Sich Eingehend Mit Der Symphonischen Französischen Orgel- ÉGLISE SAINT-MARTIN 20H15 Musik
BEN VAN OOSTEN DUDELANGE MARDI 15.10 Ben van Oosten beschäftigte sich eingehend mit der symphonischen französischen Orgel- ÉGLISE SAINT-MARTIN 20H15 musik. Seine Gesamteinspielungen der Orgelwerke von César Franck, Camille Saint-Saëns, Alexandre Guilmant, Louis Vierne, Charles-Marie Widor und Marcel Dupré wurden mit mehreren internationalen Schallplattenpreisen ausgezeichnet (u.a. Echo Klassik, Preis der deutschen Schallplattenkritik, Choc du Monde de la Musique und Diapason d’Or). Wegen Récital d’orgue par seiner Verdienste um die französische Orgelkultur erhielt Ben van Oosten 1980, 1987 und 1998 ehrenvolle Auszeichnungen durch die Société Académique Arts, Sciences, Lettres in Paris. Die französische Regierung erhob ihn in den Rang des Chevalier (1998) und Officier Ben van Oosten (2011) dans l’Ordre des Arts et des Lettres. Im Jahre 2010 wurde er von der damaligen Königin der Niederlande, Königin Beatrix, zum Ritter in den Orden des Niederländischen Löwen LOUIS VIERNE (1870 – 1937) berufen. Aus “Trois Improvisations”: Gesamteinspielungen der Orgelwer- Marche épiscopale ke von César Franck, Camille Saint- (rekonstruiert von Maurice Duruflé) Saëns, Alexandre Guilmant, Louis Vierne, Charles-Marie Widor und Après le concert, Ben van Oosten sig- Marcel Dupré wurden mit mehreren nera son CD enregistré à Dudelange, CÉSAR FRANCK (1822 – 1890) internationalen Schallplattenpreisen publié en 2011 et couronné par un Prière op. 20 ausgezeichnet (u.a. Echo Klassik, « Diapason d’Or » Preis der deutschen Schallplattenkri- CHARLES-MARIE WIDOR (1844 – 1937) tik, Choc du Monde de la Musique und Diapason d’Or). Symphonie no 8 en si majeur, op. 42/4 (1887) Ausserdem ist er Autor der umfas- – Allegro risoluto senden Widor-Biographie „Charles- – Moderato cantabile Marie Widor – Vater der Orgelsym- – Allegro phonie“ (1997). -
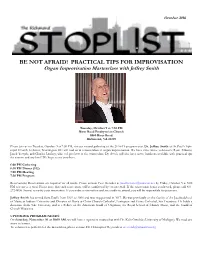
BE NOT AFRAID! PRACTICAL TIPS for IMPROVISATION Organ Improvisation Masterclass with Jeffrey Smith
2004 October 2018 BE NOT AFRAID! PRACTICAL TIPS FOR IMPROVISATION Organ Improvisation Masterclass with Jeffrey Smith Tuesday, October 9 at 7:30 PM River Road Presbyterian Church 8960 River Road Richmond, VA 23229 Please join us on Tuesday, October 9 at 7:30 PM, for our second gathering of the 2018-19 program year. Dr. Jeffrey Smith of St. Paul’s Epis- copal Church, K Street, Washington DC will lead us in a masterclass of organ improvisation. We have three brave volunteers: Ryan Tibbetts, Jacob Temple, and Charles Lindsey, who will perform in the masterclass. Dr. Smith will also have some handouts available with practical tips for anyone and any level! We hope to see you there. 6:00 PM Gathering 6:30 PM Dinner ($12) 7:00 PM Meeting 7:30 PM Program Reservations: Reservations are required for all meals. Please contact Paul Honaker at [email protected] by Friday, October 5 at 5:00 PM to reserve a meal. Please note that each reservation will be confirmed by return email. If the reservation is not confirmed, please call 804- 272-0036 (home) to verify your reservation. If you make a reservation and are unable to attend, you will be responsible for payment. Jeffrey Smith has served Saint Paul's from 1992 to 2004 and was reappointed in 2017. He was previously on the faculty of the Jacobs School of Music at Indiana University and Director of Music at Christ Church Cathedral, Lexington and Grace Cathedral, San Francisco. He holds a doctorate from Yale University and is a Fellow of the American Guild of Organists, the Royal School of Church Music, and the Guild of Church Musicians. -
FRAUENKIRCHE KREUZKIRCHE KULTURPALAST Tickets Willkommen
2020 FRAUENKIRCHE KREUZKIRCHE KULTURPALAST Tickets Willkommen Eintritt Liebe Freunde der Kreuzkirche 7,- € ermäßigt 5,- € Orgelmusik, Frauenkirche 8,- € Kulturpalast 10,- € ermäßigt 8,- € in diesem Jahr begrüßen wir Sie in etwas dezimierter Runde, geänderter Eintrittspreis bei folgendem Konzert: weil die Kathedrale und ihre Silbermannorgel wegen Bauar- 2. Dez. 2020 Kreuzkirche 10,- € ermäßigt 8,- € beiten nicht nutzbar sind. Dennoch bieten wir Ihnen wieder ein abwechslungsreiches und hochkarätiges Programm. In vielen Konzerten steht der große französische Romantiker und Impressionist Louis Vierne anlässlich des Jubiläums Ticketservice Frauenkirche Dresden seines 150. Geburtstags auf dem Programm, oftmals darge- Georg-Treu-Platz 3, 01067 Dresden boten von Kennern der französisch-sinfonischen Orgelkunst Montag bis Freitag 9 – 18 Uhr, Samstag 9 – 15 Uhr wie den heutigen Pariser Organisten Daniel Roth, Olivier Telefon- und Onlinebuchungen Latry, Ben van Oosten und anderen. Vor allem in den Inter- Telefon 0351/65606-701 | Telefax 0351/65606-108 nationalen Orgelfestwochen sind von Juni bis August Gäste [email protected] | www.frauenkirche-dresden.de aus dem europäischen Ausland und aus Übersee zu erleben, Abendkasse: Eingang D | jeweils 1 Stunde vor Konzertbeginn die oft einen programmatischen Akzent aus ihren Ländern mitbringen. Den festlichen Abschluss der Konzertsaison 2020 bildet wieder das traditionelle Weihnachtliche Orgelkon- Konzertkasse der Kreuzkirche Dresden zert in der Kreuzkirche, das dieses Mal in die Welt des 18. Jahrhunderts entführt und die Orgel im Zusammenspiel mit An der Kreuzkirche 6, 01067 Dresden Barockorchester erlebbar werden lässt. Vor den Konzerten in Montag bis Freitag 10 – 18 Uhr, Samstag 10 – 14 Uhr der Kreuzkirche sind die Künstler bei den Einführungsveran- Telefon 0351/439 39 39 | Telefax 0351/439 39 40 staltungen „Unter der Stehlampe“ hautnah zu erleben. -

Codarts Research Festival, That Will Take Place on Thursday 11 March 2021
Dear reader, A wholehearted welcome to the fifth edition of the Codarts Research Festival, that will take place on Thursday 11 March 2021. Due to the continuing covid-19 pandemic this will be an online event, with live streamed presentations in ZOOM 1, and online presentations in ZOOM 2. This year's edition has a distinct RASL*) -flavor, as the theme is ‘Social engagement and the Arts.’ As the ‘traditional’ jobs in the arts are under increased pressure, and our society is faced by seemingly insurmountable problems, like climate change and pollution, but also social disintegration and loneliness, many artists feel the need to reposition themselves and look for ways to contribute. The covid-19 pandemic has made these problems even more acute. The Research Festival will address these issues, with (inter)national speakers from the world of dance, music and theater, next to a variety of research presentations from Codarts students and staff. And you are invited to caste your vote for the audience award during the annual Master research competition. *) RASL is the Rotterdam Arts and Science Lab. An intense collaboration between Codarts Rotterdam, Arts & Culture Studies (EUR), Erasmus University College (EUR) and Willem de Kooning Academy, with the aim to examine the relationship between the arts and society in a transdisciplinary way. If you haven’t done so already, we kindly request you to register for the Festival using this link: https://codarts.zoom.us/meeting/register/tJIoc-ytpz0tGt2-wNg97GnMHAcBsoMGKw6A Upon registration you will receive a confirmation and the ZOOM link plus password that gives you access to the Festival on the day itself. -

! the Organ-388-May-Jul'19
Louis-James-Alfred Lefébure-Wély, lithograph 4 No 388 | THE ORGAN | SPRING 2019 Louis-James-Alfred Lefébure-Wély A sesquicentenary assessment Michał Szostak 2019 marks the 150th anniversary of the death of this greatly significant figure in the Cavaillé-Coll (1811-1899) and his instru - development of 19th-century French organ music. In this major article, Dr Szostak ments built in the spirit of symphonic considers a number of important factors in the life and work of this remarkable style. musician. Another important factor at this time was the enlargement of the Prologue said that new music – in the spirit of orchestra, an area enabling composers This year sees the 150th anniversary of developing Romanticism – began to to create larger and larger symphonic the death of an interesting and import - appear in French organ music in the works, where such factors as crescendi ant figure for the French organ and ’30s and ’40s of the 19th century. This and diminuendi played a more expressive organ music world of the 19th century, phenomenon was closely related to the and important role. Louis-James-Alfred Lefébure-Wély appearance in Paris in 1833 of Aristide It must also be remembered that (1817-1869). He was called by his con - temporaries the “prince of organists”, a “notability”, a ”dandy”, the “Auber of organ” and even – this is the very word of Alexandre Guilmant – ”the most significant, the greatest and timeless organist of France”. 1 Anniversaries are good opportunities to recall characters who – although forgotten today – played an important role in their field in their time. -

Ben Van Oosten PROGRAMM
Ben van Oosten Ben van Oosten wurde 1955 in Den PROGRAMM Haag, Niederlande, geboren. Er stu- dierte Orgel und Klavier am Sweelinck Freitag, 9. Juli 2021, 19.00 Uhr, Basilika St. Lorenz Konservatorium in Amsterdam und in Paris. Marcel Dupré : Cortège et Litanie op. 19 Zahlreiche Konzertreisen führten (1886-1971) aus: “Le Tombeau de Titelouze” op. 38 Ben van Oosten schon seit 1970 in die maßgebenden internationalen Orgel- - Te lucis ante terminum zentren, wo er als einer der bemer- - Iste Confessor kenswertesten Orgelvirtuosen unserer - Placare Christe servulis Zeit hervorgetreten ist. Neben seiner Konzerttätigkeit gibt Ben Camille Saint-Saëns: Bénédiction nuptial op. 9 van Oosten Meisterkurse in vielen (1835-1921) Ländern und ist er Professor für Orgel Prélude et Fugue Es-Dur op. 99/3 am Konservatorium in Rotterdam. aus: “Le Carnaval des Animaux”: Ben van Oosten beschäftigte sich eingehend mit der symphonischen französischen Le Cygne (Der Schwan) Orgelmusik. Seine Gesamteinspielungen der Orgelwerke von César Franck, Camille Transkription: Alexandre Guilmant) Saint-Saëns, Alexandre Guilmant, Louis Vierne, Charles-Marie Widor und Marcel Du- pré für MD&G wurden mit mehreren internationalen Schallplattenpreisen ausge- zeichnet (u.a. Echo Klassik, Preis der deutschen Schallplattenkritik, Choc du Monde de Marcel Dupré : Symphonie-Passion op. 23 (1924) la Musique und Diapason d’Or). Für seine Gesamteinspielung der Orgelwerke von Cé- sar Franck wurde ihm der Opus Klassik 2019 verliehen. I. Le Monde dans l’attente du Sauveur (Erwartung) II. Nativité (Geburt) Außerdem ist Ben van Oosten Autor der umfassenden Widor-Biographie „Charles- III. Crucifixion (Kreuzigung) Marie Widor – Vater der Orgelsymphonie” (1997). IV. Résurrection (Auferstehung) Wegen seiner Verdienste um die französische Orgelkultur erhielt Ben van Oosten 1980, 1987 und 1998 ehrenvolle Auszeichnungen durch die Société Académique Arts, Sciences, Lettres in Paris. -

Ful Music of Belgian Master Flor Peeters, in Th WIDOR: Adagio (5 Mvt), Fr Symphony No
th PROGRAM NO. 0327 7/7/2003 WIDOR: Scherzo (4 mvt), fr Symphony No. 4 – MILLER: Hymn-prelude, Great is thy faithfulness. Suzanne Chaisemartin (1871 Cavaillé-Coll/ PHILLIPS: Trumpet Tune –Stewart Scharch Flor Samples . an exploration of the resource- Sainte-Trinité, Paris) Motette CD-11131 (OHS) 1992 Swain & Kates/Walnut Creek Presbyterian ful music of Belgian master Flor Peeters, in th WIDOR: Adagio (5 mvt), fr Symphony No. 4 – Church, CA) SS Productions (510-930-6021) celebration of his centenary (b. 7/4/03). Patrice Caire (1985 Nicolle-Valentin-Meslé/ LISZT (arr. Robilliard): Orpheus (symphonic poem) FLOR PEETERS: Entrata Festiva, Op. 93 – Sanctuaire St. Bonaventure, Lyon) REM CD- –Louis Robilliard (1880 Cavaillé-Coll/St. Missouri Brass Quintet; John Obetz (1993 11010 (OHS) Francois-de-Sales, Lyon) Festivo CD-138 (OHS) th Casavant/Temple Church, Community of WIDOR: Finale (6 mvt), fr Symphony No. 4 – Christ, Independence, MO) RBW CD-08 Ben van Oosten (1880 Cavaillé-Coll/Saint- Program originally issued as #9706 in February ’9 7. (www.rbw.net) François-de-Sales, Lyon) Dabringhaus & PEETERS: Suite Modale, Op. 43 (Scherzo, Grimm CD-3402 (OHS) PROGRAM NO. 0330 7/28/2003 st Adagio, Toccata) –Peter Hurford (1978 Rieger/ LOUIS VIERNE: Prelude (1 mvt), fr Sym- The Art of the Theatre Organ . an auditory Ratzeburg Cathedral) London CD 421 296 (nla) phony No. 4 in g, Op. 32 (1914) –Christine overview of "popular pipe organ" styles, with PEETERS: O Maria die daar staat –Cristel de Kamp (1882 Cavaillé-Coll/St. Sernin Basilica, of Stephen Adams, representing the American Meulder, s; Jan van Mol (1880 Cavaillé-Coll/ Toulouse) Festivo CD-6941762 (OHS) nd Theatre Organ Society. -

Organ Music by Carson Cooman
Invocazione brillante: Organ Music by Carson Cooman 1 Musica da processione, Op. 1305 (2018) 3:24 2 Arioso, Op. 1040 (2013) 3:23 Cortège, Intermezzo, and Litany on the Joseph-Hymnus, Op. 1241 (2017) 9:28 3 I Cortège 3:52 4 II Intermezzo 2:59 5 III Litany 2:35 6 Romanza, Op. 186 (2000) 3:44 7 Praeludium in festo S. Philippi apostoli, Op. 1243 (2017) 4:47 Diptych for New Life, Op. 1205 (2017) 6:19 8 I. Aubade: “…frate Sole, lo qual è iorno…” 3:31 9 II Toccata: “Ellu à bellu e radiante cum grande splendore!" 2:47 10 Arioso cantabile, Op. 1301 (2018) 5:06 Suite in F, Op. 1246 (2017) 10:50 11 I Praeambulum 3:29 12 II Ground 3:19 13 III Fantasia 4:01 14 Prelude on "Das ist köstlich” (Psalm 92), Op. 1271 (2018) 2:30 15 Invocazione brillante, Op. 1217 (2017) 3:25 Two Nantucket Sketches, Op. 1298 (2018) 4:16 16 I Idyll 2:34 17 II Danza rustica 1:41 18 Lullaby, Op. 1303 (2018) 3:38 Sonatina No. 4, Op. 1234 (2019) 9:28 19 I Hamburg March 2:49 20 II Pößneck Aria 3:21 21 III Ulm Toccata-Fanfare 3:16 Total duration 70:22 Philip Hartmann, organ of Pauluskirche, Ulm The Music notes by the composer Musica da processione (2018; op. 1305) was composed for the wedding ceremony of Franziska (Hartmann) and Patrick Hahn, August 31, 2019, in the Pauluskirche in Ulm, Germany. It was played by the bride’s father, Philip Hartmann. -

September 2009 Nl
The Organizer September 2009 A G O Monthly Newsletter The Atlanta Chapter L O G O AMERICAN GUILD of ORGANISTS The OrganizerSEPTEMBER 2009 _________________________________________________________________________________________________________________ Atlanta ATLANTA CHAPTER AGO Chapter Officers PRESENTS Dean James Mellichamp Ben van Oosten organist Sub-Dean Jeff Harbin at Secretary THE CATHEDRAL OF CHRIST THE KING Betty Williford 2699 Peachtree Road NE Treasurer Atlanta, Georgia 30305 Charlene Ponder 404.267.3685 Registrar Hosts: Timothy Wissler & Ham Smith Tom Wigley Newsletter Editor TUESDAY, SEPTEMBER 8, 2009 Charles Redmon Punchbowl: 6:00 pm Chaplain Dinner & Meeting: 6:30 pm Recital: 8:00 pm Rev. Dr. John Beyers _________________________________________________________________________ Auditor The cost for this season’s dinners is $13 David Ritter DEADLINE FOR RESERVATIONS WILL BE THURSDAY, SEPTEMBER 3, 2009 Web Master Jeremy Rush Ben van Oosten (born 1955) in the Hague, Netherlands is an organist, professor and author. He gave his first organ recital in 1970 at the age of 15 and was soon Executive thereafter accepted at the prestigious Sweelinck Conservatory in Amsterdam where Committee he studied organ with Albert de Klerk and piano with Berthe Davelaar. Van Oosten Joyce Johnson ‘10 graduated cum laude in 1979 with a diploma in organ solo. Tim Young ‘10 Jeff Daniel ‘11 He completed advanced studies in Paris, France with André Isoir and Daniel Roth Jeremy Rush ‘11 Whether by geographical influence or artistic choice, he gravitated toward the French Madonna Brownlee ‘12 Romantic Organ school of the 19th Century that had its origins in the new John Sabine ‘12 Symphonic organs of Aristide Cavaillé-Coll. Van Oosten subsequently became one of the greatest practitioners and interpreters of organ works from that era. -

Possibilities for September 19, 2007
TTHHEE VVIIEERRNNEE PPRROOJJEECCTT Church of St. Ann, Washington, DC September 25, 2020, 7:30 p.m. Eric Plutz, Organist ~ Program ~ Symphony No. 5 of Louis Victor Jules Vierne (Born in Poitiers, October 8, 1870 – Died in Paris, June 2, 1937) VIERNE’S LIFE From the beginning, Louis Vierne’s life seemed to be marked by misfortune. He began study with a beloved uncle, who died when Vierne was just eleven years old. Then, at fifteen, his father’s health declined, and within the year, he also died. Vierne had begun private study with César Franck, whom he revered, before being accepted into his studio at the Paris Conservatoire in 1890. Once there, however, he enjoyed just a few classes with him before Franck died. Deeply shaken once again, Vierne persevered and studied with Charles-Marie Widor, who replaced Franck as Organ Professor. Despite his near-total blindness Vierne often navigated Paris unassisted. One night in 1906, he stepped into a hole in the street that had become filled with water, severely injuring his leg, which, in turn, required him to relearn how to play the pedals of the organ. The discovery of his wife’s adultery with a supposed friend (Charles Mutin, the dedicatee of his Second Symphony) led to a divorce in 1909, the same year his youngest son contracted tuberculosis (from which he died four years later at the age of ten). The year 1911 brought many deaths to those in Vierne’s inner circle: both his mother and his mentor, colleague and friend, composer/organist Alexandre Guilmant succumbed to kidney failure and during the early years of World War I, both his brother Réné and his seventeen year-old son Jacques died in combat. -

PIPEDREAMS Programs, September 2021 Summer Quarter
PIPEDREAMS Programs, September 2021 Summer Quarter: The following listings detail complete contents for September 2021 Summer Quarter broadcasts of PIPEDREAMS. The first section includes complete program contents, with repertoire, artist, and recording information. Following that is program information in "short form". For more information, contact your American Public Media station relations representative at 651-290-1225/877- 276-8400 or the PIPEDREAMS Office (651-290-1539), Michael Barone <[email protected]>). For last-minute program changes, watch DACS feeds from APM and check listing details on our PIPEDREAMS website: http://www.pipedreams.org AN IMPORTANT NOTE: It would be prudent to keep a copy of this material on hand, so that you, at the local station level, can field listener queries concerning details of individual program contents. That also keeps YOU in contact with your listeners, and minimizes the traffic at my end. However, whenever in doubt, forward calls to me (Barone). * * * * * * PIPEDREAMS Program No. 2136 (distribution on 9/6/2021) Some Lost Chords Found . rummaging amongst the many overlooked delights in the organ’s expansive repertoire. [Hour 1] NICHOLAS CHOVEAUX: Introduction & Toccata (Last tuns erfreuen) –Peter Crompton (1933 Hill, Norman & Beard/Royal Hospital School, Holbrook, England) Priory 6002 GIOVANNI PESCETTI: Sonata No. 2 in D –Paolo Bottini (1750 Nacchini/San Giorgio Maggiore, Venice, Italy) Brilliant Claassics 95438 EDWARD ELGAR (trans. Lemare): Sursum Corda, Op. 11 ==David Humphreys (1894 Hill-1981