Ferrantia 70 (2014) Verbreitungsatlas Der Weberknechte Des
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
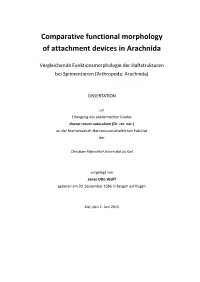
Comparative Functional Morphology of Attachment Devices in Arachnida
Comparative functional morphology of attachment devices in Arachnida Vergleichende Funktionsmorphologie der Haftstrukturen bei Spinnentieren (Arthropoda: Arachnida) DISSERTATION zur Erlangung des akademischen Grades doctor rerum naturalium (Dr. rer. nat.) an der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel vorgelegt von Jonas Otto Wolff geboren am 20. September 1986 in Bergen auf Rügen Kiel, den 2. Juni 2015 Erster Gutachter: Prof. Stanislav N. Gorb _ Zweiter Gutachter: Dr. Dirk Brandis _ Tag der mündlichen Prüfung: 17. Juli 2015 _ Zum Druck genehmigt: 17. Juli 2015 _ gez. Prof. Dr. Wolfgang J. Duschl, Dekan Acknowledgements I owe Prof. Stanislav Gorb a great debt of gratitude. He taught me all skills to get a researcher and gave me all freedom to follow my ideas. I am very thankful for the opportunity to work in an active, fruitful and friendly research environment, with an interdisciplinary team and excellent laboratory equipment. I like to express my gratitude to Esther Appel, Joachim Oesert and Dr. Jan Michels for their kind and enthusiastic support on microscopy techniques. I thank Dr. Thomas Kleinteich and Dr. Jana Willkommen for their guidance on the µCt. For the fruitful discussions and numerous information on physical questions I like to thank Dr. Lars Heepe. I thank Dr. Clemens Schaber for his collaboration and great ideas on how to measure the adhesive forces of the tiny glue droplets of harvestmen. I thank Angela Veenendaal and Bettina Sattler for their kind help on administration issues. Especially I thank my students Ingo Grawe, Fabienne Frost, Marina Wirth and André Karstedt for their commitment and input of ideas. -
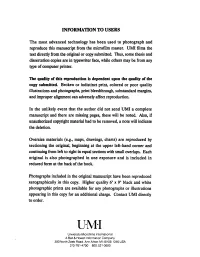
Information to Users
INFORMATION TO USERS The most advanced technology has been used to photograph and reproduce this manuscript from the microfilm master. UMI films the text directly from the original or copy submitted. Thus, some thesis and dissertation copies are in typewriter face, while others may be from any type of computer printer. The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. Broken or indistinct print, colored or poor quality illustrations and photographs, print bleedthrough, substandard margins, and improper alignment can adversely affect reproduction. In the unlikely event that the author did not send UMI a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if unauthorized copyright material had to be removed, a note will indicate the deletion. Oversize materials (e.g., maps, drawings, charts) are reproduced by sectioning the original, beginning at the upper left-hand corner and continuing from left to right in equal sections with small overlaps. Each original is also photographed in one exposure and is included in reduced form at the back of the book. Photographs included in the original manuscript have been reproduced xerographically in this copy. Higher quality 6" x 9" black and white photographic prints are available for any photographs or illustrations appearing in this copy for an additional charge. Contact UMI directly to order. University Microfilms International A Bell & Howell Information Company 300 North Zeeb Road. Ann Arbor, Ml 48106-1346 USA 313/761-4700 800/521-0600 Order Number 9111799 Evolutionary morphology of the locomotor apparatus in Arachnida Shultz, Jeffrey Walden, Ph.D. -

Harvest-Spiders 515
PROVISIONAL ATLAS OF THE REF HARVEST-SPIDERS 515. 41.3 (ARACHNIDA:OPILIONES) OF THE BRITISH ISLES J H P SANKEY art å • r yz( I is -..a .e_I • UI II I AL _ A L _ • cta • • .. az . • 4fe a stir- • BIOLOGICAL RECORDS CENTRE Natural Environment Research Council Printed in Great Britain by Henry Ling Ltd at the Dorset Press, Dorchester, Dorset ONERC Copyright 1988 Published in 1988 by Institute of Terrestrial Ecålogy Merlewood Research Station GRANGE-OVER-SANDS Cumbria LA1/ 6JU ISBN 1 870393 10 4 The institute of Terrestrial Ecology (ITE) was established in 1973, from the former Nature Conservancy's research stations and staff, joined later by the Institute of Tree Biology and the Culture Centre of Algae and Protozoa. ITO contribbtes to, and draws upon, the collective knowledge of the 14 sister institutes which make up the Natural Environment Research Council, spanning all the environmental sciences. The Institute studies the factors determining the structure, composition and processes of land and freshwater systems, and of individual plant and animal species. It is developing a sounder scientific basis for predicting and modelling environmental trends arising from natural or man-made change. The results of this research are available to those responsible for the protection, management and wise use of our natural resources. One quarter of ITE's work is research commissioned by customers, such as the Department of Environment, the European Economic Community, the Nature Conservancy Council and the Overseas Development Administration. The remainder is fundamental research supported by NERC. ITE's expertise is widely used by international organizations In overseas projects and programmes of research. -

De Hooiwagens 1St Revision14
Table of Contents INTRODUCTION ............................................................................................................................................................ 2 CHARACTERISTICS OF HARVESTMEN ............................................................................................................................ 2 GROUPS SIMILAR TO HARVESTMEN ............................................................................................................................. 3 PREVIOUS PUBLICATIONS ............................................................................................................................................. 3 BIOLOGY ......................................................................................................................................................................... 3 LIFE CYCLE ..................................................................................................................................................................... 3 MATING AND EGG-LAYING ........................................................................................................................................... 4 FOOD ............................................................................................................................................................................. 4 DEFENCE ........................................................................................................................................................................ 4 PHORESY, -

Arachnida, Solifugae) with Special Focus on Functional Analyses and Phylogenetic Interpretations
HISTOLOGY AND ULTRASTRUCTURE OF SOLIFUGES Comparative studies of organ systems of solifuges (Arachnida, Solifugae) with special focus on functional analyses and phylogenetic interpretations HISTOLOGIE UND ULTRASTRUKTUR DER SOLIFUGEN Vergleichende Studien an Organsystemen der Solifugen (Arachnida, Solifugae) mit Schwerpunkt auf funktionellen Analysen und phylogenetischen Interpretationen I N A U G U R A L D I S S E R T A T I O N zur Erlangung des akademischen Grades doctor rerum naturalium (Dr. rer. nat.) an der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald vorgelegt von Anja Elisabeth Klann geboren am 28.November 1976 in Bremen Greifswald, den 04.06.2009 Dekan ........................................................................................................Prof. Dr. Klaus Fesser Prof. Dr. Dr. h.c. Gerd Alberti Erster Gutachter .......................................................................................... Zweiter Gutachter ........................................................................................Prof. Dr. Romano Dallai Tag der Promotion ........................................................................................15.09.2009 Content Summary ..........................................................................................1 Zusammenfassung ..........................................................................5 Acknowledgments ..........................................................................9 1. Introduction ............................................................................ -

Westring, 1871) (Schorsmuisspin) JANSSEN & CREVECOEUR (2008) Citeerden Deze Soort Voor Het Eerst in België
Nieuwsbr. Belg. Arachnol. Ver. (2009),24(1-3): 1 Jean-Pierre Maelfait 1 juni 1951 – 6 februari 2009 Nieuwsbr. Belg. Arachnol. Ver. (2009),24(1-3): 2 In memoriam JEAN-PIERRE MAELFAIT Kortrijk 01/06/1951 Gent 06/02/2009 Jean-Pierre Maelfait is ons ontvallen op 6 februari van dit jaar. We brengen hulde aan een man die veel gegeven heeft voor de arachnologie in het algemeen en meer specifiek voor onze vereniging. Jean-Pierre is altijd een belangrijke pion geweest in het bestaan van ARABEL. Hij was medestichter van de “Werkgroep ARABEL” in 1976 en op zijn aanraden werd gestart met het publiceren van de “Nieuwsbrief” in 1986, het jaar waarin ook ARABEL een officiële vzw werd. Hij is eindredacteur van de “Nieuwsbrief” geweest van 1990 tot en met 2002. Sinds het ontstaan van onze vereniging is Jean-Pierre achtereenvolgens penningmeester geweest van 1986 tot en met 1989, ondervoorzitter van 1990 tot en met 1995 om uiteindelijk voorzitter te worden van 1996 tot en met 1999. Pas in 2003 gaf hij zijn fakkel als bestuurslid over aan de “jeugd”. Dit afscheid is des te erger omdat Jean- Pierre er na 6 jaar afwezigheid terug een lap ging op geven, door opnieuw bestuurslid te worden in 2009 en aldus verkozen werd als Secretaris. Alle artikels in dit nummer opgenomen worden naar hem opgedragen. Jean-Pierre Maelfait nous a quitté le 6 février de cette année. Nous rendons hommage à un homme qui a beaucoup donné dans sa vie pour l’arachnologie en général et plus particulièrement pour Arabel. Jean-Pierre a toujours été un pion important dans la vie de notre Société. -

Anatomically Modern Carboniferous Harvestmen Demonstrate Early Cladogenesis and Stasis in Opiliones
ARTICLE Received 14 Feb 2011 | Accepted 27 Jul 2011 | Published 23 Aug 2011 DOI: 10.1038/ncomms1458 Anatomically modern Carboniferous harvestmen demonstrate early cladogenesis and stasis in Opiliones Russell J. Garwood1, Jason A. Dunlop2, Gonzalo Giribet3 & Mark D. Sutton1 Harvestmen, the third most-diverse arachnid order, are an ancient group found on all continental landmasses, except Antarctica. However, a terrestrial mode of life and leathery, poorly mineralized exoskeleton makes preservation unlikely, and their fossil record is limited. The few Palaeozoic species discovered to date appear surprisingly modern, but are too poorly preserved to allow unequivocal taxonomic placement. Here, we use high-resolution X-ray micro-tomography to describe two new harvestmen from the Carboniferous (~305 Myr) of France. The resulting computer models allow the first phylogenetic analysis of any Palaeozoic Opiliones, explicitly resolving both specimens as members of different extant lineages, and providing corroboration for molecular estimates of an early Palaeozoic radiation within the order. Furthermore, remarkable similarities between these fossils and extant harvestmen implies extensive morphological stasis in the order. Compared with other arachnids—and terrestrial arthropods generally—harvestmen are amongst the first groups to evolve fully modern body plans. 1 Department of Earth Science and Engineering, Imperial College, London SW7 2AZ, UK. 2 Museum für Naturkunde at the Humboldt University Berlin, D-10115 Berlin, Germany. 3 Department of Organismic and Evolutionary Biology and Museum of Comparative Zoology, Harvard University, Cambridge, Massachusetts 02138, USA. Correspondence and requests for materials should be addressed to R.J.G. (email: [email protected]) and for phylogenetic analysis, G.G. (email: [email protected]). -

POPULATION DYNAMICS of the SYCAMORE APHID (Drepanosiphum Platanoidis Schrank)
POPULATION DYNAMICS OF THE SYCAMORE APHID (Drepanosiphum platanoidis Schrank) by Frances Antoinette Wade, B.Sc. (Hons.), M.Sc. A thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy of the University of London, and the Diploma of Imperial College of Science, Technology and Medicine. Department of Biology, Imperial College at Silwood Park, Ascot, Berkshire, SL5 7PY, U.K. August 1999 1 THESIS ABSTRACT Populations of the sycamore aphid Drepanosiphum platanoidis Schrank (Homoptera: Aphididae) have been shown to undergo regular two-year cycles. It is thought this phenomenon is caused by an inverse seasonal relationship in abundance operating between spring and autumn of each year. It has been hypothesised that the underlying mechanism of this process is due to a plant factor, intra-specific competition between aphids, or a combination of the two. This thesis examines the population dynamics and the life-history characteristics of D. platanoidis, with an emphasis on elucidating the factors involved in driving the dynamics of the aphid population, especially the role of bottom-up forces. Manipulating host plant quality with different levels of aphids in the early part of the year, showed that there was a contrast in aphid performance (e.g. duration of nymphal development, reproductive duration and output) between the first (spring) and the third (autumn) aphid generations. This indicated that aphid infestation history had the capacity to modify host plant nutritional quality through the year. However, generalist predators were not key regulators of aphid abundance during the year, while the specialist parasitoids showed a tightly bound relationship to its prey. The effect of a fungal endophyte infecting the host plant generally showed a neutral effect on post-aestivation aphid dynamics and the degree of parasitism in autumn. -

Invertebrates of Slapton Ley National Nature Reserve (Fsc) and Prawle Point (National Trust)
CLARK & BECCALONI (2018). FIELD STUDIES (http://fsj.field-studies-council.org/) INVERTEBRATES OF SLAPTON LEY NATIONAL NATURE RESERVE (FSC) AND PRAWLE POINT (NATIONAL TRUST) RACHEL J. CLARK AND JANET BECCALONI Department of Life Sciences, Natural History Museum, Cromwell Road, London SW7 5BD. In 2014 the Natural History Museum, London organised a field trip to Slapton. These field notes report on the trip, giving details of methodology, the species collected and those of notable status. INTRODUCTION OBjectives A field trip to Slapton was organised, funded and undertaken by the Natural History Museum, London (NHM) in July 2014. The main objective was to acquire tissues of UK invertebrates for the Molecular Collections Facility (MCF) at the NHM. The other objectives were to: 1. Acquire specimens of hitherto under-represented species in the NHM collection; 2. Provide UK invertebrate records for the Field Studies Council (FSC), local wildlife trusts, Natural England, the National Trust and the National Biodiversity Network (NBN) Gateway; 3. Develop a partnership between these organisations and the NHM; 4. Publish records of new/under-recorded species for the area in Field Studies (the publication of the FSC). Background to the NHM collections The NHM is home to over 80 million specimens and objects. The Museum uses best practice in curating and preserving specimens for perpetuity. In 2012 the Molecular Collections Facilities (MCF) was opened at the NHM. The MCF houses a variety of material including botanical, entomological and zoological tissues in state-of-the-art freezers ranging in temperature from -20ºC and -80ºC to -150ºC (Figs. 1). As well as tissues, a genomic DNA collection is also being developed. -

SRS News 66.Pub
www.britishspiders.org.uk S.R.S. News. No. 66 In Newsl. Br. arachnol. Soc. 117 Spider Recording Scheme News March 2010, No. 66 Editor: Peter Harvey; [email protected]@britishspiders.org.uk My thanks to those who have contributed to this issue. S.R.S. News No. 67 will be published in July 2010. Please send contributions by the end of May at the latest to Peter Harvey, 32 Lodge Lane, GRAYS, Essex, RM16 2YP; e-mail: [email protected] or [email protected] Editorial Hillyard noted that it had been recorded at Edinburgh. This was not mapped, but probably refers to a record from As usual I am very grateful to all the contributors who have provided articles for this issue. Please keep the Lothian Wildlife Information Centre ‘Secret Garden providing articles. Survey’. The species was found in Haddington, to the Work on a Spider Recording Scheme website was east of Edinburgh and south of the Firth of Forth in delayed by hiccups in the OPAL grant process and the October 1995 (pers. comm. Bob Saville). These records timeslot originally set aside for the work has had to be appear on the National Biodiversity Network Gateway. reorganised. Work should now be completed by the end of D. ramosus is generally synanthropic and is common May this year. in gardens where it can be beaten from hedges and trees, As always many thanks are due to those Area especially conifers. However many peoples’ first Organisers, MapMate users and other recorders who have experience of this species will be of seeing it spread- provided their records to the scheme during 2009 and eagled on a wall (especially if the wall is whitewashed – early this year. -

Diversity and Habitat Use of Neotropical Harvestmen (Arachnida: Opiliones) in a Costa Rican Rainforest
International Scholarly Research Network ISRN Zoology Volume 2012, Article ID 549765, 16 pages doi:10.5402/2012/549765 Research Article Diversity and Habitat Use of Neotropical Harvestmen (Arachnida: Opiliones) in a Costa Rican Rainforest Daniel N. Proud,1 Bruce E. Felgenhauer,1 Victor R. Townsend Jr.,2 Daniel O. Osula,3 Wyman O. Gilmore III,3 Zachery L. Napier,3 and Peter A. Van Zandt3 1 Department of Biology, University of Louisiana at Lafayette, P.O. Box 42451, Lafayette, LA 70504-2451, USA 2 Department of Biology, Virginia Wesleyan College, 1584 Wesleyan Drive, Norfolk, VA 23502, USA 3 Department of Biology, Birmingham-Southern College, 900 Arkadelphia Road, Birmingham, AL 35254, USA Correspondence should be addressed to Daniel N. Proud, [email protected] Received 7 November 2011; Accepted 7 December 2011 Academic Editors: M. Kuntner and S. E. Walker Copyright © 2012 Daniel N. Proud et al. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. In tropical rain forests, harvestmen assemblages are extremely diverse, with richness often exceeding 25 species. In the neotropics, there are published accounts of harvestmen faunas in South America rainforests (especially Amazonia), but relatively little is known about the community ecology of harvestmen in tropical forests of Central America. In this paper, we provide the first insights into the diverse assemblage of harvestmen inhabiting a wet forest at La Selva Biological Station, Costa Rica. Over five field seasons, we recorded 38 species. During our 2009 field season, we examined variation in species abundance, richness, and composition between adjacent successional forests (young secondary, mature secondary, and primary forests) as well as between distinct habitats (ground/litter layer and shrub/tree layer). -

19 Spinnen En Hooiwagens V
Natuur atlas Zaanstad Bijlage 6 Spinnen en Hooiwagens in Zaanstad Ron van ’t Veer & Jinze Noordijk, 2012 Citeren als Veer, R. van ’t, & J. Noordijk, 2012. Spinnen en Hooiwagens in Zaanstad. CDROM-Bijlage 6 Natuuratlas Zaanstad. Ecologisch Adviesbureau Van ’t Veer & De Boer, Jisp & Stichting Natuur & Milieu Educatie - Zaanstreek. SPINNEN EN HOOIWAGENS IN ZAANSTAD 1) Ron van ’t Veer & Jinze Noordijk (European Invertebrate Survey – Nederland) Spinnen, hooiwagens, mijten en pseudoschorpioenen behoren tot de spinachtigen. Van de landbewonende spinachtigen is weinig bekend uit Zaanstad en alleen van spinnen en hooiwagens bestaan voldoende gegevens om er iets zinvols over te schrijven. Van de spinachtigen vallen de spinnen wel het meest op door hun zichtbaarheid en grote verscheidenheid aan soorten. Spinnen komen in allerlei leefgebieden voor en vertonen een sterke specialisatie; zo zijn er bijvoorbeeld typische soorten van moerassen, bossen, kaal zand, maar ook van binnenshuis. Hooiwagens zijn overal te vinden waar wat beschutting tegen uitdroging aanwezig is, zoals in plantenruigtes, de strooisellaag of aan de schaduwkant van boomstammen of muren. Hier geven we een overzicht van wat we weten van de soortensamenstelling van deze twee groepen. Biodiversiteit In Zaanstad zijn in totaal 132 spinnensoorten aangetroffen van de ruim 600 met zekerheid in ons land voorkomende soorten. Van de spinnen zijn inventarisatiegegevens aanwezig vanaf de jaren 1980. Van de hooiwagens hebben de eerste en enige inventarisaties plaatsgevonden in 2007 en 2009. Spinnen - Araneae De spinnen zijn waargenomen tijdens verschillende veldinventarisaties of als losse waarnemingen. De gehele gemeente is nooit systematisch onderzocht op spinnen en leefgebieden als stadsparken, droge bosschages en graslanden (inclusief bermen) zijn tot nu toe onderbemonsterd gebleven.