Acta Biologica Benrodis
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
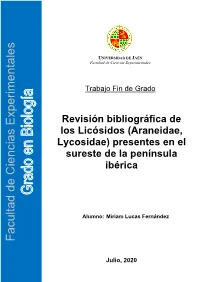
TFG Lucas Fernandez Miriam.Pdf
UNIVERSIDAD DE JAÉN Facultad de Ciencias Experimentales Trabajo Fin de Grado Revisión bibliográfica de los Licósidos (Araneidae, Lycosidae) presentes en el sureste de la península ibérica Ciencias Experimentales Alumno: Miriam Lucas Fernández Facultad de Julio, 2020 UNIVERSIDAD DE JAÉN FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES GRADO EN BIOLOGÍA Trabajo Fin de Grado Revisión bibliográfica de los Licósidos (Araneidae, Lycosidae) presentes en el sureste de la península ibérica Miriam Lucas Fernández Julio, 2020 1 RESUMEN ………………………………………………………………………………3 2 INTRODUCCIÓN ................................................................................................ 4 2.1 Distribución y diversidad de las arañas ......................................................... 4 2.2 Morfología biológica ...................................................................................... 5 2.3 Biología reproductiva del orden Araneae ...................................................... 7 3 OBJETIVOS ........................................................................................................ 8 4 MATERIALES Y MÉTODOS ............................................................................... 9 5 FAMILIA LYCOSIDAE: Perspectiva mundial e ibérica ....................................... 9 5.1 Taxonomía .................................................................................................. 10 5.2 Identificación ............................................................................................... 12 5.3 Hábitat ........................................................................................................ -

196 Arachnology (2019)18 (3), 196–212 a Revised Checklist of the Spiders of Great Britain Methods and Ireland Selection Criteria and Lists
196 Arachnology (2019)18 (3), 196–212 A revised checklist of the spiders of Great Britain Methods and Ireland Selection criteria and lists Alastair Lavery The checklist has two main sections; List A contains all Burach, Carnbo, species proved or suspected to be established and List B Kinross, KY13 0NX species recorded only in specific circumstances. email: [email protected] The criterion for inclusion in list A is evidence that self- sustaining populations of the species are established within Great Britain and Ireland. This is taken to include records Abstract from the same site over a number of years or from a number A revised checklist of spider species found in Great Britain and of sites. Species not recorded after 1919, one hundred years Ireland is presented together with their national distributions, before the publication of this list, are not included, though national and international conservation statuses and syn- this has not been applied strictly for Irish species because of onymies. The list allows users to access the sources most often substantially lower recording levels. used in studying spiders on the archipelago. The list does not differentiate between species naturally Keywords: Araneae • Europe occurring and those that have established with human assis- tance; in practice this can be very difficult to determine. Introduction List A: species established in natural or semi-natural A checklist can have multiple purposes. Its primary pur- habitats pose is to provide an up-to-date list of the species found in the geographical area and, as in this case, to major divisions The main species list, List A1, includes all species found within that area. -

Systematic Revision of Hoggicosa Roewer, 1960, the Australian 'Bicolor' Group of Wolf Spiders (Araneae: Lycosidae)Zoj 545 83
Zoological Journal of the Linnean Society, 2010, 158, 83–123. With 25 figures Systematic revision of Hoggicosa Roewer, 1960, the Australian ‘bicolor’ group of wolf spiders (Araneae: Lycosidae)zoj_545 83..123 PETER R. LANGLANDS1* and VOLKER W. FRAMENAU1,2 1School of Animal Biology, University of Western Australia, Crawley, WA, 6009, Australia 2Department of Terrestrial Zoology, Western Australian Museum, Locked bag 49, Welshpool DC, WA, 6986, Australia Received 16 September 2008; accepted for publication 3 November 2008 The Australian wolf spider genus Hoggicosa Roewer, 1960 with the type species Hoggicosa errans (Hogg, 1905) is revised to include ten species: Hoggicosa alfi sp. nov.; Hoggicosa castanea (Hogg, 1905) comb. nov. (= Lycosa errans Hogg, 1905 syn. nov.; = Lycosa perinflata Pulleine, 1922 syn. nov.; = Lycosa skeeti Pulleine, 1922 syn. nov.); Hoggicosa bicolor (McKay, 1973) comb. nov.; Hoggicosa brennani sp. nov.; Hoggicosa duracki (McKay, 1975) comb. nov.; Hoggicosa forresti (McKay, 1973) comb. nov.; Hoggicosa natashae sp. nov.; Hoggicosa snelli (McKay, 1975) comb. nov.; Hoggicosa storri (McKay, 1973) comb. nov.; and Hoggicosa wolodymyri sp. nov. The Namibian Hoggicosa exigua Roewer, 1960 is transferred to Hogna, Hogna exigua (Roewer, 1960) comb. nov. A phylogenetic analysis including nine Hoggicosa species, 11 lycosine species from Australia and four from overseas, with Arctosa cinerea Fabricius, 1777 as outgroup, supported the monophyly of Hoggicosa, with a larger distance between the epigynum anterior pockets compared to the width of the posterior transverse part. The analysis found that an unusual sexual dimorphism for wolf spiders (females more colourful than males), evident in four species of Hoggicosa, has evolved multiple times. Hoggicosa are burrowing lycosids, several constructing doors from sand or debris, and are predominantly found in semi-arid to arid regions of Australia. -

Development of a Concept for the Sustainable Management of Baltic Sea Beaches
Development of a concept for the sustainable management of Baltic Sea beaches Kumulative Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel vorgelegt von Franziska Katrin Seer Kiel, Oktober 2015 Erster Gutachter: Prof. Dr. Joachim Schrautzer Zweiter Gutachter: Prof. Dr. Hans-Rudolf Bork Tag der mündlichen Prüfung: 19.01.2016 Zum Druck genehmigt: 19.01.2016 gez. Prof. Dr. Wolfgang J. Duschl, Dekan Contents Zusammenfassung / Abstract Chapter 1: Impact of tourism on the ecology of Baltic Sea beaches – a general introduction Chapter 2: Beaches under pressure – effects of human access on vegetation at Baltic Sea beaches Seer FK, Irmler U, Schrautzer J (accepted) Journal of Applied Vegetation Science. DOI: 10.1111/avsc.12221 Chapter 3: Effects of trampling on beach plants at the Baltic Sea Seer FK, Irmler U, Schrautzer J (2015) Folia Geobotanica 50: 303-315. DOI: 10.1007/s12224-015-9230-z Chapter 4: How much space is needed for spider conservation? Home range and movement patterns of wolf spiders (Aranea, Lycosidae) at Baltic Sea beaches Seer FK, ElBalti N, Schrautzer J, Irmler U (2015) Journal of Insect Conservation 19:791-800 DOI: 10.1007/s10841-015-9800-7 Chapter 5: Tourism and near-natural beaches at the Baltic Sea – a contradiction? Chapter 6: Conclusion and outlook Danksagung Sustainable management of Baltic Sea beaches List of figures Figure 1.1: The coastal sequence of the typical sandy beach plant communities ...................... 10 Figure 1.2: A logical model of some of the ecological effects of trampling ................................. 12 Figure 1.3: Main components of the project ................................................................................... -

Spiders (Arachnida: Aranei) of Azerbaijan. 2. Critical Survey of Wolf Spiders (Lycosidae) Found in the Country with Description
Arthropoda Selecta 12 (1): 4765 © ARTHROPODA SELECTA, 2003 Spiders (Arachnida: Aranei) of Azerbaijan. 2. Critical survey of wolf spiders (Lycosidae) found in the country with description of three new species and brief review of Palaeartic Evippa Simon, 1885 Ïàóêè (Arachnida: Aranei) Àçåðáàéäæàíà. 2. Îáçîð ïàóêîâ-âîëêîâ (Lycosidae) îòìå÷åííûõ â ôàóíå ðåñïóáëèêè ñ îïèñàíèåì òð¸õ íîâûõ âèäîâ è êðàòêèé îáçîð ïàóêîâ ðîäà Evippa Simon, 1885 Âîñòî÷íîé Ïàëåàðêòèêè Yuri M. Marusik1, Elchin F. Guseinov2 & Seppo Koponen3 Þ.Ì. Ìàðóñèê1, Ý.Ô. Ãóñåéíîâ2, Ñ. Êîïîíåí3 ¹ Institute for Biological Problems of the North, Portovaya Str. 18, Magadan, 685000 Russia. E-mail: [email protected] ¹ Èíñòèòóò áèîëîãè÷åñêèõ ïðîáëåì Ñåâåðà, ÄÂÎ ÐÀÍ, óë. Ïîðòîâàÿ 18, Ìàãàäàí 685000 Ðîññèÿ. ² Institute of Zoology, block 504, passage 1128, Baku 370073 Azerbaijan. E-mail: [email protected] ² Èíñòèòóò çîîëîãèè ÀÍ Àçåðáàéäæàíà, êâàðòàë 504, ïðîåçä 1128, Áàêó 370073 Àçåðáàéäæàí. 3 Zoological Museum, University of Turku, FIN-20014 Turku Finland. E-mail: [email protected] KEY WORDS: Aranei, Lycosidae, Evippa, wolf spiders, check-list, Caucasus, Azerbaijan, new records, new species. ÊËÞ×ÅÂÛÅ ÑËÎÂÀ: Aranei, Lycosidae, Evippa, ïàóêè-âîëêè, ñèñòåìàòè÷åñêèé ñïèñîê, Êàâêàç, Àçåðáàéäæàí, íîâûå íàõîäêè, íîâûå âèäû. ABSTRACT: Three species new to science are mon, 1870 îáíàðóæåíà âïåðâûå â ôàóíå Àçåðáàé- described from Azerbaijan: Evippa apsheronica sp.n. äæàíà è âñåãî Êàâêàçà. Ñîãëàñíî ëèòåðàòóðíûì è ($), E. caucasica sp.n. (#) and Pardosa gusarensis íîâûì äàííûì ôàóíà ïàóêîâ-âîëêîâ ðåñïóáëèêè sp.n. ($). A survey of Evippa Simon, 1882 reported âêëþ÷àåò 69 âèäîâ îòíîñèìûõ ê 14 ðîäàì: Alloho- from the former USSR is given and six species are gna (1), Alopecosa (14), Arctosa (4), Aulonia (2), illustrated. -

Phantom Spiders 2: More Notes on Dubious Spider Species from Europe
© Arachnologische Gesellschaft e.V. Frankfurt/Main; http://arages.de/ Arachnologische Mitteilungen / Arachnology Letters 52: 50-77 Karlsruhe, September 2016 Phantom spiders 2: More notes on dubious spider species from Europe Rainer Breitling, Tobias Bauer, Michael Schäfer, Eduardo Morano, José A. Barrientos & Theo Blick doi: 10.5431/aramit5209 Abstract. A surprisingly large number of European spider species have never been reliably rediscovered since their first description many decades ago. Most of these are probably synonymous with other species or unidentifiable, due to insufficient descriptions or mis- sing type material. In this second part of a series on this topic, we discuss about 100 of these cases, focusing mainly on species described in the early 20th century by Pelegrín Franganillo Balboa and Gabor von Kolosváry, as well as a number of jumping spiders and various miscellaneous species. In most cases, the species turned out to be unidentifiablenomina dubia, but for some of them new synonymies could be established as follows: Alopecosa accentuata auct., nec (Latreille, 1817) = Alopecosa farinosa (Herman, 1879) syn. nov., comb. nov.; Alopecosa barbipes oreophila Simon, 1937 = Alopecosa farinosa (Herman, 1879) syn. nov., comb. nov.; Alopecosa mariae orientalis (Kolosváry, 1934) = Alopecosa mariae (Dahl, 1908) syn. nov.; Araneus angulatus afolius (Franganillo, 1909) and Araneus angulatus atricolor Simon, 1929 = Araneus angulatus Clerck, 1757 syn. nov.; Araneus angulatus castaneus (Franganillo, 1909) = Araneus pallidus (Olivier, 1789) syn. nov.; Araneus angulatus levifolius (Franganillo, 1909), Araneus angulatus niger (Franganillo, 1918) and Araneus angulatus nitidifolius (Franganillo, 1909) = Araneus angulatus Clerck, 1757 syn. nov.; Araneus angulatus pallidus (Franganillo, 1909), Araneus angulatus cru- cinceptus (Franganillo, 1909), Araneus angulatus fuscus (Franganillo, 1909) and Araneus angulatus iberoi (Franganillo, 1909) = Araneus pal- lidus (Olivier, 1789) syn. -

Karyotypes of Central European Spiders of the Genera Arctosa, Tricca, and Xerolycosa (Araneae: Lycosidae)
Eur. J. Entomol. 108: 1–16, 2011 http://www.eje.cz/scripts/viewabstract.php?abstract=1581 ISSN 1210-5759 (print), 1802-8829 (online) Karyotypes of central European spiders of the genera Arctosa, Tricca, and Xerolycosa (Araneae: Lycosidae) 1 2 2 1 1 1 PETR DOLEJŠ , TEREZA KOěÍNKOVÁ , JANA MUSILOVÁ , VċRA OPATOVÁ , LENKA KUBCOVÁ , JAN BUCHAR 2 and JIěÍ KRÁL 1Department of Zoology, Charles University in Prague, Faculty of Science, Viniþná 7, CZ – 128 44 Prague 2, Czech Republic, e-mails: [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected] 2Laboratory of Arachnid Cytogenetics, Department of Genetics and Microbiology, Charles University in Prague, Faculty of Science, Viniþná 5, CZ – 128 44 Prague 2, Czech Republic, e-mails: [email protected]; [email protected]; [email protected] Key words. Lycosidae, spiders, karyotype, sex chromosomes, meiosis, constitutive heterochromatin, nucleolar organizer region, Czech Republic, Austria Abstract. The aim of this study was to characterize karyotypes of central European spiders of the genera Arctosa, Tricca, and Xero- lycosa (Lycosidae) with respect to the diploid chromosome number, chromosome morphology, and sex chromosomes. Karyotype data are reported for eleven species, six of them for the first time. For selected species the pattern in the distributions of the constitu- tive heterochromatin and the nucleolar organizer regions (NORs) was determined. The silver staining technique for detecting NORs of lycosid spiders was standardized. The male karyotype consisted of 2n = 28 (Arctosa and Tricca) or 2n = 22 (Xerolycosa) acrocen- tric chromosomes. The sex chromosome system was X1X20 in all species. The sex chromosomes of T. -

Süßwasserfauna Von Mitteleuropa, Vol. 7/2-1 Chelicerata: Araneae/Acari I Gerecke (Ed.) Chelicerata: Araneae, Acari I Süßwasserfauna Von Mitteleuropa Begründet Von A
Süßwasserfauna von Mitteleuropa Reinhard Gerecke Editor Ilse Bartsch · Kees Davids · Ralf Deichsel Antonio Di Sabatino · Grzegorz Gabryś · Reinhard Gerecke Terence Gledhill · Peter Jäger · Joanna Makol · Harry Smit Henk van der Hammen · Gerd Weigmann Andreas Wohltmann · Eberhard Wurst Süßwasserfauna von Mitteleuropa, Vol. 7/2-1 Chelicerata: Araneae/Acari I Gerecke (ed.) Chelicerata: Araneae, Acari I Süßwasserfauna von Mitteleuropa Begründet von A. Brauer Herausgegeben von J. Schwoerbel (†) und P. Zwick Stellvertretender Herausgeber für Band 7: R. Gerecke Band 7/2-1 To the memory of Jürgen Schwoerbel (1930–2002) who took the initiative for the new edition of the Brauer series and coordinated the first steps of the the production of this volume. Ilse Bartsch Kees Davids Ralf Deichsel Antonio Di Sabatino Grzegorz Gabryś Reinhard Gerecke Terence Gledhill Peter Jäger Joanna Mąkol Harry Smit Henk van der Hammen Gerd Weigmann Andreas Wohltmann Eberhard Wurst Chelicerata: Araneae, Acari I Süßwasserfauna von Mitteleuropa 7/2-1 Ilse Bartsch Peter Jäger Frankfurt am Main, Deutschland Frankfurt, Deutschland Kees Davids Joanna Makol Amsterdam, Niederlande Wroclaw, Polen Ralf Deichsel Harry Smit Berlin, Deutschland Amsterdam, Niederlande Antonio Di Sabatino Henk van der Hammen Coppito L’Aquila, Italien Amsterdam, Niederlande Grzegorz Gabrys´ Gerd Weigmann Zielona Góra, Polen Berlin, Deutschland Reinhard Gerecke Andreas Wohltmann Tübingen, Deutschland Bremen, Deutschland Terence Gledhill Eberhard Wurst Kendal, Großbritannien Stuttgart, Deutschland Süßwasserfauna von Mitteleuropa ISBN 978-3-662-55957-4 ISBN 978-3-662-55958-1 (eBook) https://doi.org/10.1007/978-3-662-55958-1 Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detail- lierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. -

The History of Cytogenetic Investigations of Spiders in Turkey
International Journal of Zoology and Animal Biology ISSN: 2639-216X MEDWIN PUBLISHERS Committed to Create Value for Researchers The History of Cytogenetic Investigations of Spiders in Turkey Kumbicak Z* Review Article Volume 3 Issue 4 Department of Molecular Biology and Genetics, Nevşehir Hacı Bektaş Veli University, Turkey *Corresponding author: Received Date: Published Date: June 12, 2020 Zubeyde Kumbicak, Department of Molecular Biology and Genetics, July 06, 2020 Faculty of Art and Science, Nevsehir Hacı Bektas Veli University, 50300, Nevşehir, Turkey, DOI: 10.23880/izab-16000232 E-mail: [email protected] Abstract Spiders are an ancient group of animals that probably originated in the Devonian period about 400 million years ago. Over time, they have adapted to major changes in climate and fauna and have become widespread on all continents, living in almost any terrestrial habitat. It is known that approximately 50000 spider species belonging to 120 families worldwide, today. and this number increases almost every day due to new records are being given from many countries. Despite the high diversity of species, the number of cytogenetic studies on spiders is very scarce. Upto now, 868 species belonging to the 74 families were investigated by cytogenetically. Although more than a thousand species of spiders in Turkey, the Cytogenetic studies are insufficient. Thus, spiders are the most richest group of arachnids among arthropods. In this study cytogenetic studies on Keywords:spiders in Turkey were reviewed. Convergent Evolution; Rheumatoid Arthritis; Typhoid; HIV Abbreviations: IntroductionSCS: Sex Chromosome System. pedipalpus, which has a bulging structure in male spiders, is an important structure in the transfer of sperm to the female. -

Proceedings of the Indiana Academy of Science 1 14(2): 1 1 1-206
2005. Proceedings of the Indiana Academy of Science 1 14(2): 1 1 1-206 THE SPIDER SPECIES OF THE GREAT LAKES STATES 1 2 3 4 Petra Sierwald , Michael L. Draney , Thomas Prentice , Frank Pascoe , Nina 1 5 2 1 Sandlin , Elizabeth M. Lehman , Vicki Medland , and James Louderman : 'Zoology, The Field Museum, 1400 S Lake Shore Drive, Chicago, Illinois 60605; 2Department of Natural and Applied Sciences and Cofrin Center for Biodiversity, University of Wisconsin-Green Bay, 2420 Nicolet Drive, Green Bay, Wisconsin 3 5431 1; Department of Entomology, University of California, Riverside, California 92521; 4Biology, College of St. Francis, 500 Wilcox Street, Joliet, Illinois 60435: 5 Department of Biology, Indiana University, Bloomington, Indiana 47405 ABSTRACT. Critical analysis of existing spider species lists for Wisconsin, Michigan, Ohio. Indiana and Illinois reveals 900 species recorded from the five-state region (284 genera, 40 families). All non- native, Palearctic, or otherwise questionable species records were scrutinized, and their status is discussed. The most speciose families in the region are the Linyphiidae (almost 24% of species), Salticidae (10.3%), Theridiidae (8.9%), Lycosidae (8.8%), and Araneidae (7.7%). All sources used for spider species names and species records are unambiguously quoted. Spider species records are presented in tables allowing comparison of family composition among the states, and prediction of number of heretofore unrecorded species. Richness among states is analyzed and found to be dependent on varying degrees of sampling effort. As a new tool, a Spider Species Name Concordance Table allows tracking previously published spider species names to the currently valid name of every species record. -

The Wildlife of the Lune Region
The Wildlife of the Lune Region A Beginner’s Guide (the beginner is me, not you) John Self The Wildlife of the Lune Region John Self 2013 - 2016 Drakkar Press Limited, 20 Moorside Road, Brookhouse, Lancaster LA2 9PJ http://www.drakkar.co.uk [email protected] Copyright © Drakkar Press All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or used in any form by any means - graphic, electronic or mechanical, including photocopying, recording or information and retrieval systems - without the prior permission of the publisher. ISBN 978-0-9548605-5-4 DRAKKAR PRESS The Wildlife of the Lune Region Contents 1. Curlews on Green Bell 11 2. Snails on Sunbiggin Moor 16 3. Orchids on Great Asby Scar 21 4. Trees in Edith’s Wood and Greta Wood 25 5. Cinnabar Caterpillars near Heysham Moss 32 6. Marsh Gentian on Keasden Moor 37 7. Small-Leaved Lime in Aughton Woods 40 8. Eels in the Wenning 44 9. Cattle on Fell End Clouds 50 10. Pink-Footed Geese in the Wyre-Lune Sanctuary 55 11. Purple Saxifrage on Ingleborough 63 12. Sand Martins by the Lune 69 13. Fell Ponies on Roundthwaite Common 74 14. Cuckoos in Littledale 80 15. Small Pearl-Bordered Fritillaries on Lawkland Moss 86 16. Kingfishers by Bull Beck 93 17. Himalayan-Balsam on the Upper Lune 97 18. Juniper on Moughton 106 19. Wolf-Spiders by the Lune 111 20. Hen-Harriers in Roeburndale 117 Map for Sections 1-20 123 21. Sitka-Spruce in Dentdale 124 22. Dippers in Barbon Beck 129 23. -

Nieuwsbrief Spined
NIEUWSBRIEF SPINED Spinnenwerkgroep Nederland European Invertebrate Survey-Nederland – Leiden Kenniscentrum Insecten en Overige Ongewervelden Aflevering 38 - 2019 INHOUD Redactioneel . 1 Jinze Noordijk, Karen van Dorp & Peter Koomen: Aanvullende waarnemingen van de springspin Philaeus chrysops (Araneae: Salticidae) . 2 Spinnensympsium 13 april 2019 . 4 Johan Bink: Spinnentransport, voorbeelden van een Papendrechts bedrijf. II: aanvullingen, inclusief een nieuwe importsoort voor Nderland . 5 Steven IJland & Peter J. van Helsdingen: Update on the spiders (Arachnida, Araneae) of Calabria, Italy . 8 Foto’s Agelena labyrinthica . 22 Fotoserie paring kruisspin . 23 Spin van het Jaar 2019: Myrmarachne formicaria . 24 Joost Vogels: Verslag van een vakantieweek spinnen verzamelen met Talavera aperta (Miller, 1971) nieuw voor de Nederlandse fauna . 25 Peter J. van Helsdingen: Observations on prey capture by a redback (Latrodectus hasselti Thorell, 1870) (Araneae, Theridiidae) . 31 Peter J. van Helsdingen: Spinnen (Araneae) in het 5000-Soortenjaar 2018 aangetroffen in het zoekgebied “Nationaal Park Hollandse Duinen” . 35 Peter J. van Helsdingen: Faunistiek en dynamiek in de spinnenwereld . 41 Recent changes in nomenclature (2019.1) . 44 Boekbespreking: Basisgids Spinnen door Caroline Elfferich . 45 Excursie 2018: Speulderveld en Speulderbos, en excursie 2019 . 47 Arachnologische congressen . 48 Foto’s pagina X: Sterwebje van Agelena labyrinthica (René Buijs) Foto’s pagina XX: Parende kruisspinnen (Frans M. Jansen) NIEUWSBRIEF SPINED van de Spinnenwerkgroep Nederland No 38 Maart 2019 REDACTIONEEL De spinnenfauna in ons land is en blijft dynamisch. Altijd zo geweest, nu alleen beter gevolgd en dus beter zichtbaar. Diverse voorbeelden hiervan passeren in dit nummer de revue. De fraaie Philaeus chrysops – vooral het mannetje is opvallend gekleurd – is een aantal keren in ons land opgedoken.