Fischer Tor Genre Guide.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

New Alt.Cyberpunk FAQ
New alt.cyberpunk FAQ Frank April 1998 This is version 4 of the alt.cyberpunk FAQ. Although previous FAQs have not been allocated version numbers, due the number of people now involved, I've taken the liberty to do so. Previous maintainers / editors and version numbers are given below : - Version 3: Erich Schneider - Version 2: Tim Oerting - Version 1: Andy Hawks I would also like to recognise and express my thanks to Jer and Stack for all their help and assistance in compiling this version of the FAQ. The vast number of the "answers" here should be prefixed with an "in my opinion". It would be ridiculous for me to claim to be an ultimate Cyberpunk authority. Contents 1. What is Cyberpunk, the Literary Movement ? 2. What is Cyberpunk, the Subculture ? 3. What is Cyberspace ? 4. Cyberpunk Literature 5. Magazines About Cyberpunk and Related Topics 6. Cyberpunk in Visual Media (Movies and TV) 7. Blade Runner 8. Cyberpunk Music / Dress / Aftershave 9. What is "PGP" ? 10. Agrippa : What and Where, is it ? 1. What is Cyberpunk, the Literary Movement ? Gardner Dozois, one of the editors of Isaac Asimov's Science Fiction Magazine during the early '80s, is generally acknowledged as the first person to popularize the term "Cyberpunk", when describing a body of literature. Dozois doesn't claim to have coined the term; he says he picked it up "on the street somewhere". It is probably no coincidence that Bruce Bethke wrote a short story titled "Cyberpunk" in 1980 and submitted it Asimov's mag, when Dozois may have been doing first readings, and got it published in Amazing in 1983, when Dozois was editor of1983 Year's Best SF and would be expected to be reading the major SF magazines. -
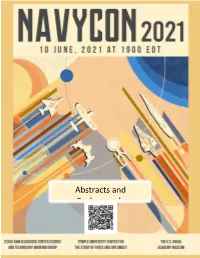
Abstracts and Backgrounds
Abstracts and Backgrounds NAVY Con TABLE OF CONTENTS DESTINATION UNKNOWN ................................................................................. 3 WAR AND SOCIETY ............................................................................................. 5 MATT BUCHER – POTEMKIN PARADISE: THE UNITED FEDERATION IN THE 24TH CENTURY ............ 5 ELSA B. KANIA – BEYOND LOYALTY, DUTY, HONOR: COMPETING PARADIGMS OF PROFESSIONALISM IN THE CIVIL-MILITARY RELATIONS OF BABYLON 5 ............................................ 6 S.H. HARRISON – STAR CULTURE WARS: THE NEGATIVE IMPACT OF POLITICS AND IMPERIALISM ON IMPERIAL NAVAL CAPABILITY IN STAR WARS ................................................................................ 6 MATTHEW ADER – THE ARISTOCRATS STRIKE BACK: RE-ECALUATING THE POLITICAL COMPOSITION OF THE ALLIANCE TO RESTORE THE REPUBLIC ......................................................... 7 LT COL BREE FRAM, USSF – LEADERSHIP IN TRANSITION: LESSONS FROM TRILL .......................... 7 PAST AND FUTURE COMPETITION ................................................................ 8 WILLIAM J. PROM – THE ONCE AND FUTURE KING OF BATTLE: ARTILLERY (AND ITS ABSENCE) IN SCIENCE FICTION .......................................................................................................................... 8 TOM SHUGART – ALL ABOUT EVE: WHAT VIRTUAL FOREVER WARS CAN TEACH US ABOUT THE FUTURE OF COMBAT ................................................................................................................... 10 -

Discussion About Edwardian/Pulp Era Science Fiction
Science Fiction Book Club Interview with Jess Nevins July 2019 Jess Nevins is the author of “the Encyclopedia of Fantastic Victoriana” and other works on Victoriana and pulp fiction. He has also written original fiction. He is employed as a reference librarian at Lone Star College-Tomball. Nevins has annotated several comics, including Alan Moore’s The League of Extraordinary Gentlemen, Elseworlds, Kingdom Come and JLA: The Nail. Gary Denton: In America, we had Hugo Gernsback who founded science fiction magazines, who were the equivalents in other countries? The sort of science fiction magazine that Gernsback established, in which the stories were all science fiction and in which no other genres appeared, and which were by different authors, were slow to appear in other countries and really only began in earnest after World War Two ended. (In Great Britain there was briefly Scoops, which only 20 issues published in 1934, and Tales of Wonder, which ran from 1937 to 1942). What you had instead were newspapers, dime novels, pulp magazines, and mainstream magazines which regularly published science fiction mixed in alongside other genres. The idea of a magazine featuring stories by different authors but all of one genre didn’t really begin in Europe until after World War One, and science fiction magazines in those countries lagged far behind mysteries, romances, and Westerns, so that it wasn’t until the late 1940s that purely science fiction magazines began appearing in Europe and Great Britain in earnest. Gary Denton: Although he was mainly known for Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle also created the Professor Challenger stories like The Lost World. -

Vector 179 Cary 1994-06
June/July 1994 The Critical Journal of the BSF A Vector 2 Contents 3 Front Line Dispatches Readers' Letters Contributions: Good articles are always wanted. All MSS should 5 Best Books of 1993 be typed double spaced on one side of the page . Reviewers' Poll Submissions may also be accepted as ASCII text 12 Horribly Real files on IBM, Alari ST or Mac 3,5" discs William Gibson interview Maximum preferred length is 6000 words; excep tions can and wilt be made. A preliminary letter is ad 18 Children's Fantasy visable but not essential. Unsolicited MSS cannot be A Roundup Review returned without an SAE. 23 Compass Points 10 Please note that there is no payment for publica The Memory of Whiteness tion. Members who wish to review books should first write to the appropriate editor 24 Compass Points 11 The Last Spaceship from Earth Artists: 26 Future Histories in SF Cover Art, Illustrations and fillers are always Stephen Baxter welcome 28 Twilight's Last Gleaming A Historical Survey of TV SF The British Science Fiction Association Ltd. - Company Limited by Guarantee - Company No 36 First Impressions 921500 - Registered Address - 60 Bournemouth Reviews edited by Catie Cary Rd, Folkestone, Kent , CT19 SAZ 45 Paperback Graffiti Reviews edited by Stephen Payne Nuts & Bolts Front Cover Artwork by Claire Willoughby Just room for a couple of notes: Editor & Hardback Reviews We have here the bumper issue promised to Catie Cary make up for last issues shortfall. You may notice that 224 Southway, Park Barn, Guildford , I've been redesigning again - this is because I have Surrey , GU2 60N finally abandoned my trusty Atari ST in favour of a Phone: 0483 502349 PC in the interests of better productivity. -

Teacher's Notes
Teacher’s Notes: The Maximus Black Files The Only Game in the Galaxy By Paul Collins Synopsis The Only Game in the Galaxy is the final book in the series The Maximus Black Files . The trilogy includes the previously published and very successful, Mole Hunt as well as the intriguing Dyson’s Drop. Author Paul Collins imbues his characters and settings with detailed descriptions of futuristic worlds. The story is set in a far away galaxy in a time where life on earth is a distant memory. Maximus Black is a Special Agent for RIM, an intergalactic law enforcement agency. Previously, he had set out to kill Anneke Longshadow who was his sworn enemy and also an agent at RIM. She is just as smart, just as talented, and also prepared to do just about anything to survive. Unlike Maximus however, she is loyal to RIM. She survives Max’s attempt on her life but suffers a strange type of amnesia. Whilst Max curses about her survival he is determined to ‘use’ her on a dangerous mission that should lead her to a hapless death. These main characters, Maximus Black and his nemesis, Anneke Longshadow, continue their rampant dislike of each other. However, this story also includes events where they are dependent upon each other not only for their own survival but also the protection of their family and future. They travel back in time encountering strange and dangerous virus-infected planets, grossly fierce and ugly beings, as well as attempting to solve the code that will fulfil their destiny. -

Paradise Lost , Book III, Line 18
_Paradise Lost_, book III, line 18 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ++++++++++Hacker's Encyclopedia++++++++ ===========by Logik Bomb (FOA)======== <http://www.xmission.com/~ryder/hack.html> ---------------(1997- Revised Second Edition)-------- ##################V2.5################## %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% "[W]atch where you go once you have entered here, and to whom you turn! Do not be misled by that wide and easy passage!" And my Guide [said] to him: "That is not your concern; it is his fate to enter every door. This has been willed where what is willed must be, and is not yours to question. Say no more." -Dante Alighieri _The Inferno_, 1321 Translated by John Ciardi Acknowledgments ---------------------------- Dedicated to all those who disseminate information, forbidden or otherwise. Also, I should note that a few of these entries are taken from "A Complete List of Hacker Slang and Other Things," Version 1C, by Casual, Bloodwing and Crusader; this doc started out as an unofficial update. However, I've updated, altered, expanded, re-written and otherwise torn apart the original document, so I'd be surprised if you could find any vestiges of the original file left. I think the list is very informative; it came out in 1990, though, which makes it somewhat outdated. I also got a lot of information from the works listed in my bibliography, (it's at the end, after all the quotes) as well as many miscellaneous back issues of such e-zines as _Cheap Truth _, _40Hex_, the _LOD/H Technical Journals_ and _Phrack Magazine_; and print magazines such as _Internet Underground_, _Macworld_, _Mondo 2000_, _Newsweek_, _2600: The Hacker Quarterly_, _U.S. News & World Report_, _Time_, and _Wired_; in addition to various people I've consulted. -

Network Aesthetics
Network Aesthetics: American Fictions in the Culture of Interconnection by Patrick Jagoda Department of English Duke University Date:_______________________ Approved: ___________________________ Priscilla Wald, Supervisor ___________________________ Katherine Hayles ___________________________ Timothy W. Lenoir ___________________________ Frederick C. Moten Dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Department of English in the Graduate School of Duke University 2010 ABSTRACT Network Aesthetics: American Fictions in the Culture of Interconnection by Patrick Jagoda Department of English Duke University Date:_______________________ Approved: ___________________________ Priscilla Wald, Supervisor __________________________ Katherine Hayles ___________________________ Timothy W. Lenoir ___________________________ Frederick C. Moten An abstract of a dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Department of English in the Graduate School of Duke University 2010 Copyright by Patrick Jagoda 2010 Abstract Following World War II, the network emerged as both a major material structure and one of the most ubiquitous metaphors of the globalizing world. Over subsequent decades, scientists and social scientists increasingly applied the language of interconnection to such diverse collective forms as computer webs, terrorist networks, economic systems, and disease ecologies. The prehistory of network discourse can be -

Part One: 'Science Fiction Versus Mundane Culture', 'The Overlap Between Science Fiction and Other Genres' and 'Horror Motifs' Transcript
Part One: 'Science Fiction versus Mundane Culture', 'The overlap between Science Fiction and other genres' and 'Horror Motifs' Transcript Date: Thursday, 8 May 2008 - 11:00AM Location: Royal College of Surgeons SCIENCE FICTION VERSUS MUNDANE CULTURE Neal Stephenson When the Gresham Professors Michael Mainelli and Tim Connell did me the honour of inviting me to this Symposium, I cautioned them that I would have to attend as a sort of Idiot Savant: an idiot because I am not a scholar or even a particularly accomplished reader of SF, and a Savant because I get paid to write it. So if this were a lecture, the purpose of which is to impart erudition, I would have to decline. Instead though, it is a seminar, which feels more like a conversation, and all I suppose I need to do is to get people talking, which is almost easier for an idiot than for a Savant. I am going to come back to this Idiot Savant theme in part three of this four-part, forty minute talk, when I speak about the distinction between vegging out and geeking out, two quintessentially modern ways of spending ones time. 1. The Standard Model If you don't run with this crowd, you might assume that when I say 'SF', I am using an abbreviation of 'Science Fiction', but here, it means Speculative Fiction. The coinage is a way to cope with the problem that Science Fiction is mysteriously and inextricably joined with the seemingly unrelated literature of Fantasy. Many who are fond of one are fond of the other, to the point where they perceive them as the same thing, in spite of the fact that they seem quite different to non-fans. -

William Gibson Fonds
William Gibson fonds Compiled by Christopher Hives (1993) University of British Columbia Archives Table of Contents Fonds Description o Title / Dates of Creation / Physical Description o Biographical Sketch o Scope and Content o Notes File List Catalogue entry (UBC Library catalogue) Fonds Description William Gibson fonds. - 1983-1993. 65 cm of textual materials Biographical Sketch William Gibson is generally recognized as the most important science fiction writer to emerge in the 1980s. His first novel, Neuromancer, is the first novel ever to win the Hugo, Nebula and Philip K. Dick awards. Neuromancer, which has been considered to be one of the influential science fiction novels written in the last twenty-five years, inspired a whole new genre in science fiction writing referred to as "cyberpunk". Gibson was born in 1948 in Conway, South Carolina. He moved to Toronto in the late 1960s and then to Vancouver in the early 1970s. Gibson studied English at the University of British Columbia. He began writing science fiction short stories while at UBC. In 1979 Gibson wrote "Johnny Mnemonic" which was published in Omni magazine. An editor at Ace books encouraged him to try writing a novel. This novel would become Neuromancer which was published in 1984. After Neuromancer, Gibson wrote Count Zero (1986), Mona Lisa Overdrive (1988), and Virtual Light (1993). He collaborated with Bruce Sterling in writing The Difference Engine (1990). Gibson has also published numerous short stories, many of which appeared in a collection of his work, Burning Chrome (1986). Scope and Content Fonds consists of typescript manuscripts and copy-edited, galley or page proof versions of all five of Gibson's novels (to 1993) as well as several short stories. -

Rose Gardner Mysteries
JABberwocky Literary Agency, Inc. Est. 1994 RIGHTS CATALOG 2019 JABberwocky Literary Agency, Inc. 49 W. 45th St., 12th Floor, New York, NY 10036-4603 Phone: +1-917-388-3010 Fax: +1-917-388-2998 Joshua Bilmes, President [email protected] Adriana Funke Karen Bourne International Rights Director Foreign Rights Assistant [email protected] [email protected] Follow us on Twitter: @awfulagent @jabberworld For the latest news, reviews, and updated rights information, visit us at: www.awfulagent.com The information in this catalog is accurate as of [DATE]. Clients, titles, and availability should be confirmed. Table of Contents Table of Contents Author/Section Genre Page # Author/Section Genre Page # Tim Akers ....................... Fantasy..........................................................................22 Ellery Queen ................... Mystery.........................................................................64 Robert Asprin ................. Fantasy..........................................................................68 Brandon Sanderson ........ New York Times Bestseller.......................................51-60 Marie Brennan ............... Fantasy..........................................................................8-9 Jon Sprunk ..................... Fantasy..........................................................................36 Peter V. Brett .................. Fantasy.....................................................................16-17 Michael J. Sullivan ......... Fantasy.....................................................................26-27 -

Nightmare Magazine, Issue 43 (April 2016)
TABLE OF CONTENTS Issue 43, April 2016 FROM THE EDITOR Editorial, April 2016 FICTION Reaper’s Rose Ian Whates Death’s Door Café Kaaron Warren The Girl Who Escaped From Hell Rahul Kanakia The Grave P.D. Cacek NONFICTION The H Word: The Monstrous Intimacy of Poetry in Horror Evan J. Peterson Artist Showcase: Yana Moskaluk Marina J. Lostetter Interview: David J. Schow Lisa Morton AUTHOR SPOTLIGHTS Ian Whates Kaaron Warren Rahul Kanakia P.D. Cacek MISCELLANY Coming Attractions Stay Connected Subscriptions and Ebooks About the Nightmare Team Also Edited by John Joseph Adams © 2016 Nightmare Magazine Cover by Yana Moskaluk www.nightmare-magazine.com FROM THE EDITOR Editorial, April 2016 John Joseph Adams | 750 words Welcome to issue forty-three of Nightmare! This month, we have original fiction from Ian Whates (“Reaper’s Rose”) and Rahul Kanakia (“The Girl Who Escaped From Hell”), along with reprints by Kaaron Warren (“Death’s Door Cafe”) and P.D. Cacek (“The Grave”). We also have the latest installment of our column on horror, “The H Word,” plus author spotlights with our authors, a showcase on our cover artist, and a feature interview with author David J. Schow. Nebula Award Nominations ICYMI last month, awards season is officially upon us, and it looks like 2015 was a terrific year for our publications. The first of the major awards have announced their lists of finalists for last year’s work, and we’re pleased to announce that “Hungry Daughters of Starving Mothers” by Alyssa Wong (Nightmare, Oct. 2015) is a finalist for the Nebula Award this year! Over at Lightspeed, “Madeleine” by Amal El-Mohtar (Lightspeed, June 2015) and “And You Shall Know Her by the Trail of Dead” by Brooke Bolander (Lightspeed, Feb. -

Cyberpunk and Dystopia: William Gibson, Neuromancer (1984)
13. CYBERPUNK AND DYSTOPIA: WILLIAM GIBSON, NEUROMANCER (1984) LARS SCHMEINK 1. Background 1.1 Terminologies and Definitions As with any literary genre, a clear-cut definition of cyberpunk is hard to find. Among scholars of science fiction (sf), many differentiate between a historical group of writers who met at the beginning of the 1980s, were originally known as ‘the Movement’, and consisted of William Gibson (*1948), Bruce Sterling (*1954), John Shirley (*1953), Rudy Rucker (*1946) and Lewis Shiner (*1950), and a sub-genre of science fiction that emerged at that time with that group but soon expanded beyond it. Its themes were appropriated and re-imagined by other authors, its tropes transported into other media and the subculture became absorbed into the mainstream, something that the propo- nents of the Movement deemed the death of cyberpunk (cf. Sterling 1998; Shiner 1991). Thomas Foster, however, points out, that “the transformation of cyberpunk into a full-fledged concept rather than a loose association of writers” needs to be under- stood not as its death but rather as “a sea change into a more generalized cultural for- mation” (2005: xiv). The term itself originated in the title of a short story by Bruce Bethke, but was used to refer to a specific sub-genre of sf writing by Gardner Dozois in order to describe an “80s generation in sf” adhering to a specific set of “goals and aesthetics” (1984: 9; cf. Heuser 2003: 7). These goals and aesthetics have been best documented by author Bruce Sterling, who as a preface to his Mirrorshades anthology has written the ultimate “Cyberpunk Manifesto” (1986).