Fritz Von Uhde Von Gerd Presler
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
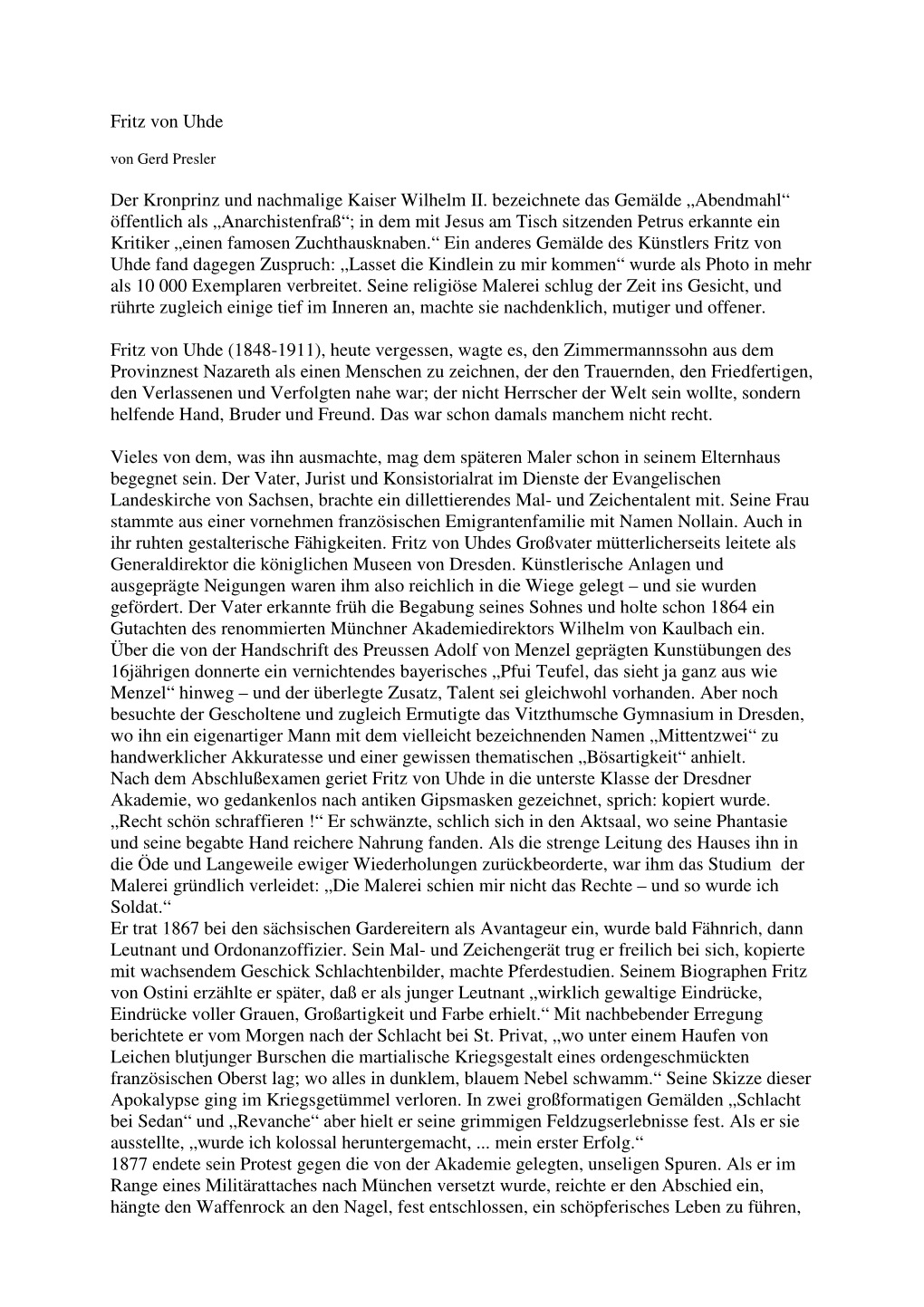
Load more
Recommended publications
-

A Guide for Educators and Students TABLE of CONTENTS
The Munich Secession and America A Guide for Educators and Students TABLE OF CONTENTS FOR EDUCATORS GETTING STARTED 3 ABOUT THE FRYE 3 THE MUNICH SECESSION AND AMERICA 4 FOR STUDENTS WELCOME! 5 EXPERIENCING ART AT THE FRYE 5 A LITTLE CONTEXT 6 MAJOR THEMES 8 SELECTED WORKS AND IN-GALLERY DISCUSSION QUESTIONS The Prisoner 9 Picture Book 1 10 Dutch Courtyard 11 Calm before the Storm 12 The Dancer (Tänzerin) Baladine Klossowska 13 The Botanists 14 The Munich Secession and America January 24–April 12, 2009 SKETCH IT! 15 A Guide for Educators and Students BACK AT SCHOOL 15 The Munich Secession and America is organized by the Frye in GLOSSARY 16 collaboration with the Museum Villa Stuck, Munich, and is curated by Frye Foundation Scholar and Director Emerita of the Museum Villa Stuck, Jo-Anne Birnie Danzker. This self-guide was created by Deborah Sepulvida, the Frye’s manager of student and teacher programs, and teaching artist Chelsea Green. FOR EDUCATORS GETTING STARTED This guide includes a variety of materials designed to help educators and students prepare for their visit to the exhibition The Munich Secession and America, which is on view at the Frye Art Museum, January 24–April 12, 2009. Materials include resources and activities for use before, during, and after visits. The goal of this guide is to challenge students to think critically about what they see and to engage in the process of experiencing and discussing art. It is intended to facilitate students’ personal discoveries about art and is aimed at strengthening the skills that allow students to view art independently. -

Seminararbeit Kunstgeschichte: Feierabend Von Max
Vorwort Bei der Ausarbeitung dieser Seminararbeit sah ich mich mit dem Problem konfrontiert, dass explizit zu dem Bild „Feierabend“ von Max Slevogt sehr wenig an begleitender Literatur zur Verfügung steht. Selbstverständlich habe ich die vorhandene Literatur bei der Erstellung dieser Arbeit verwendet, dennoch musste ich, besonders bei der Bildinterpretation, auf meine eigene Interpretationsvariante zurückgreifen. Ich bitte, diesen Sachverhalt bei der Korrektur der Seminararbeit zu berücksichtigen. 2 Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung ............................................................................. S. 4 2. Hauptteil ............................................................................... S. 4 2.1. Biographie des Malers .............................................. S. 4 2.2. Bilddaten ................................................................... S. 6 2.2.1. Titel ....................................................... .......... S. 6 2.2.2. Befund ............................................................. S. 6 2.2.3. Provinienz ........................................………..... S. 6 2.2.4. Entstehung ...................................................... S. 6 2.3. Bildaufbau ................................................................. S. 7 2.3.1. Vordergrund ....................................................S. 7 2.3.1. Hintergrund ..................................................... S. 8 2.3.2. Raumabschluss ............................................... S. 8 2.4. Bildanalyse ............................................................... -

Orientation English
thE PiNAKOTHEk MUSEUMS iN THE kUNSTAREaL MÜNChEN oRiENtatioN Schelling- straße Bus 154 Bus 154 U H H Universität Arcisstraße H 7/28 2 ENGLiSh 6 m U a / 3 NEUE Tr Heßstraße PINAKOTHEK U e ß e MUSEUM REICH a U2 ß r a t e DER KRISTALLE Bus 100 r s t ß n s a e Theresienstraße g i U H H H i l w a sstr i Pinakotheken MUSEUM d m c u A BRANDHORST L Ar TÜRKENTOR e ALTE ß ra PINAKOTHEK PINAKOTHEK t DER MODERNE Gabelsbergerstraße r S re H a e B Bus 100 ß a 0 10 r ÄGYPTISCHES s LENBACH- st MUSEUM Karolinen- Bu en HAUS platz k H r ü GLYPTOTHEK T NS-DOKU- U U Königsplatz ZENTRUM Brienner Straße H KUNSTBAU STAATL. GRAPH. Odeonsplatz SAMMLUNG STAATLICHE ANTIKEN- SAMMLUNGEN 5 aLtE PiNakothEk Daily except MON 10am–6pm | TUE 10am–8pm www.pinakothek.de/en/alte-pinakothek NEUE PiNakothEk Daily except TUE 10am–6pm | WED 10am–8pm www.pinakothek.de/en/neue-pinakothek PiNakothEk DER MoDERNE Daily except MON 10am–6pm | THURS 10am–8pm www.pinakothek.de/en/pinakothek-der-moderne MUSEUM BRaNDhoRSt Daily except MON 10am–6pm | THURS 10am–8pm www.museum-brandhorst.de/en Sammlung SChaCk WED–SUN 10am–6pm | Every 1st and 3rd WED in the month 10am–8pm www.pinakothek.de/en/sammlung-schack DEaR viSitoRS, NEUE PiNakothEk We hope you have an exciting visit and request that you please do not Barer Straße 29 touch the artworks. Please put umbrellas, large bags (bigger than A4) D 80799 Munich and backpacks in the lockers or check them into the cloakroom located T +49.(0)89.2 38 05-195 in the basement. -

The Blue Rider
THE BLUE RIDER 55311_5312_Blauer_Reiter_s001-372.indd311_5312_Blauer_Reiter_s001-372.indd 1 222.04.132.04.13 111:091:09 2 55311_5312_Blauer_Reiter_s001-372.indd311_5312_Blauer_Reiter_s001-372.indd 2 222.04.132.04.13 111:091:09 HELMUT FRIEDEL ANNEGRET HOBERG THE BLUE RIDER IN THE LENBACHHAUS, MUNICH PRESTEL Munich London New York 55311_5312_Blauer_Reiter_s001-372.indd311_5312_Blauer_Reiter_s001-372.indd 3 222.04.132.04.13 111:091:09 55311_5312_Blauer_Reiter_s001-372.indd311_5312_Blauer_Reiter_s001-372.indd 4 222.04.132.04.13 111:091:09 CONTENTS Preface 7 Helmut Friedel 10 How the Blue Rider Came to the Lenbachhaus Annegret Hoberg 21 The Blue Rider – History and Ideas Plates 75 with commentaries by Annegret Hoberg WASSILY KANDINSKY (1–39) 76 FRANZ MARC (40 – 58) 156 GABRIELE MÜNTER (59–74) 196 AUGUST MACKE (75 – 88) 230 ROBERT DELAUNAY (89 – 90) 260 HEINRICH CAMPENDONK (91–92) 266 ALEXEI JAWLENSKY (93 –106) 272 MARIANNE VON WEREFKIN (107–109) 302 ALBERT BLOCH (110) 310 VLADIMIR BURLIUK (111) 314 ADRIAAN KORTEWEG (112 –113) 318 ALFRED KUBIN (114 –118) 324 PAUL KLEE (119 –132) 336 Bibliography 368 55311_5312_Blauer_Reiter_s001-372.indd311_5312_Blauer_Reiter_s001-372.indd 5 222.04.132.04.13 111:091:09 55311_5312_Blauer_Reiter_s001-372.indd311_5312_Blauer_Reiter_s001-372.indd 6 222.04.132.04.13 111:091:09 PREFACE 7 The Blue Rider (Der Blaue Reiter), the artists’ group formed by such important fi gures as Wassily Kandinsky, Franz Marc, Gabriele Münter, August Macke, Alexei Jawlensky, and Paul Klee, had a momentous and far-reaching impact on the art of the twentieth century not only in the art city Munich, but internationally as well. Their very particular kind of intensely colorful, expressive paint- ing, using a dense formal idiom that was moving toward abstraction, was based on a unique spiritual approach that opened up completely new possibilities for expression, ranging in style from a height- ened realism to abstraction. -

Ernst Buchner
DISSERTATIONEN DER LMU 42 THERESA SEPP Ernst Buchner (1892–1962): Meister der Adaption von Kunst und Politik Künstlerisch, wissenschaftlich, unpolitisch? Ernst Buchner (1892–1962), Kunsthistoriker und Museumsleiter vor und nach 1945 Inauguraldissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Philosophie an der Ludwig‐Maximilians‐Universität München vorgelegt von Theresa Sepp aus München 2020 Erstgutachterin: Prof. Dr. Christine Tauber Zweitgutachter: PD Dr. Christian Fuhrmeister Datum der mündlichen Prüfung: 27.02.2020 Theresa Sepp Ernst Buchner (1892–1962): Meister der Adaption von Kunst und Politik Dissertationen der LMU München Band 42 Ernst Buchner (1892–1962): Meister der Adaption von Kunst und Politik von Theresa Sepp Herausgegeben von der Universitätsbibliothek der Ludwig-Maximilians-Universität Geschwister-Scholl-Platz 1 80539 München Mit Open Publishing LMU unterstützt die Universitätsbibliothek der Ludwig-Maximilians-Universität München alle Wissenschaft ler innen und Wissenschaftler der LMU dabei, ihre Forschungsergebnisse parallel gedruckt und digital zu veröfentlichen. Text © Theresa Sepp 2020 Erstveröfentlichung 2020 Zugleich Dissertation der LMU München 2020 Bibliografsche Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografe; detaillierte bibliografsche Daten sind im Internet abrufbar über http://dnb.dnb.de Herstellung über: readbox unipress in der readbox publishing GmbH Rheinische Str. 171 44147 Dortmund http://unipress.readbox.net -

Ferdinand Möller Und Seine Galerie Ein Kunsthändler in Zeiten Historischer Umbrüche
Ferdinand Möller und seine Galerie Ein Kunsthändler in Zeiten historischer Umbrüche Dissertation zur Erlangung der Würde des Doktors der Philosophie des Fachbereichs Kulturgeschichte und Kulturkunde der Universität Hamburg vorgelegt von Katrin Engelhardt aus Berlin Hamburg, 2013 1. Gutachter: Prof. Dr. Uwe Fleckner 2. Gutachterin: Prof. Dr. Julia Gelshorn Datum der Disputation: 4. April 2012 Tag des Vollzugs der Promotion: 16. April 2012 Inhalt Vorwort und Dank Einleitung 2 Ein Galeriebetrieb und sein Nachlass als Gegenstand 3 der Untersuchung Zum bisherigen Forschungsstand 7 Beginn einer Leidenschaft: vom Buchhändler zum 12 Galeristen in der Weimarer Republik Geschäftsführer der Galerie Ernst Arnold und 17 Selbständigkeit mit der eigenen Galerie in Breslau Möllers Einstieg in die Berliner Kunstszene 27 Ungewöhnliche Ausstellungen in Potsdam und 41 New York Rückzug nach Potsdam 48 Auf dem Weg zum Erfolg, die Galerie am Schöneberger 52 Ufer in Berlin Ausstellungen in neuen Galerieräumen 55 Gastauftritte: Die Blaue Vier 1929 und 61 Vision und Formgesetz 1930 Publikationen: Die Blätter der Galerie Ferdinand 69 Möller, erschienen im hauseigenen Verlag Handel nach der Inflation und zu Beginn der 71 Weltwirtschaftskrise Der beginnende Nationalsozialismus und die Wandlung der 77 Galerie Der politische Umschwung im Künstler- und 81 Ausstellungsprogramm der Galerie Eine Künstlergruppe: Der Norden und die Zeitschrift 91 Kunst der Nation von 1933 bis 1935 Käufer und Verkäufer: Handel mit Sammlern und 98 Museen Drei Ausstellungen vor dem „offiziellen“ -

National Gallery of Art
National Gallery of Art FOR IMMEDIATE RELEASE: Deborah Ziska, April 30, 2001 Press and Public Information Officer MEDIA CONTACT: Lisa Knapp, publicist (202) 842-6804 /-/<[email protected]/ "SPIRIT OF AN AGE" PRESENTS MAJOR 19TH-CENTURY GERMAN PAINTINGS SURVEY FROM ROMANTICISM TO EXPRESSIONISM OPENS JUNE 10 AT THE NATIONAL GALLERY OF ART Washington, D.C.-One of the most significant presentations, in terms of range and quality, of 19th-century German painting ever to be shown in the United States will be on view at the National Gallery of Art, East Building, June 10 through September 3, 2001. Spirit of an Age: Nineteenth-Century Paintings from the Nationalgalerie, Berlin provides a survey of 19th-century German painting, and a history of Germany itself, through 75 of the finest works by 35 artists from the collection of the Alte Nationalgalerie (Old National Gallery), Berlin. The museum, which opened in 1876 to house the Prussian king's collection of paintings and sculpture, is currently closed for renovations as part of a larger reorganization of all Berlin's museums. In December 2001, when the museum reopens, it will display for the first time since 1939 the complete collection of work for which it was built. ("aspai David I-nednch mm ill//if ll'uulm. 182: The exhibition is made possible by the Anna-Maria and Stephen Kellen Foundation. "This enlightening exhibition offers American audiences the unique opportunity to study the works of important German painters who are rarely represented in North American collections," said Earl A. Powell III, director, National Gallery of Art, Washington. -

Die Münchner Akademie in Den Jahren 1849-1886 Glanzzeit Und Krisenphänomene
Originalveröffentlichung in: N. Gerhart (Hrsg.) 200 Jahre Akademie der Bildenden Künste München, München 2008, S. 44-53 Die Münchner Akademie in den Jahren 1849-1886 Glanzzeit und Krisenphänomene HUBERTUS KOHL E In den Jahrzehnten nach der Jahrhundertmitte avancierte die Münchner Akademie zu einer der führenden in Europa. Stand die 1808 offiziell gegründete Institution zunächst noch im Schatten der Schulen in Düsseldorf und auch in Dresden, so begann sie mit dem Direktorat Wilhelm von Kaulbachs (1849-1874) und dann insbesondere Karl von Pilotys (1874-1886) Scharen von in- und ausländischen Studenten anzuziehen.1 Noch in den 1890er Jahren erklärte Picasso, einen Sohn lieber nach München denn nach Paris zur Ausbildung schicken zu wollen.2 Und mit dem Aufschwung der Akademie wurde München endgültig zu der deutschen Kunst stadt, nachdem König Ludwig I. dazu in seiner Regierungszeit die Grundlagen gelegt hatte. Das schönste und immer wieder zitierte literarische Zeugnis hierfür lieferte Thomas Mann in seiner 1901 verfassten Novelle Gladius Dei. Ganz am Anfang dieser Erzählung geht er auf die »Akademie der bildenden Künste, die ihre weißen 1 Johann von Schraudolph: Die Verkündigung an Maria, 1828, Arme zwischen der Türkenstraße und dem Siegestor ausbreitet«, Öl auf Holz, 34,5 x 26 cm, Kunstmuseum Basel ein. Er bezieht sich damit auf den von Gottfried von Neureuther entworfenen Neubau der Akademie, der in den Jahren 1875-1885 verschiedenen Meisterklassen bestehenden Systems, als Krönung ihrer inzwischen weltweit anerkannten Leistungs das unterschiedliche Stilrichtungen zu Wort kom fähigkeit realisiert worden war. Und auch wenn Manns Beschrei men ließ und neben die bis dahin favorisierte Monu bung durchaus ironisch gemeint war und damit Krisenerscheinun mentalmalerei auch die Tafelmalerei mehr und mehr gen nach der Jahrhundertwende benannte, so wirft sie doch ein in den Mittelpunkt rückte.3 Dass diese Reformen bezeichnendes Licht auf die Wahrnehmung der Institution. -

Daxer & M Arschall 20 19 XXVI
XXVI Daxer & Marschall 2019 Recent Acquisitions, Catalogue XXVI, 2019 Barer Strasse 44 | 80799 Munich | Germany Tel. +49 89 28 06 40 | Fax +49 89 28 17 57 | Mob. +49 172 890 86 40 [email protected] | www.daxermarschall.com 2 Oil Sketches, Paintings, Drawings and Sculpture, 1668-1917 4 My special thanks go to Simone Brenner and Diek Groenewald for their research and their work on the texts. I am also grateful to them for so expertly supervising the production of the catalogue. We are much indebted to all those whose scholarship and expertise have helped in the preparation of this catalogue. In particular, our thanks go to: Peter Axer, Iris Berndt, Robert Bryce, Christine Buley-Uribe, Sue Cubitt, Kilian Heck, Wouter Kloek, Philipp Mansmann, Verena Marschall, Werner Murrer, Otto Naumann, Peter Prange, Dorothea Preys, Eddy Schavemaker, Annegret Schmidt- Philipps, Ines Schwarzer, Gerd Spitzer, Andreas Stolzenburg, Jörg Trempler, Jana Vedra, Vanessa Voigt, Wolf Zech. 6 Our latest catalogue Oil Sketches, Paintings, Drawings and Sculpture, 2019 Unser diesjähriger Katalog Paintings, Oil Sketches, comes to you in good time for this year’s TEFAF, The European Fine Art Fair in Paintings, Drawings and Sculpture, 2019 erreicht Sie Maastricht. TEFAF is the international art market high point of the year. It runs rechtzeitig vor dem wichtigsten Kunstmarktereignis from March 16-24, 2019. des Jahres, TEFAF, The European Fine Art Fair, Maastricht, 16. - 24. März 2019, auf der wir mit Stand The Golden Age of seventeenth-century Dutch painting is well represented in 332 vertreten sind. our 2019 catalogue, with particularly fine works by Jan van Mieris and Jan Steen. -

Fall 2008 Recent
R E C E NT A C Q U I SI T IO N S FALL 2008 V O SE G ALLERI ES O F B O ST O N Samuel Lancaster Gerry (1813-1891) (detail) Lake Winnipesaukee in October Oil on canvas, 14 x 20 inches, Signed lower left: S. L. Gerry 1858 , Dated 1858 RECENT ACQUISITIONS September 19- November 12, 2008 VOSE GALLERIES OF BOSTON Raised in a farming family in Pennsylvania, Martin Johnson Heade’s modest roots did not presume that he would ultimately enjoy the longest career of any nineteenth-century American painter, and travel far beyond the boundaries of his home state. Heade began painting around the age of eighteen and settled in New York in 1843, a move that prompted a fifteen-year period during which he lived and journeyed throughout the United States and Europe, spending time in cities such as Rome, St. Louis, Chicago, Washington, D.C., Tren - ton, Providence and New Orleans. After his travels, Heade took a studio at the popular Tenth Street Studio Building in New York City, where he met the leading landscape artists of the day, including Frederic E. Church, who most likely influenced Heade’s lifelong interest in land- and seascape paint - ing. The artist’s long relationship with Vose Galleries began in the late 1850s while he was painting in Rhode Island. There he met Seth Vose, and the two became friends and col - leagues; Vose represented Heade’s pictures from as early as 1860. After leaving New York in 1862, the artist rented space in Boston’s newly-opened Studio Building. -

Die Geschichte Der Münchener Secession Bis 1938. Eine
die geschichte der Bettina Best münchener secession bis 1938 Eine Chronologie Einführung schließlich unvermeidlich. Die Münchener Secession wurde das erste und wichtigste Instrument der Streiter für ein neues Kunst- Vor mehr als einem Jahrhundert entstand 1892 in München eine ideal. Programme und Manifeste, Ideale von zukunftsweisendem der berühmtesten und zukunftsweisendsten Künstlervereinigun- Charakter und neue Gruppenkonzepte bilden die Hauptleistungen gen Deutschlands. Sie gab der Kunstszene eine neue Richtung und und die Exklusivität des secessionistischen Unternehmens. verschaffte der Entwicklung, die mit der Landschaftsmalerei der Schule von Barbizon kurz vor der Jahrhundertmitte des 19. Jahr- hunderts in Frankreich begonnen hatte und in allen Ländern Die Gründung des Vereins Bildender Künstler Münchens. Europas einen Wandel der Kunst auslöste, die Führungsposition. Münchener Secession im Jahre 1892 In Deutschland wurde bis zur Gründung der Münchener Seces- sion das Ausstellungswesen von der staatlichen Organisation der Die Münchener Secession wurde am 4. April 1892 als Verein Bil- deutschen Künstlergenossenschaften dominiert, die in allen grö- dender Künstler Münchens. Münchener Secession3 gegründet. Sie ßeren deutschen Städten seit Mitte des 19. Jahrhunderts die war die erste Gemeinschaft dieses Namens und »die berühmteste Künstlerschaft zusammenführten.1 Die Länderregierungen hatten aller neu gegründeten Vereinigungen«4. Karl Voll verkündete 1892 sich mit ihnen eine nationale Kulturrepräsentanz geschaffen. Die in der Zeitschrift Atelier,5 dass nun nach Paris, wo sich der Salon führende Kunstgattung war die Historienmalerei, die Möglichkeit du Champs du Mars 1890 gespalten hatte, und nach Düsseldorf, zur Selbstdarstellung nationaler Gesinnung bot.2 wo 1891 die erste deutsche Secession, die Freie Vereinigung Düs- Auch in Bayern führte unter Prinzregent Luitpold in der Münche- seldorfer Künstler entstanden war,6 auch München eine Secession ner Künstlergenossenschaft der Historismus die Kunstszene offi- habe.7 ziell an. -
Modern Paintings of the Prodigal Son: Depictions by James Tissot, Max Slevogt, Giorgio De Chirico, Aaron Douglas, and Max Beckmann, 1882-1949
Modern Paintings of the Prodigal Son: Depictions by James Tissot, Max Slevogt, Giorgio de Chirico, Aaron Douglas, and Max Beckmann, 1882-1949 A thesis submitted to the Graduate School of the University of Cincinnati in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts in Art History of the College of Design, Architecture, Art, and Planning by David S. Berger B.A. Bard College May 1982 Maryland Institute College of Art Post-Bac. Certificate, May 2005 Committee Chair: Theresa Leininger-Miller, Ph.D ABSTRACT The parable of the Prodigal Son (Luke: 15:11-32) conveys the Christian message of acceptance of sinners who have returned to righteous ways. The theme has been very popular in the history of art since the thirteenth century with scores of artists giving their interpretations. From the 1880s through the 1940s, representations became more modern and secular. Their was a greater emphasis on modern manners, psychology, the perception of time, and individuality. I analyze these factors in case studies of five artists of the period through formal analysis of their works and by exploration of social, historical, and philosophical aspects. I also examine relevant biographical information and iconography. The first chapter concerns two serial works by James Tissot and Max Slevogt. This serial nature of paintings of the parable was apparently new for the 1880s. In these narratives, Tissot explored modern manners in a near-photographic style of four canvases while Slevogt conceived a psychological portrait about extreme depravation in a triptych. In the second chapter, I argue that Giorgio de Chirico attempted to transcend time by the reanimation of the mannequin and statue, objects integral to his metaphysical art.