Vernetzungs- Projekt
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
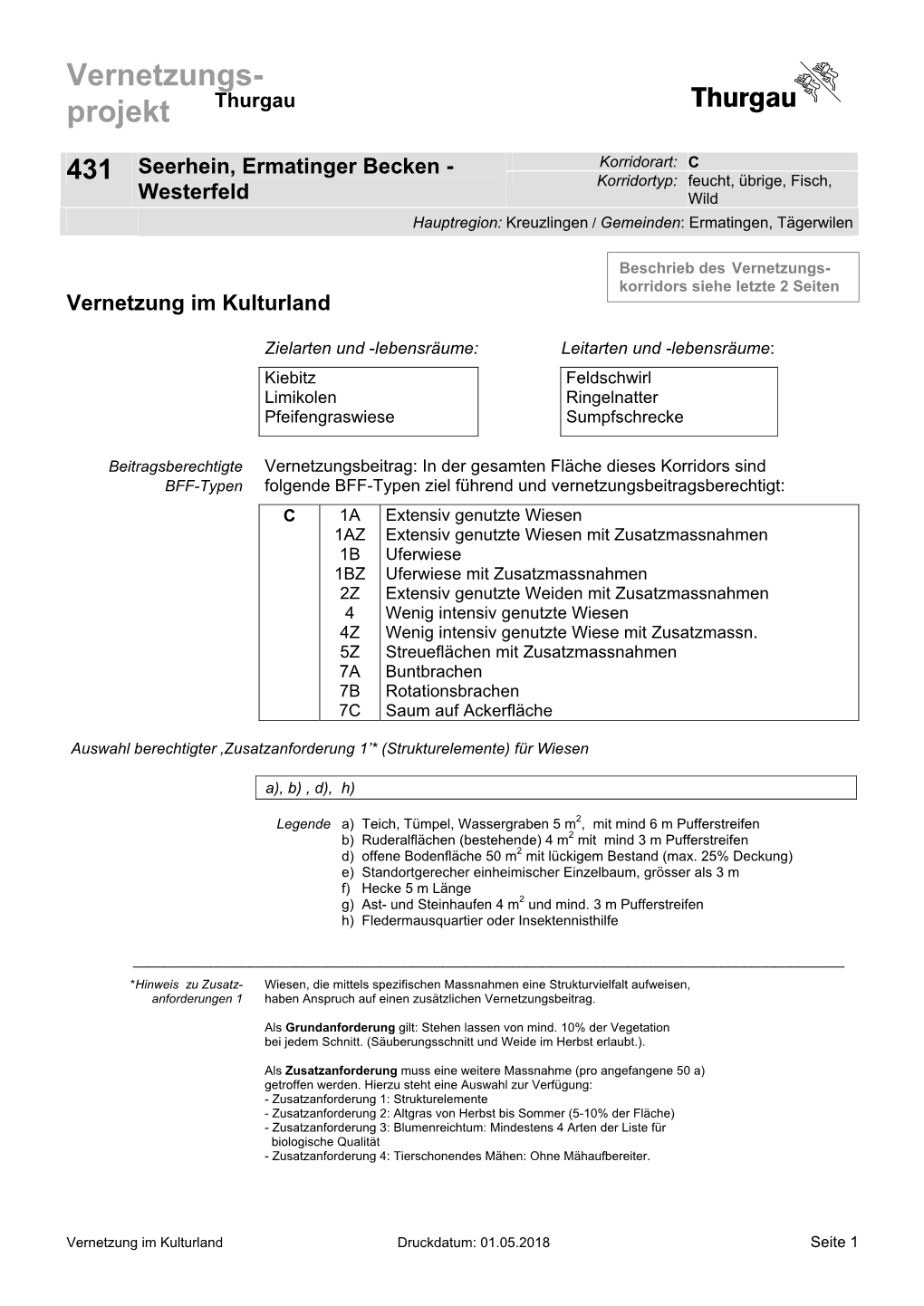
Load more
Recommended publications
-

Focus on Stamps 2/2016
Gottardo 2016 Swiss wrestling Nocturnal animals Base tunnel links north and south The sport that gets Swiss hearts Our night, their day beating faster Gottardo 2016 special stamps with real powdered stone from the Gotthard tunnel 2/2016 Focus on stamps The Collector’s Magazine Editorial and contents Dear Reader A certain breakthrough is opening up new per- spectives and connections: the first weekend in June will see the grand opening of the Gotthard Base tunnel and, with it, completely new pros- pects for north and south. At 57 kilometres in length, it is a world-record-breaking tunnel. 28,200,000 tonnes of rock were excavated during the construction process – particles of which you can find on the special stamps with a gutter. At the end of August, our champion Swiss wres- Alptransit AG tlers will be offering up fierce battles in the saw- dust, fighting for the coveted laurel wreath in Estavayer-le-Lac. A special sheet of stamps with a vignette in the centre pays tribute to the tradi- tional Swiss sport. While we humans sleep the sleep of the just, it’s time for four of our animal friends to come out to play: the “Nocturnal animals” set presents crea- tures that few of us are lucky enough to catch a glimpse of in the wild. This year’s combination print whisks us off to north-eastern Switzerland – to the beautiful, idyl- lic region of Lake Constance. The motif is sure to put you in a holiday mood. Preview of The new set of Pro Patria stamps (with surcharge) the diverse topics covered in this showcases fortresses and castles. -

Stiftung Drachenburg Und Waaghaus Gottlieben Unsere Vision Von Gottlieben (Oktober 2020)
Stiftung Drachenburg und Waaghaus Gottlieben Unsere Vision von Gottlieben (Oktober 2020) «Gottlieben soll wieder ein Leuchtturm in Gastronomie und Hotellerie werden. Wir wollen der Perle am Seerhein-Ufer wieder zu neuem Glanz verhelfen und die Gaststätten wieder zu dem machen, was sie früher einmal waren.» 1 1. Kleinod und Perle Kleinod Perle Das historische Dreigespann von Drachenburg, Waaghaus Die Seminar-, Bankett- und abwechslungsreiche Ferien- und Rheineck in Gottlieben stammt aus dem 17. Jahrhundert destination bietet Lern-, Kultur- und Sportinteressierten ein und gehört dem weit über die Grenzen hinaus bekannten Tra- selten reichhaltiges Angebot. Ob zu Fuss, mit dem Kajak, ditionsunternehmen Hotel Drachenburg & Waaghaus AG. mit Rad, Auto, ÖV oder Schiff (und auch in Kombination) Die wunderschönen Gebäude prägen nach Auffassung von locken Napoleon-Turm in Wäldi, Napoléon Museum Prof. Dr. h.c. Albert Knöpfli einen der schönsten Dorfplätze Schloss Arenenberg, historisches Stein am Rhein, Kloster der Schweiz. Knöpfli ist ehemaliger Thurgauer Denkmal- Stein am Rhein (zu Unrecht ganz im Schatten der Kartause pfleger und später Initiant, Gründer und Leiter des Instituts Ittingen in der Nähe), Schaffhausen mit Festung Munot für Denkmalpflege an der ETH Zürich. Die unter eid- und dem Rheinfall, St. Gallen mit Stiftsbibliothek und genössischem Denkmalschutz stehende besonders wertvolle Museen, Theater und Konzerten nicht nur im Stifts- «Drachenburg» gehört mit den zwei zwiebelgekrönten bezirk, Konzil Stadt Konstanz, Insel Reichenau, mediterrane Erkern, der eine davon sogar über zwei Stockwerke, zu den Insel Mainau, Tierpark auf dem Bodanrück, Meersburg schönsten Riegelhäusern der Schweiz. Und die Lage neben mit Schloss, Zeppelinmuseum in Friedrichshafen oder das dem historisch bedeutungsvollen Schloss Gottlieben am Strandbad Tägerwilen am Rhein, nur fünf Gehminuten Seerhein ist einmalig, mitten in der touristisch aufstrebenden von Drachenbug und Waaghaus entfernt. -

Long-Term Changes in the Water Level of Lake Constance and Possible Causes
Hydrology of Natural and Manmade Lakes (Proceedings of the Vienna Symposium, August 1991). IAHS Publ. no. 206, 1991. Long-term changes in the water level of Lake Constance and possible causes G. LUFT Landesanstalt fur Umweltschutz Baden-Wiirttemberg, Abt. 4: Wasser, Benzstrafie 5, D-7500 Karlsruhe 21 (F.R.G.) G. VAN DEN EERTWEGH Agricultural University Wageningen, Department of Hydrology, Soil Physics, and Hydraulics, NL-6709 PA Wageningen, formerly Landesanstalt fur Umweltschutz Baden-Wiirttemberg ABSTRACT Lake Constance is a natural reservoir system consisting of two parts, Obersee and Untersee. River Rhine flows through the lake. At the lakeside and in shallow shore zones, erosion and vegeta tion damages have been observed. Long-term changes in the water-level can be one of the causes of erosion processes and were investigated in this study. Also possible causes of these changes were taken into consideration. The results of frequency and trend analysis and Gaussian low pass filtering show that the water level of Lake Constance and its regime has changed. Mean annual water levels (Untersee), discharges (Alpenrhein and Hochrhein), and areal precipitation depths have remained nearly constant. Peak water levels and discharges have dropped, low water levels and discharges have increased. On the contrary, the mean annual water level of Obersee has dropped, low water levels have remained constant. The changes in water level have probably been caused by changes of hydraulic conditions in the outflow-regions of the lake. This process has been superposed by development and operation of storage reservoirs (hydropower purposes) in the catchment area of the Alpenrhein. Its seasonal runoff regime has been strongly influenced by an increase of low discharge, predominantly in the winter and a decrease of peak discharge in the summer. -

Beobachtung Eines Frisch Geschlüpften Weibchens Von Boyeria Irene Am Seerhein (Odonata: Aeshnidae)
Boyeria irene am Seerhein 20. Dezember 2010169 Beobachtung eines frisch geschlüpften Weibchens von Boyeria irene am Seerhein (Odonata: Aeshnidae) Manfred Hertzog Rebhaldenstrasse 19, CH-596 Scherzingen, <[email protected]> Abstract Record of a freshly emerged female of Boyeria irene on the Constance Rhine narrows (Odo- nata: Aeshnidae) – On 17-viii-2007 a teneral female B. irene was found and documented photographically near Gottlieben, Canton of Thurgau, Switzerland, west of Constance, where a 4 km-section of the River Rhine connects the upper with the lower part of Lake Con- stance. This is the first record of reproduction of this species in the Lake Constance basin. Zusammenfassung Am 17. August 2007 wurde an der Mündung eines Baches in den Seerhein, der Verbindung zwischen Bodensee und Untersee, bei Gottlieben (Kanton Thurgau, Schweiz) ein frisch ge- schlüpftes Weibchen von Boyeria irene beobachtet und fotografisch dokumentiert. Es ist dies der erste Entwicklungsnachweis für die Art im Bodenseegebiet. Einleitung Boyeria irene Die Westliche Geisterlibelle wurde in der Schweiz erstmals vor gut 130 Jahren nachgewiesen (Schoch 1880). Alte Fundangaben gibt es vom Vier waldstättersee, vom Genfersee, von Zürich sowie aus den Kantonen Aargau und Tessin (Maibach & Meier 1987). Die aktuellen Vorkommen beschränken sich auf wenige Seen am nördlichen Alpenrand, wo die Art zwischen rund 400 und 700 m ü.M. bodenständig ist (Hoess 2005). Im Jahr 2004 wurde am Bodenseeufer bei Friedrichshafen zweimal ein patrouillierendes Männchen beobachtet (Schmidt 2005). Drei Jahre später gelang für die Bodenseegegend am Seerhein bei Kon stanz erstmals ein Fortpflanzungsnachweis, über den hier kurz berichtet wird. Befund Am 17. August 2007 stieß ich am linken Ufer des Seerheins bei Gottlieben im schweizerischen Kanton Thurgau am Ostrand des HotelparksLibellula 29 Drachenburg, (3/4) 2010: 169-174 an 170 Manfred Hertzog der Mündung eines Baches in den Rhein (47°39,822‘N, 09°08.241‘E; Abb. -

Lake Constance Sales Guide 2020/21
english Bodensee! LAKE CONSTANCE SALES GUIDE 2020/21 Four countries. One lake. Trade compass. www.bodensee.eu Germany, Austria, Switzerland and the Principality of Liechtenstein Welcome to Lake Constance Region! Lake Constance is a classic year-round European destination. Today‘s holidaymakers are looking for just that. Boundless, refreshing, high quality, traditional, nostalgic – all that fits us. YOUR CONTACT FOR THE FOUR-COUNTRY REGION: Internationale Bodensee Tourismus GmbH Tourist Board of Lake Constance Hafenstrasse 6, 78462 Constance, Germany Phone +49 7531 909430 [email protected] www.lake-constance.com Publisher & Copyright: Internationale Bodensee Tourismus GmbH Subject to changes Design: hggraphikdesign Heidi Lehmann, Radolfzell Fotos: Internationale Bodensee Tourismus GmbH & their partners, Achim Mende Cover Photo: Zeppelin NT, Photograph: Michael Häfner (www.michael-haefner.com) All information for tour operators and travel agencies can be found at www.bodensee.eu/trade © Paul Aschenborn © Paul Switzerland in spring Principality of Liechtenstein in summer Germany in autumn Austria in winter 2 | Sales Guide Bodensee Lake Constance. In the heart of Europe. GERMANY SWITZERLAND AUSTRIA PRINCIPALITY OF LIECHTENSTEIN Sales Guide Bodensee | 3 Contents page Lake Constance Region and its Highlights ................................................................................................................................................ 8 General Information ......................................................................................................................................................................................... -

The Best Location Surrounded by the Borders
The best location surrounded by the borders Austria, Germany, Switzerland and Liechtenstein Water and mountains are the borders. To the north, Lake Constance. In the west, towards Switzerland and Liechtenstein. In the south and east are the Alps. It is an open minded, modern region. A very lively business and culture area. With an eye for beauty and aesthetic. Once where the inhabitants earned their living mainly by designing and producing embroideries and material. The magnificent villas of the "Textile barons" in Dornbirn are witnesses to that time of prosperity. Today´s designers, like Wolford, who produce exclusive body wear or innovative lighting systems like that from “Zumtobel Staff”, and the European centre for modern architecture have all made the area their home base. The landscape on the lake inspires poets and thinkers, artists and athletes, inhabitants and guests. A treat for both the eyes and ears: The Bregenz Festival with their spectacular productions on the largest water stage in the world. The art Bodensee in Dornbirn is the largest art fair in the area. The traditional bon fires which chase away the winter and bring carnival to an end. Jazz concerts, cabaret, small theatres - they are all here. Museums, exhibitions. There are many indoor and outdoor activities to keep you busy. The best location surrounded by the borders Bregenz Bregenz is Austria's culture and relaxation capital at Lake Constance, the capital of Vorarlberg, seat of the regional government, 27,000 inhabitants. Situated in the border region between Germany, Austria, Switzerland and Liechtenstein Bregenz has to offer a lot, in every season of the year. -

Wel Will Kommen
ERG B Ein Programm der Programm Ein Essen & Trinken, Wellness & Sport & Wellness Trinken, & Essen Regionen, Events, Kultur, Ausgehen, Ausgehen, Kultur, Events, Regionen, WEL TO BADEN-WÜRTTEM WELCOME COME TO BADENWÜRTTEMBERG G BER M RTTE NWÜ ADE IN B IN WILLKOMMEN EN KOMM IN BADEN-WÜRTTEM WILL Regions, Events, Culture, Clubbing, Food & Drink, Wellness & Sports A program of the B ERG WWW.HANDWERK.DE www.bw-jobs.de www.bw-career.de www.bw-career.de Können kennt www.bw-studyguide.de keineWWW.HANDWERK.DE Grenzen. BADENWÜRTTEMBERGBaden-Württemberg! to Welcome WWW.HANDWERK.DE career. professional non-academic your for conditions ding - operating small and medium-sized enterprises, there are also outstan also are there STIFTUNGenterprises, medium-sized and small operating Können kennt globally of number great a plus SAP and Festo Bosch, Porsche, Daimler, keine Grenzen. Wir stiften like Zukunftcompanies world-famous with economy, strong a to thanks And ces. - servi tailored individually and comprehensive many offer example, an Können kennt LEBEFLÄCHE LEBEFLÄCHE K SeitK dem Jahr 2000 ist die Baden- ermöglichen und die sie stark machen, p you give to just Centres, Welcome and Services Career instantaneously. Württemberg Stiftung die Innovations- den Herausforderungen der Zukunft keine Grenzen. werkstatt des Landes. Ihralmost Ziel ist es, die kompetentBaden-Württemberg in undhome at kreativfeel you zulet begegnen.also minds open Our . 5 MM . 5 MM Zukunftsfähigkeit . 5 MM des Landes zu stärken Denn hoch qualifizierte Menschen brin- CA undCA zu sichern. In keinem anderen Land gen Innovationen hervor, die die Basis sind die Ausgaben für ForschungHausen. zur undHarald fürand soziale AbsicherungNüsslein-Volhard bilden, optimaleChristiane Laureates Nobel Entwicklung, die Patentdichte und der Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten Anteil der Erwerbstätigen like in forschungs-thinkers, famous schaffenmany undforth damitbrought langfristigenhas and Wohl- opportunities career intensiven Industriezweigen höher als stand sichern. -

Ein Deutsches Stück Schweiz DAS TÄGERMOOS Ein Deutsches Stück Schweiz
DAS TÄGERMOOS Ein deutsches Stück Schweiz DAS TÄGERMOOS Ein deutsches Stück Schweiz — Anton und Genofeva Hörenberg mit Tochter Karoline: Konstanzer GEMÜSE- Tobias Engelsing GÄRTNER im Schweizer Tägermoos, 1903. „Der Rat ermahnt die Bürger- schaft, sich der Vexierwort und Schimpfreden zu enthalten, so etlich Unbedächtliche gegen die Thurgäuer pflegen zu gebrauchen.“ Der Rat der Stadt Konstanz an seine Bürger, 1628 Erschienen anlässlich der gleichnamigen Sonderausstellung des Rosgartenmuseums Konstanz 2016 INHALT Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar. ISBN 978-3-87800-098-3 8 ALTER STREIT UM GRÜNE FELDER Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. 10 Expansionsgelüste einer Reichsstadt Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung 18 Die Nase des Kaisers und Verarbeitung in elektronischen Systemen. 20 Wird Konstanz eidgenössisch? 24 Ein Kloster verkauft Land 26 Woher kommt der Name? — DIE DRUCKLEGUNG WURDE GEFÖRDERT DURCH 28 Schwedische Belagerung 38 Hinrichtungen auf Schweizer Boden 44 Ein Gefängnis am Rande der Felder GESELLSCHAFT DER FREUNDE DES ROSGARTENMUSEUMS E.V. 46 Napoleon und das Tägermoos 52 Ein Staatsvertrag schafft Rechtsfrieden 62 Wo verläuft die Grenze im See? 64 Das „Trompeterschlössle“ zahlt keine Steuern 68 Der entwischte Gefangene 70 Tägermoos gegen Raubgold 74 Ehetragödie im Wirtshaus — IMPRESSUM Herausgegeben von Tobias Engelsing für das Rosgartenmuseum Konstanz mit heutigen Aufnahmen von Hella Wolff-Seybold 76 MENSCHEN AUS DEM PARADIES 1. Auflage, Juli 2016 Gestaltung: bbv Siegrun Nuber, Konstanz 78 Von Nonnen und Turmwächtern Katalogredaktion: Annette Güthner (Südverlag), Lektorat: David Bruder, Korrektorat: Pfr. -

Stadtentwicklungsprogramm Zukunft Konstanz 2020 Stadtentwicklungsprogramm Zukunft Konstanz 2020
Stadtentwicklungsprogramm Zukunft Konstanz 2020 Stadtentwicklungsprogramm Zukunft Konstanz 2020 Impressum Herausgeberin: Stadt Konstanz Projektleitung: Christa Albrecht, Mechthild Kreis, [email protected], Tel. 07531/900-285 Texte: Ulrich Hilser Redaktion: Christa Albrecht, Ulrich Hilser, Mechthild Kreis, Angela Saizew Bilder: Oliver Hanser, Gerhard Launer (WFL-GmbH), Gisela Romero, Peter Pisa, Sandra Jöhle, Tou- rist Information Konstanz GmbH, Stadtmarketing Konstanz GmbH, Bäder Gesellschaft Konstanz, Technische Betriebe Konstanz, Entsorgungsbetriebe Konstanz, Stadtwerke Konstanz, Universität Konstanz, Klinikum Konstanz und Spitalstiftung Konstanz (rheingold GbR Werbeagentur) Konzept & Layout: Gravis, Konstanz Druck: werk//zwei Print+Medien Konstanz GmbH Konstanz im September 2008 2 Zukunft Konstanz 2020 Inhalt Vorwort Entwicklungen bewusst gestalten 4 Einleitung Vorwärts in die Zukunft 5 Bevölkerung – Demografischer Wandel Fit für den Wandel 8 Stadt Konstanz und Region Herz einer starken Region 10 Siedlung und Raumstruktur Kompakte Stadt mit kurzen Wegen 16 Wohnen Urban Wohnen in der grünen Stadt 24 Natur und Umwelt Mehr als „nur“ Öko? Logisch! 29 Mobilität Mobil auch ohne Motor 34 Arbeit und Wirtschaft Tradition trifft Innovation 39 Tourismus Das Mehr zum See 43 Bildung und Wissenschaft Exzellent, nicht elitär 47 Familie, Jugend, Soziales und Gesundheit Stadt für Jung und Alt 52 Freizeit und Sport Spitze im Breitensport 56 Kultur Kultur für Alle 59 Partizipation Von Bürgern für Bürger 63 Finanzen Intelligent investieren, sinnvoll sparen 65 Inhalt 3 Vorwort Entwicklungen bewusst gestalten Mit breiter Mehrheit verabschiedete der Gemeinderat im Januar 2008 das neue Stadtentwick- lungsprogramm (STEP) „Zukunft Konstanz 2020“. Es ist das Ergebnis eines jahrelangen Entwick- lungsprozesses, an dem sich die Bürger und Bürgerinnen intensiv beteiligten. Diese Broschüre fasst die Grundlagen, die Ziele und die Handlungsansätze aus allen Schritten des STEP-Prozesses zusam- men und bildet die strategische Ausrichtung der Stadt Konstanz bis 2020. -

Magazine English Edition
BODENSEEMAGAZINE ENGLISH EDITION Germany/Austria € 5,– Switzerland CHF 6.50 GERMANY | SWITZERLAND | AUSTRIA | PRINCIPALITY OF LIECHTENSTEIN 10001 4 197329 305001 TRIPS & SIGHTS, CULTURE & HISTORY, FOOD & WINE BÜNDNER ALPEN GLARNER ALPEN URNER ALPEN BERNER ALPEN SÄNTIS A LTMANN 2502 m 2436 m A LVIER DREI SCHWESTERN 2343 m 2052 m CHURFIRSTEN 2306 m RIGI MYTHEN SPEER 1699 m Zürich HOHER KASTEN M ATTSTOCK 1899 m 1795 m Ebenalp 1936 m 1950 m 1644 m TANZBODEN Chur KRONBERG 1443 m 1663 m Schwägalp V ierwaldstätter LIECHTENSTEIN Buchs 1278 m Neßlau See LUZERN VADUZ W asserauen Ebnat 868 m Montafon/Arlberg FÄHNERNSPITZ Zugersee Gonten W attwil H 1506 m W eißbad U r näsch Z ü C Lichtensteig r i c h ZÜRICH FELDKIRCH s e I W aldstatt G r e Hundwil e i f Pfäffiker e n s Appenzell e e E Rankweil See GMBH, www.teamwerk-neubert.de © TEAMWERK NEUBERT Oberriet USTER Hegnau KARREN R HERISAU KLOTEN 976 m Gais WIL Götzis A 13 Teufen T h u r Münchwilen R Altstätten GOSSAU Diepoldsau Speicher Wängi Hohenems Widnau BÜLACH S T. GALLEN E WINTER THUR Bödele Bischofszell Tobel T Heiden Wittenbach W alzenhausen DORNBIRN LUSTENAU A 1 Kradolf St. Margr ethen W olfhalden Zihlschlacht FRAUENFELD S RORSCHACH Berg Sulgen A 14 S Thal A 4 i n Rheineck C Amlikon Z h e Staad Hor n Felben R Höchst Steinach H I Andelfingen Erlen W E A l t Hagenwil ÖBregenzer W ald Fußach Gaissau e r ARBON W einfelden Kleinandelfingen R Pfyn T h u r Bizau h e Märstetten i Altenrhein Frasnacht Amriswil Ossingen Rheinau W olfurt n Neukir ch Berg Dettighofen Marthalen Lauterach R h e i n Egnach -

Tobias Engelsing GÄRTNER Im Schweizer Tägermoos, 1903
DAS TÄGERMOOS Ein deutsches Stück Schweiz — Anton und Genofeva Hörenberg mit Tochter Karoline: Konstanzer GEMÜSE- Tobias Engelsing GÄRTNER im Schweizer Tägermoos, 1903. „Der Rat ermahnt die Bürger- schaft, sich der Vexierwort und Schimpfreden zu enthalten, so etlich Unbedächtliche gegen die Thurgäuer pflegen zu gebrauchen.“ Der Rat der Stadt Konstanz an seine Bürger, 1628 Erschienen anlässlich der gleichnamigen Sonderausstellung des Rosgartenmuseums Konstanz 2016 INHALT Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar. ISBN 978-3-87800-098-3 8 ALTER STREIT UM GRÜNE FELDER Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. 10 Expansionsgelüste einer Reichsstadt Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung 18 Die Nase des Kaisers und Verarbeitung in elektronischen Systemen. 20 Wird Konstanz eidgenössisch? 24 Ein Kloster verkauft Land 26 Woher kommt der Name? — DIE DRUCKLEGUNG WURDE GEFÖRDERT DURCH 28 Schwedische Belagerung 38 Hinrichtungen auf Schweizer Boden 44 Ein Gefängnis am Rande der Felder GESELLSCHAFT DER FREUNDE DES ROSGARTENMUSEUMS E.V. 46 Napoleon und das Tägermoos 52 Ein Staatsvertrag schafft Rechtsfrieden 62 Wo verläuft die Grenze im See? 64 Das „Trompeterschlössle“ zahlt keine Steuern 68 Der entwischte Gefangene 70 Tägermoos gegen Raubgold 74 Ehetragödie im Wirtshaus — IMPRESSUM Herausgegeben von Tobias Engelsing für das Rosgartenmuseum Konstanz mit heutigen Aufnahmen von Hella Wolff-Seybold 76 MENSCHEN AUS DEM PARADIES 1. Auflage, Juli 2016 Gestaltung: bbv Siegrun Nuber, Konstanz 78 Von Nonnen und Turmwächtern Katalogredaktion: Annette Güthner (Südverlag), Lektorat: David Bruder, Korrektorat: Pfr. -
Gottliebenswür G
GOTTLIEBENswür g GEMEINDE GOTTLIEBEN T +41 (0)71 669 12 82 F +41 (0)71 669 15 67 [email protected] www.gottlieben.ch ÜBERBAUUNG ‚«RIETBLICK», SEECAFÉ ESPENSTRASSE 9 1 GEMEINDEHAUS GOTTLIEBEN KIRCHSTRASSE 11 2 GOTTLIEBEN ! Gut 300 Einwohnerinnen und Einwohner zählter Gottlieben. Wunderschöne Auch ruhen lässt es sich gut in Gottlieben, zur Nacht in unseren roman- Bürgerhäuser aus dem 17. Jahrhundert, die 1251 erbaute Wasserburg, tischen Hotels, am Tag auf einer der Bänke am Seerhein, die unter Schatten verwinkelte Gässchen und die herrliche Platanenallee mit Schiffsanlege- spendenden Platanen zum Verweilen einladen. Die unberührte Natur hat stelle prägen das Ortsbild. Es ist idyllisch und romantisch in Gottlieben, ihren Platz in Gottlieben. Wir geniessen sie und freuen uns gleichzeitig an aber nicht nur. Mit den beiden Werften, der Hüppenbäckerei und einigen der Nähe zu den umliegenden urbanen Zentren von Zürich, St. Gallen und weiteren Gewerbebetrieben haben attraktive Unternehmen bei uns ihren Konstanz. Die Freude unserer zahlreichen Gäste macht uns immer wieder Standort gefunden. Und dass Gottlieben durchaus inspirierend sein auch ein bisschen stolz. Denn auf den ersten Blick scheint die Zeit in Gott- kann, zeigt das vielfältige Angebot im kulturellen Bereich. Das wunderbar lieben zwar stehen geblieben zu sein, wer aber genauer hinsieht, entdeckt restaurierte Bodmanhaus mit der Handbuchbinderei ist heute eines der hinter der prächtigen Kulisse pulsierendes und spannendes Leben. Unsere wenigen Literaturhäuser der Schweiz und immer einen